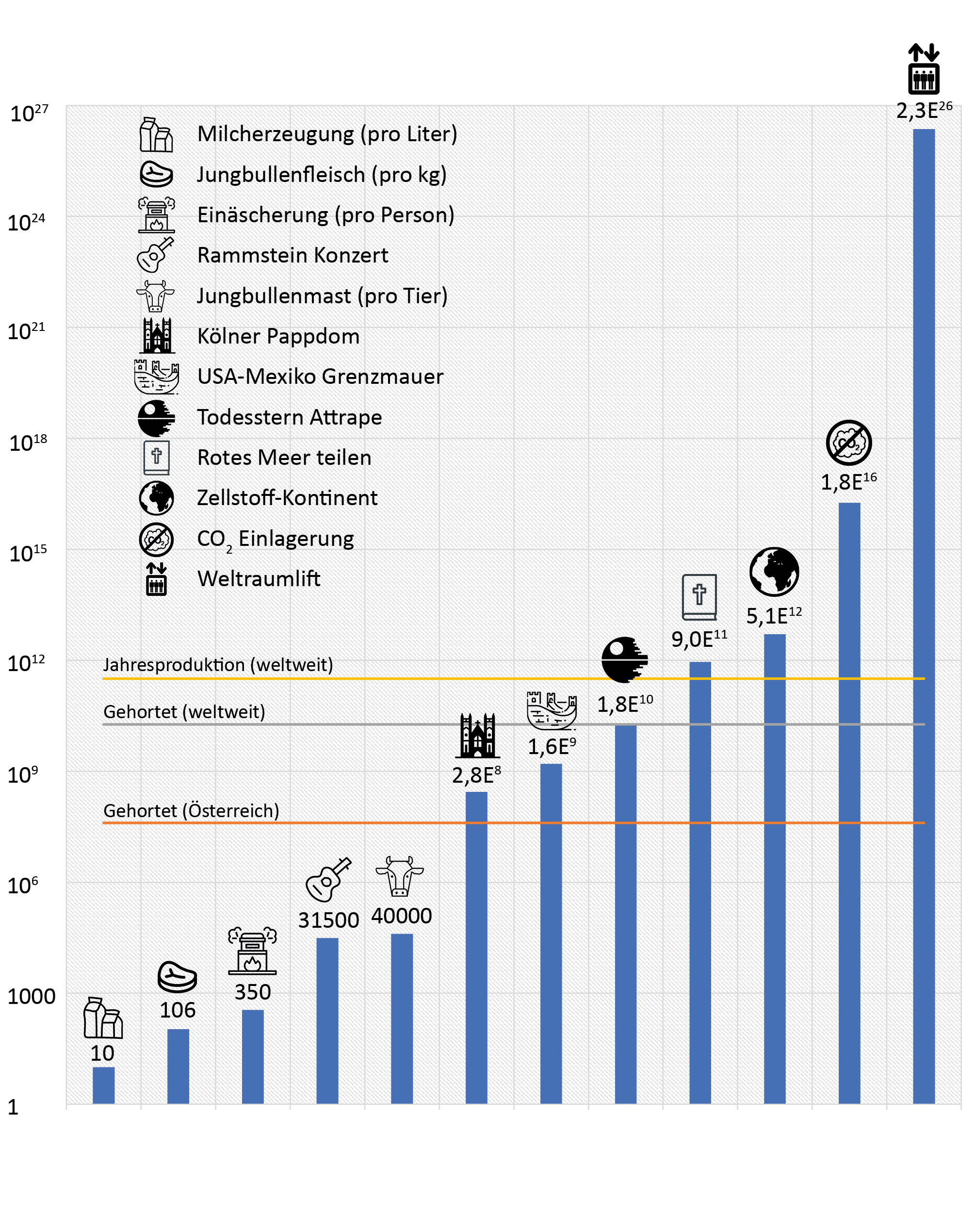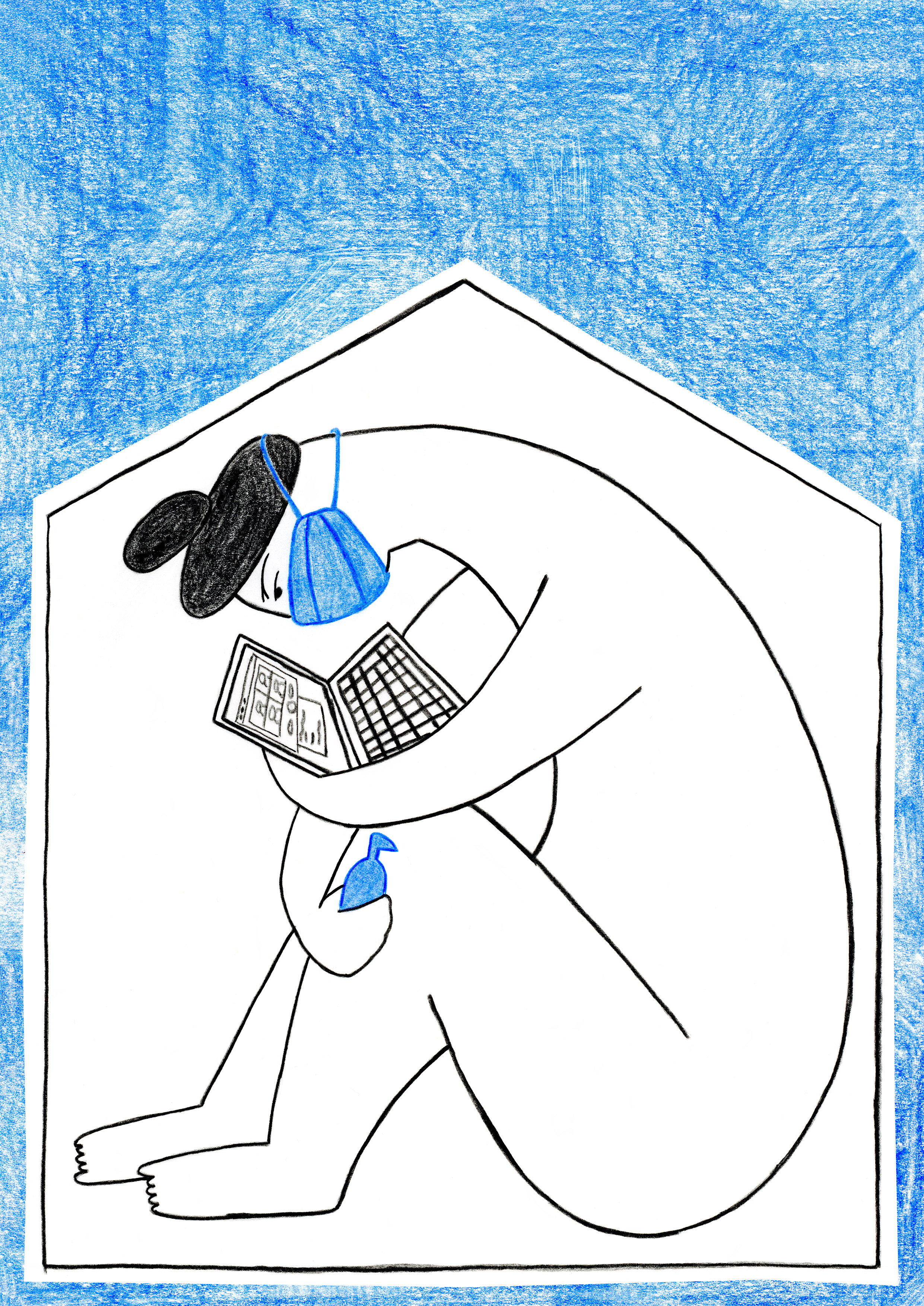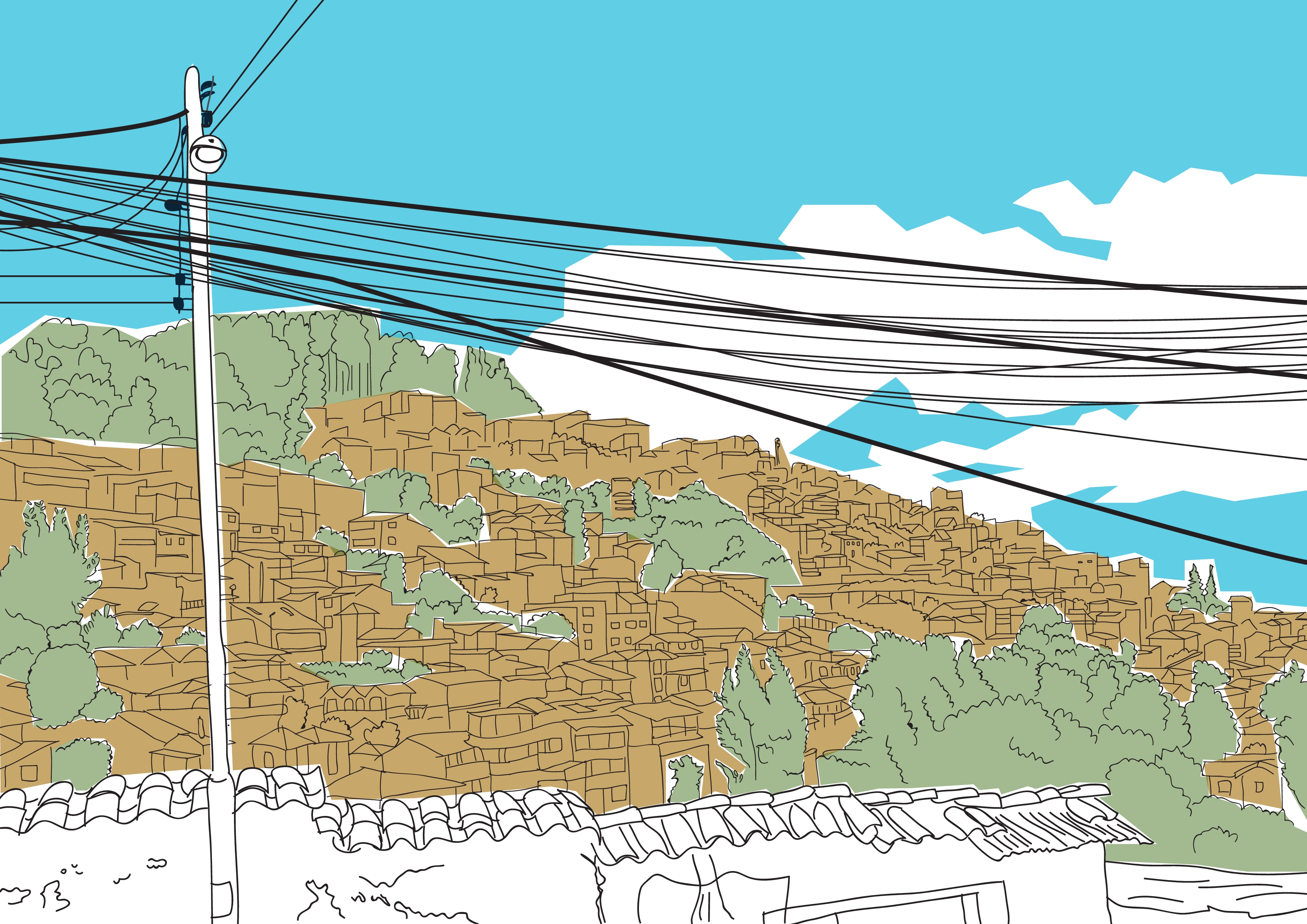Kultur, Kapitalismus und Corona

„Den Kunst- und Kulturtod wird’s nicht geben“, verkündete Ulrike Lunacek vehement in der
Sendung Kulturmontag (ORF 2) am 20.4.2020. Sie stirbt nicht so schnell, die Kulturnation
Österreich, aber bei allem Optimismus fühlen sich Kulturschaffende von Politiker_innen
missverstanden. Die Pressekonferenz von Vizekanzler Werner Kogler und Staatssekretärin Ulrike
Lunacek am 17.4.2020 wies einige Lücken auf. Die sechs österreichischen Kunstuniversitäten
wandten sich mit einem Brief an die Bundesregierung. Es ist weiterhin unklar, ob und wann
Proben wieder aufgenommen werden können, Konzerte und Festivals müssen abgesagt
werden. Die Einnahmequellen von freiberuflichen Musiker_innen, zu denen auch viele
Studierende zählen, sind bis auf weiteres versiegt.
Musik als Lebensinhalt und -unterhalt
Der Lehrbetrieb an einer Kunstuniversität unterscheidet sich grundsätzlich von den meisten
anderen Fächern und läuft im Moment wie überall nur digital ab. Michael Hell, Professor für
Cembalo und Generalbass an der Kunstuniversität Graz, berichtet von einer anfänglichen
„Mischung aus Neugier und einer gewissen Hemmschwelle“. Einzelunterricht, Vorlesungen und
Seminare aus dem Wohnzimmer und Audioaufnahmen seiner Studierenden statt Live-Vorspiel
im Unterricht seien seine „neue Normalität“.
Einige Fächer stoßen schnell auf infrastrukturelle Probleme, weil dafür sperrige Instrumente benötigt werden. Michael Hell gelang es noch vor dem Lockdown, fast all seine Studierenden mit einem Cembalo (Tasteninstrument) aus der Universität zu versorgen. Ein praktischer Vorteil ist bei künstlerischen Studiengängen also die vergleichsweise kleine Studierendenzahl.
Was im Moment ausbleibt, ist das Ensemblespiel, das miteinander proben und musizieren. Es ist
offen, wann Musikstudierende wieder proben dürfen. Gruppenproben für professionelle
Musiker_innen sind ab 1. Juni angedacht (Stand: 17.4.2020), aber es ist unklar, ob dazu auch die
angehenden gezählt werden. Paola Garcia Sobreira, Bassistin und Masterstudentin an der
Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, kann die freie Zeit gerade gut für die
Überarbeitung ihres Abschlussprojekts nutzen. Aber sie räumt auch ein: „Ob sich meine Arbeit
ausgezahlt hat, werde ich erst wissen, wenn ich wieder proben kann.“ Sollte sich dieses „wenn“
noch lange hinziehen, wird sie ihr Studium nicht in Mindeststudienzeit abschließen können.
Kreative Arbeit ist kein Allgemeingut
Vielerorts gelobt werden gleichzeitig die sogenannten Balkonkonzerte. Alle Menschen befinden
sich in einer emotionalen Ausnahmesituation, neben Existenzängsten fehlt die soziale
Infrastruktur. Die jetzige Situation zeigt jedoch auch, wie Arbeit gewürdigt wird. Den Ärzt_innen
und Pfleger_innen wird applaudiert – sie kämpfen seit Jahren für fairere Löhne und bessere
Arbeitsbedingungen. Man öffnet den Laptop und kann verschiedenen Livestreams von
Konzerten lauschen – ohne etwas dafür zu bezahlen. Kulturschaffenden wird suggeriert, dass sie
ihre Arbeit der Gesellschaft schuldig sind. Garcia Sobreira sieht solche Erwartungen an
Musiker_innen skeptisch: „Ich glaube, Leute machen sich manchmal ein bisschen Illusionen
damit, wie leicht man im Internet Geld verdient.“ Influencer_innen würden oft Jahre brauchen,
um mit ihrer digitalen Präsenz Geld verdienen zu können. Man mache es sich etwas zu leicht,
wenn man von Musiker_innen erwarte, ihre wegfallenden Konzerteinnahmen durch digitale
Formate ersetzen zu können.
The show must go on?
Musikstudierende stehen eigentlich gerade am Beginn ihrer Karriere. Viele von ihnen sind auf
die Einnahmen von Konzerten und Gigs angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.
Sorgen macht sich Paola Garcia Sobreira über Studierende aus Drittstaaten: „Um das Visum zu
bekommen, braucht man ja einen ziemlich hohen Betrag auf dem Konto, egal ob man einen Studienplatz hat oder nicht.“
Positives kann Michael Hell berichten, dessen Studierende Hilfe vom Notfalltopf der ÖH erhalten haben.
Konzerte haben für junge Musiker_innen aber nicht nur finanzielle Bedeutung, sondern prägen
die Karriereentwicklung, betont Garcia Sobreira. Die momentane Krise im Kulturbetrieb habe
ihre Berufswünsche eher verfestigt als verändert, sie sieht sich immer schon in einer
Kombination aus Freelancing und Festanstellung. Ein vielfältiges Berufsfeld ist auch das des
Cembalisten und Blockflötisten Michael Hell und seiner Studierenden. Er findet es wichtig, sich
jetzt Gedanken um mögliche Szenarien der ungewissen Zukunft zu machen. Eine Rückkehr zur
Vor-Corona-Zeit wünscht er sich nicht, „sondern einen bewussteren Umgang mit dem Thema
Vorsorge, soziale Absicherung und Förderung.“
Die Entscheidungen stehen noch aus, aber die Auswirkungen für Studierende und Lehrende an
Kunstuniversitäten sind unmittelbar. Michael Hell sieht Künstler_innen wie auch Politik in der
Verantwortung, den Veränderungsprozess anzustoßen. Er und seine Studierenden werden
weiterhin das beste aus der Situation machen. „Ich bewundere meine Studierenden, die in
dieser Situation so unglaublich gut durchhalten“, berichtet der Musiker. Er vermutet, dass die
Situation, in einem fremden Land dauernd in einem kleinen Zimmer zu sein, für einige
Studierende durchaus emotional und psychisch belastend ist. Glücklich und erstaunt sei er
deswegen, „dass alle Gespräche und Unterrichtseinheiten positiv und konstruktiv sind.“ Bleibt
nur abzuwarten, dass Österreich zeigt, was ihm an der Kulturnation von morgen liegt.