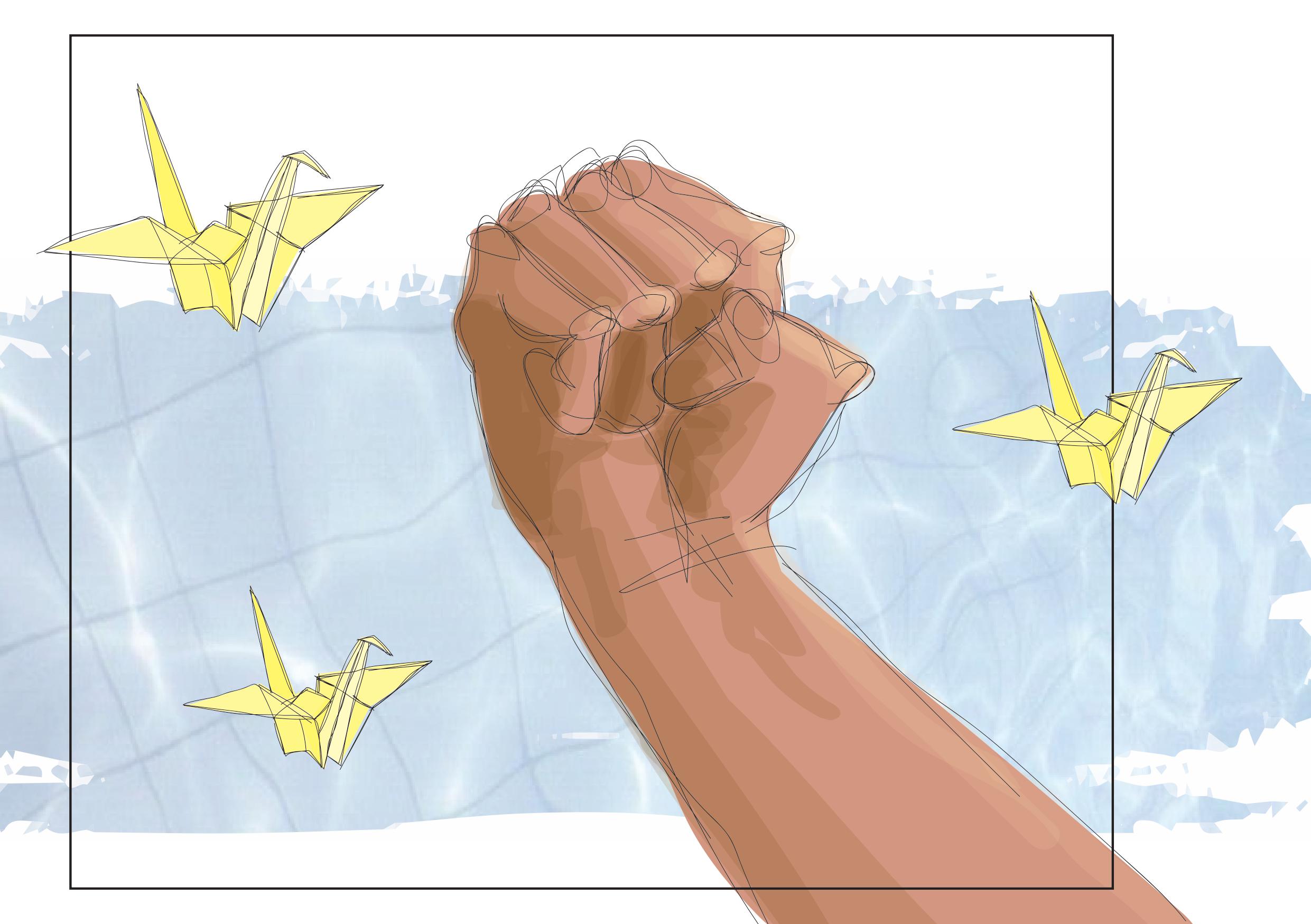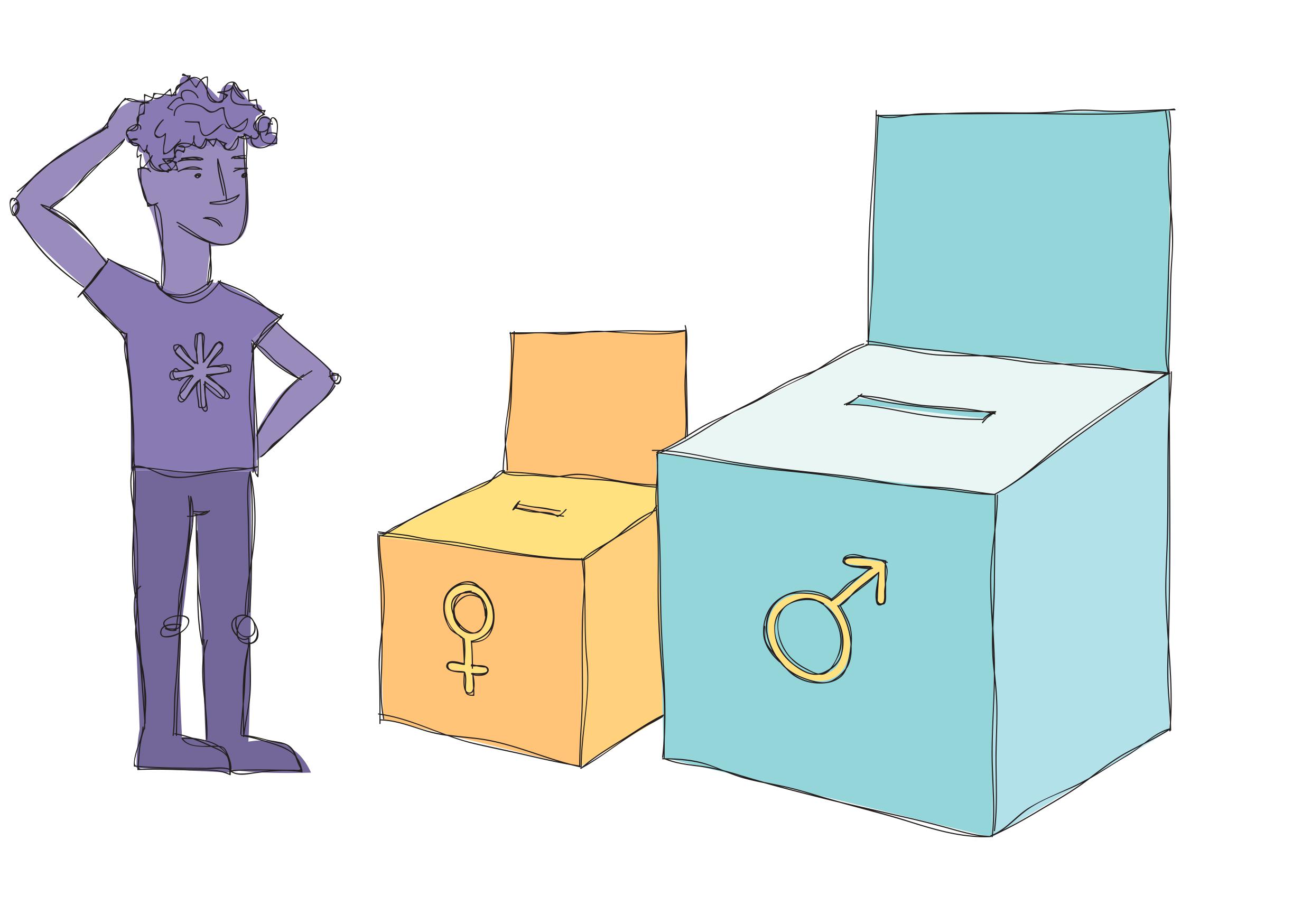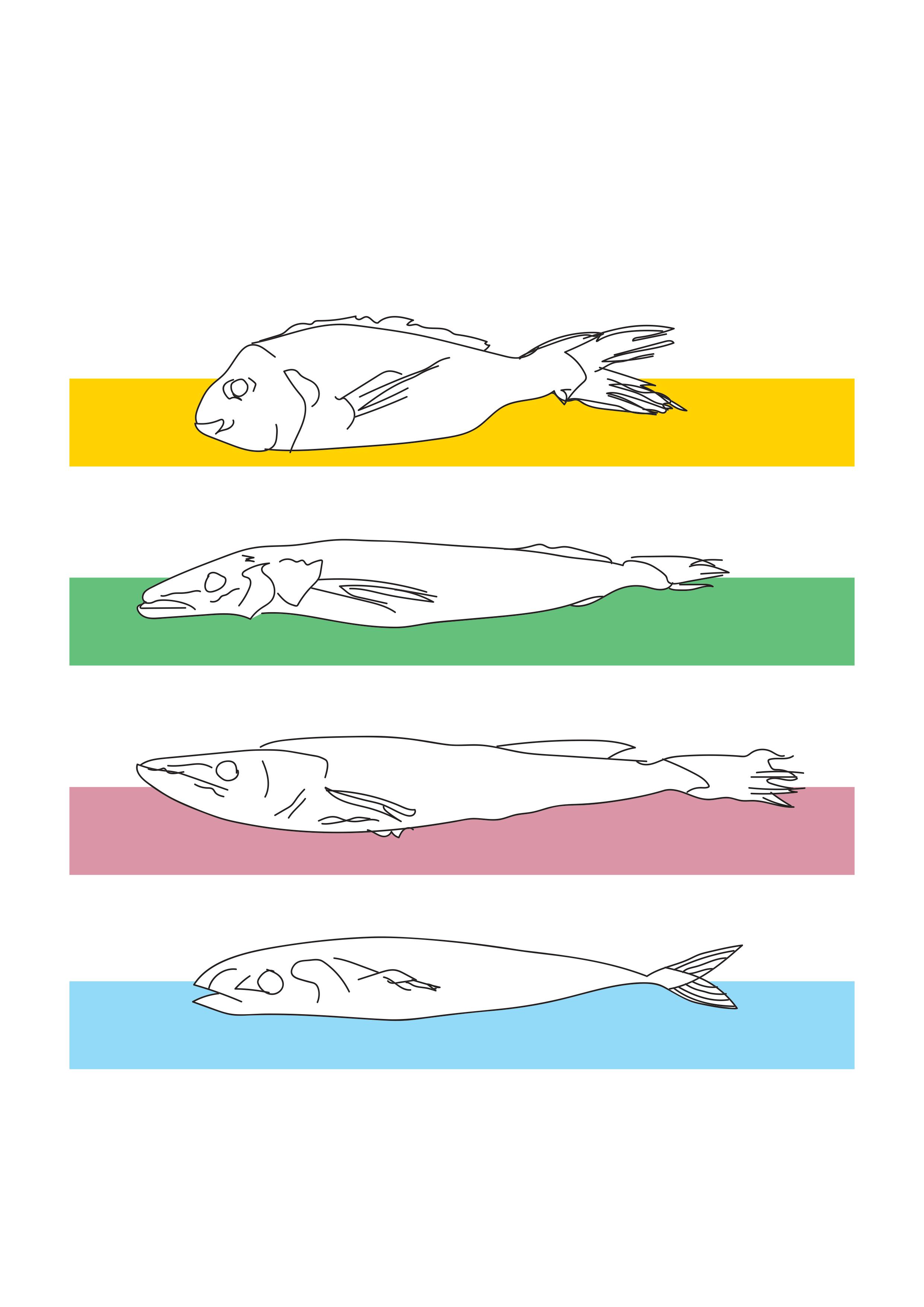Gekommmen um zu bleiben!

Ich muss zugeben, dass ich nach diesen fünf Tagen der Besetzung das erste Mal in meinem gesamten Architekturstudium das Gefühl hatte so richtig zu verstehen, was Zeichensaal-Atmosphäre ist. Ich konnte sie richtig spüren. All die Erzählungen von Höhersemestrigen, was Zeichensäle alles können – insbesondere das Zusammenarbeiten und die bedingungslose Unterstützung – schienen mir jetzt greifbar zu sein. Umso größer war der Schmerz, das Gebäude am Mittwoch, den 30. Oktober 2019, wieder verlassen zu müssen.
Freitagnacht, 26. Oktober. Die Feier, welche seit dem Vorabend stattfindet, klingt langsam aus. Ein paar Studierende stehen noch bei Getränken zusammen. Dabei richtet sich ihr Blick auf den „Luftpavillon“ inmitten des Hof 2 der TU Wien. Das Gebäude, in dem einst das Café Nelson’s untergebracht war, steht nun schon seit zwei Jahren leer. Eine Schande. Kurzerhand treten sie an das Gebäude heran. Die Tür ist nicht verriegelt.
In den frühen Morgenstunden beginnt die Besetzung des ehemaligen Café Nelson’s. Seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten, kämpfen wir Architekturstudierende schon um mehr Zeichensäle. Ein Gut, welches hier bei uns an der TU leider nur sehr rar gesät ist. „Die Situation an der TU ist untragbar. Man pendelt regelmäßig alle paar Stunden von Raum zu Raum, weil die kaum vorhandenen Zeichensaalplätze belegt sind“. Philipp, ein Kommilitone, den ich während der Besetzung kennen- und schätzen lernen werde, kann die akute Raumnot nicht mehr hinnehmen: „Ständig werden wir mit ungenutzten oder leerstehenden Räumen wie dem Nelson's konfrontiert, das seit geraumer Zeit nur als Kistenlager verwendet wird. Das ist unheimlich frustrierend“. Auf offiziellem Wege wurde schon oft versucht, an Räumlichkeiten zu kommen, auch wir Studierende reden schon lange über Lösungsansätze, doch noch nie waren wir uns so einig wie zu diesem Zeitpunkt: Wir müssen uns der Raumproblematik selbst annehmen.
Samstag, 27. Oktober. Die Flügeltür des ehemaligen Café Nelson’s steht offen, eine Handvoll Studierende spazieren ein und aus. Die Verlockung, nach zwei Jahren Leerstand nun wieder das Gebäude zu betreten, ist groß. Das erste Obergeschoß durfte damals ohne Konsumzwang als Zeichensaal genutzt werden, mit seiner Schließung entfiel der Saal – damals war ich am Anfang meines Architekturstudiums. Jetzt, zwei Jahre später, stehe ich vor verstaubten Tischen und Stühlen. In den nächsten Tagen werde ich sie belebter als nie zuvor wahrnehmen.
Nach einem Telefonat mit Dominik sitze ich in der U-Bahn und habe eine Luftmatratze, Decken und Handtücher im Gepäck, einen Jutebeutel mit Hygieneartikeln und etwas Verpflegung für die Nacht. Als ich die Räumlichkeiten betrete, sitzen mir bloß drei Gesichter gegenüber. Ich kenne nicht einmal alle ihre Namen, aber das macht nichts. Wir verfolgen gemeinsam ein größeres Ziel. Wir wollen sichtbar sein und die untragbare Raumsituation in die Mitte des Hochschuldiskurses rücken. Wenn acht Architekturstudierende sich einen Quadratmeter Arbeitsraum teilen müssen, dann ist das Maß nicht nur voll, sondern am Überlaufen.
Sonntag, 28. Oktober.. Studierende lassen sich nieder, um ihre Projekte zu besprechen, Modelle zu bauen und Grafiken zu überarbeiten. Auch heute werden wieder einige von ihnen die Nacht gemeinsam hier verbringen. Dabei werden ihre Nerven und Geduld auf eine harte Probe gestellt. Aus der Ferne erreicht mich gegen Mitternacht, als ich gerade schlafen gehen will, der erste Anruf von meiner Kommilitonin Theresa. Vor einigen Jahren habe ich sie bei einer Entwurfsarbeit in einem der Zeichensäle kennengelernt. Ich habe sie immer als einen sehr gelassenen Menschen wahrgenommen, umso kontrastierender nehme ich jetzt ihre spürbar angespannte Stimme wahr, mit der sie mir von den aktuellen Geschehnissen berichtet. „Der Moment, wo das erste Mal der Security gekommen ist und eben gemeint hat, wir können hier nicht sein und wir müssen gehen, […] waren wir alle so, ok ja f*ck, was sollen wir jetzt machen, ob wir gehen sollen?“ Das Auftreten des Sicherheitspersonals hatte erstmals den Gedanken ausgelöst, man mache etwas Verbotenes. Aber „durch diese erste Drohung, dass wir nicht da sein dürfen, wurde das Untereinander so richtig zusammengeschweißt. Sobald wir uns dazu entschieden hatten zu bleiben, war das eine Wendung, wo wir dann alle unseren Unmut, den wir vorher gehabt haben, ins Positive umgeschlagen haben“ fährt Theresa fort. Dies war einer von insgesamt fünf Anrufen, die ich diese Nacht aus dem Nelson’s erhalten würde. Nach Verneinung gegenüber den Securities – man wolle nicht gehen, weil man hier lediglich arbeite – wurden dann die Ausweise der Besetzer_innen verlangt. „Das war dann auch wieder ein ‚Downer‘, wo wir dann alle sehr unrund waren, was jetzt passiert“.
Bis vier Uhr morgens bekommen die Besetzer_innen Zeit, die Räumlichkeiten zu verlassen. An diesem Punkt droht die Stimmung zu kippen. Ist es überhaupt noch sinnvoll dazubleiben? Doch an der Entscheidung wird festgehalten: „Wir bleiben!“. Neben einer Petition für mehr Zeichensäle werden Banner und Poster erstellt, eine E-Mail-Adresse und eine Facebook-Seite eingerichtet. So vergehen die Stunden bis zum Morgengrauen wie im Flug. Schichtwechsel bei den Securities. „Sie sind dann gleich gekommen und waren relativ verständnisvoll und fragten, was wir denn wollen und was unsere Forderungen sind“, erzählt Theresa weiter. „Wenn wir etwas brauchen, dann können wir uns bei ihnen melden. Das war dann dieser Moment, wo die Stimmung in Euphorie umgeschlagen ist, weil dann hat das, was wir in fünf Stunden gemacht haben, schon etwas gebracht“.
Montag, 29. Oktober. Das Wichtigste ist geschafft. Jetzt, wo der reguläre Unibetrieb wieder losgeht, sind die jüngsten Ereignisse, welche sich über das Wochenende im Hof 2 abgespielt haben, kaum zu übersehen. Über den ganzen Tag hinweg bleibt der liebevoll getaufte „Zeichensaal Nelson’s“ randvoll. Neben etlichen Architekturstudierenden gesellen sich auch Studierende anderer Studienrichtungen hinzu. Da ist er, der interdisziplinäre Austausch. Eigentlich war während der „Besetzung vom Nelson’s tagsüber normaler Zeichensaalbetrieb“. Es wurde eingekauft und gekocht. „Einmal gab es einen sehr guten Eintopf, aber auch mal ein Curry und Nudeln gegen eine freie Spende“, erinnert sich Miriam, „das war eigentlich ganz nett, dieses Gemeinschaftliche“. Die räumlichen Gegebenheiten des Nelson’s, das Rücken an Rücken Sitzen und Hand in Hand Arbeiten stärken den Zusammenhalt und die wohltuende Beziehung untereinander. Im Nebenraum der Geruch von frisch gekochtem Chili.
Dienstag, 30. Oktober. Wie jeden Abend werden auch am Dienstag die Arbeitsplätze zu einem Sesselkreis umgebaut. Rund 40 Leute sind da, stehen teilweise bis in den Eingangsbereich, um Teil der Gruppe zu sein. Beim Plenum soll die weitere Vorgehensweise besprochen werden. Ich habe einen Platz auf der gepolsterten Holzbank ergattert und sitze Schulter an Schulter mit meinen Mitstudierenden. Es fühlt sich richtig an, hierfür einzustehen: „Zeichensäle sind kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit“, proklamiert Fedora, die sich für die Rechte und Interessen der Studierenden einsetzt. Weil eben nicht erwartet werden kann, dass jede_r Studierende „zu Hause im Schlafzimmer den Platz dazu hat, um an großformatigen Modellen oder in Gruppen zu arbeiten. Der Erfolg an der Uni darf nicht von der eigenen sozialen und finanziellen Situation abhängen“, betonen Philipp und Valerie mehrmals über die Tage hinweg. Um zwei Uhr nachts ist das Plenum vorbei. Meine Energie ist durch das Diskutieren in der Gruppe und durch das Formulieren von E-Mails aufgebraucht. Im Obergeschoss teile ich mir die Luftmatratze mit Philip. Er sieht geschafft aus von den letzten Tagen.
Mittwoch, 31. Oktober. Am Morgen bereue ich die Entscheidung, mir keine zweite Decke mitgenommen zu haben. Kühle Luft zieht durch den Raum, die Mauern sind kalt. Ungefähr acht Personen sind die Nacht über geblieben. Um Sieben in der Früh sind alle auf den Beinen. Was wir bis zu diesem Zeitpunkt schon alles erreicht haben, ist uns allen noch gar nicht bewusst. Stattdessen macht sich ein allgemeines Unwohlsein breit: Die Kommunikation, welche wir in den letzten Tagen mit dem Rektorat aufgebaut haben, scheint zu kippen. Das Ultimatum, welches uns gestellt wurde, macht uns allen sehr zu schaffen. Wir sollen die Räumlichkeiten heute bis zwölf Uhr verlassen, ansonsten gäbe es am kommenden Montag keine neuen Räume. Mehr Räume. Genau das wollen wir. Aber das Nelson’s aufgeben und dem Rektorat blind vertrauen?
Es ist kurz vor Zwölf. Ein letztes Mal noch treffen sich Sophie, Theresa und Philipp mit dem Vizerektor. Dann die Entscheidung: Wir gehen. Wir haben mediales Interesse erreicht und den Zuspruch auf Räume bekommen. Dennoch fühlt es sich nicht richtig an, sich zurückzuziehen. Zu dritt stehen wir noch ein Weilchen in der Türschwelle und schauen hinaus, bis uns das Sicherheitspersonal schließlich mit einer freundlichen Handbewegung zum Gehen auffordert. Wer in diesen fünf Tagen der Besetzung einmal einen Fuß in das Nelson‘s gesetzt hat, dem_der ist sicherlich aufgefallen, welch unglaublich schöner Ort der Zusammenkunft hier am Entstehen war. Neben den ganzen organisatorischen Fragen sind die sozialen Aspekte mindestens genauso detailliert behandelt worden und vor allem auch spürbar gewesen. Was ein Zeichensaal alles kann, sollte spätestens jetzt klar sein. Es ist ein bewegter Raum, der alles zulässt: verweilen, binden, aufstehen, genießen, vernetzen, erschaffen, aufbauen, begegnen, amüsieren, generieren, aufblühen, … Es ist ein Lebensraum für uns Architekturstudierende. Hier verbringen wir den Großteil unseres Studiums. Und wenn es sein muss auch in düsteren Hallen, trostlosen Kellern und versifften Hinterkammern.
Ersatzräumlichkeiten wurden uns bis Dezember zur Verfügung gestellt. Das Ende unseres Engagements bedeutet das allerdings nicht. Wir arbeiten auf jeden Fall weiter daran, die Platzsituation für uns Studierende zu verbessern. Wir lassen uns nicht aus unseren Unis verdrängen. Wir machen uns stark und gehen in die zweite Phase: die Mobilisierung aller Studierenden. Was wären die Universitäten ohne uns Studierende? Jetzt ist „das Ministerium gefragt, die gesetzliche Basis zu schaffen“ fordert Philip ein. Wir haben uns untereinander noch nie so verbunden gefühlt wie zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind das Zeichensaal-Kollektiv „Zeichensäle Nelson’s“.