Ich sag, ich sag, was du nicht sagst
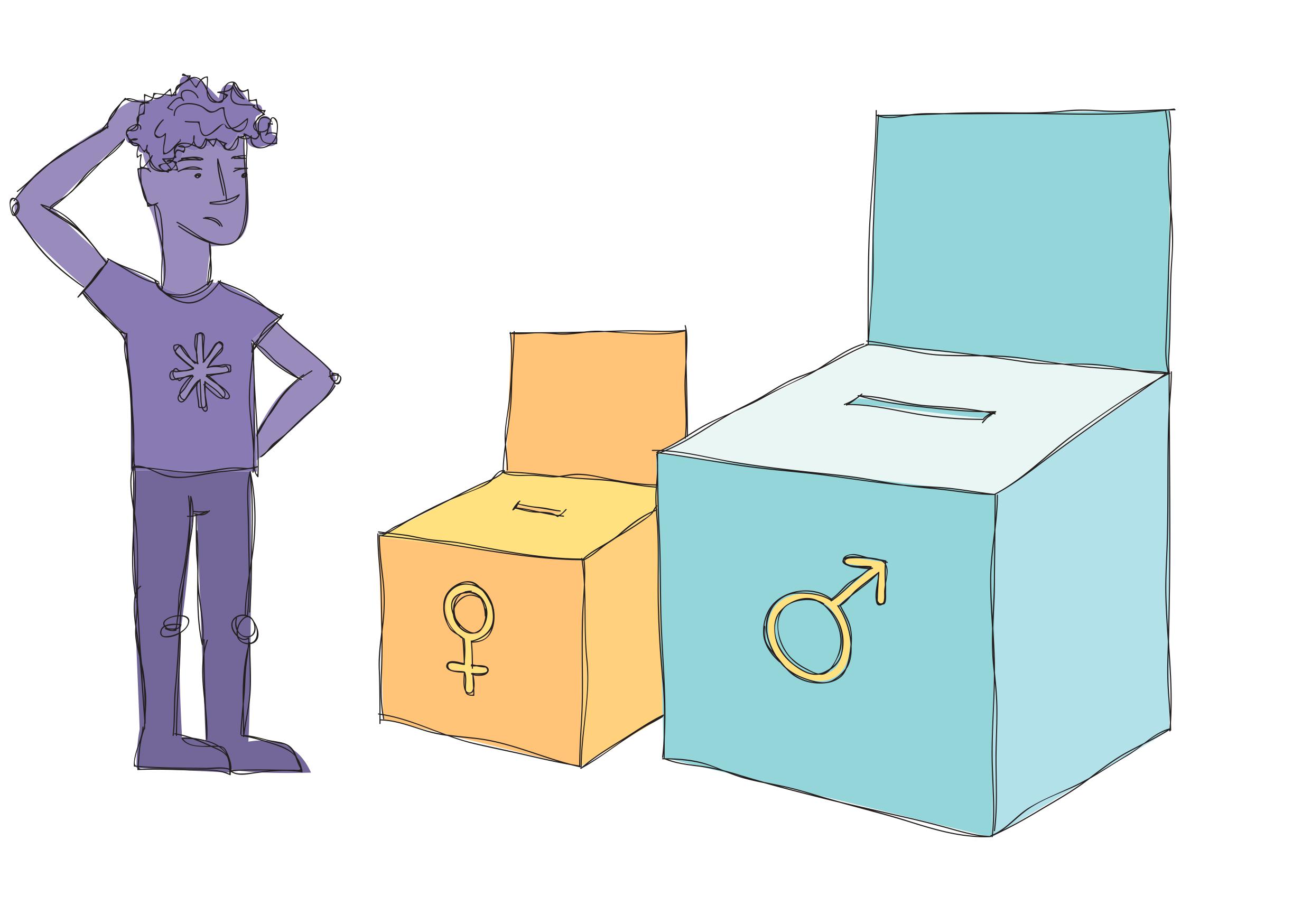
„Was man noch sagen darf“, titeln die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung. „Meinungsfreiheit“, schreibt sich der Spiegel groß aufs Cover und hebt dabei das Wort Unfreiheit graphisch heraus. Die Zeit stellt schon am Titelblatt den Grund für die Bedrohung fest: „63% der Deutschen glauben, man müsse sehr aufpassen, wenn man seine Meinung öffentlich äußert“. Anfang November wurde erneut eine Debatte rund um die vermeintlich bedrohte Meinungsfreiheit im Feuilleton – so nennt sich der Kulturteil anspruchsvoller Zeitungen - losgetreten. Die These lautet: Die knapper werdenden Grenzen des Sagbaren engen die Meinungsfreiheit immer weiter ein. Schuld seien im Prinzip die „politisch Korrekten“. Darunter verstanden werden hauptsächlich die politische Linke, die sogenannten Gutmenschen und vielleicht sogar am beliebtesten: die „menschenrechtsorientierten Hyperfeminist_innen“, wie es Falter-Chef Armin Thurnher so schön gesagt hat. So leicht ist das mit der Meinungsfreiheit dann aber doch nicht.
Das Dilemma der Meinungsfreiheit.
Diskurse sind im Grunde das, worüber in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Sie sind laut dem Diskursanalytiker Michel Foucault „als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen.“ Wer heute die öffentliche Diskussion verfolgt wird feststellen, dass die Meinungsfreiheit in Österreich nicht tatsächlich bedroht ist. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall: Etwa konnte man in den letzten beiden Nationalratswahlkämpfen gut beobachten, dass ursprünglich identitäre Begriffe wie „Bevölkerungsaustausch“ zuerst durch die provokante Verwendung der FPÖ und dann durch die Übernahme in die mediale Berichterstattung normalisiert wurden. Damit erstarken auch die rassistischen, sexistischen, homo- und transfeindlichen Stimmen in der Gesellschaft und erfahren immer weniger Gegenhall.
Parallel zu dieser Entwicklung wird es immer weniger gern gesehen, wenn sich Personen das Recht herausnehmen, mit diskriminierenden Stimmen nicht zu diskutieren. Nun gibt es diese zwei gegensätzlichen Auffassungen: Die einen sagen, Diskriminierung sei im Sinne der Gleichheit aller Menschen einfach nicht verhandelbar. Die anderen sagen, der freie Diskurs belebe doch die Demokratie und wer sich herausnimmt, nicht auch „konservative“ Anschauungen zu verhandeln, ersticke die Demokratie im Keim. Wobei es selten um konservative Werte in ihrem eigentlichen Sinne geht, sondern schlicht und einfach um die verbale Herabsetzung gesellschaftlich Benachteiligter. Ist es wirklich möglich, dass das Weglassen diskriminierender Sprache das pluralistische Meinungsspektrum der Gesellschaft einengt?
Ein aktueller Fall, in dem genau darüber gestritten wird, ist die Causa True Fruits. Der Smoothie-Hersteller True Fruits hat sich in der Vergangenheit, um seine Produkte zu verkaufen, legaler Weise immer wieder rassistischer und sexistischer Inhalte bedient. Aus dem Widerstand der Zivilgesellschaft entwickelte sich eine effektive und breitenwirksame Bewegung: Die Kampagne „True Diskriminierung“ initiierte offene Briefe an Handelspartner_innen von True Fruits und wurde von bekannten Stimmen unterstützt. Da sich der Safthersteller nicht einsichtig zeigt, ist das Ziel den Handel zu überzeugen, die Produkte aus dem Sortiment zu nehmen. Wirklich beeinträchtigende Folgen hatte das für die Firma True Fruits noch nicht. Vielmehr galt das Marketing als gelungen, denn die Aufmerksamkeit hatten sie. Eine Menge neuer Unterstützer_innen der eigenen Ansicht gab es auch, denn der Fall hat polarisiert. Das Dilemma, in dem man scheinbar zwischen zwei Grundsätzen wählen muss, trägt sich hier perfekt zur Schau: Meinungsfreiheit oder Minderheitenschutz. Dass etwa Drittfaktoren in der Debatte rund um die Meinungsfreiheit eine Rolle spielen oder überhaupt ganz andere Aspekte ausschlaggebend sind, wird kaum in Erwägung gezogen.
Deutungshoheit.
Die ganze Diskussion dreht sich bis hierhin rund um Sprache. Und Sprache ist immer auch mit Macht verbunden. Denn Macht strukturiert und legitimiert Diskurse, so definiert es zumindest Foucault. Kurz also: Jene, die über die Deutungshoheit verfügen, bestimmen auch die öffentliche Diskussion. Wer hat diese Aufgabe bei uns inne? Der Diskurs ist in Österreich liberal dominiert. Liberal klingt ja zu allererst einmal positiv: Im Idealfall ist liberaler Diskurs nämlich frei, gleich und aufgeschlossen. Mit der Macht kommt meist aber auch ein gewisser Hochmut, der die eigene Meinung über andere stellt. Sobald das passiert, soll eigentlich nur mehr die eigene Meinung durchgebracht werden. Konsens und Kompromissfindung passieren dann oft anhand von Diskreditierungen nicht übereinstimmender Parteien. In der demokratischen Praxis werden rechte Narrative immer stärker in den Mainstream gerückt, während die radikale Idee inklusiver Sprache mit dem Argument, dass sie die Meinungsfreiheit einschränke, herabgewürdigt wird. In ihrem Buch „Politik mit der Angst“ hat die Sprachsoziologin Ruth Wodak festgestellt, dass solche Vorwürfe schlicht Versuche sind, diskriminierende Sprache zu legitimieren. Sie erläutert das am Beispiel der FPÖ, die sich immer wieder auf die Meinungsfreiheit beruft. Sie schreibt, dass solche Äußerungen sofort den Bezugsrahmen verschieben und eine neue Debatte über Meinungsfreiheit und politische Korrektheit auslösen würden. Das diene der Ablenkung zum ursprünglichen Skandal. Diese ursprünglich rechtspopulistische Strategie eignet sich die liberale „Mitte“ (Stichwort: Feuilleton) immer öfter an. Könnte die Debatte über Meinungsfreiheit vielmehr eine Ablenkungsstrategie, ein Ringen um Deutungshoheit sein?
Feministische Erfolge.
Wer um Deutungshoheit ringt, sieht das Privileg, dass die eigene Meinung die entscheidende ist, bedroht. Aber wieso soll das gerade jetzt der Fall sein? Vielleicht liegt es daran, dass der Widerstand gegen die patriarchalen Narrative der liberalen Deutungshoheit effektiver wird. Vielleicht liegt es daran, dass feministische Bestreben immer öfter Erfolge verzeichnen. Zurück zum Fall True Fruits: Im Zuge der Debatte wurde der Geschäftsführer des Unternehmens Nic Lecloux auf eine Online-Marketing-Konferenz eingeladen, um über „erfolgreiches“ Marketing zu sprechen. Infolgedessen stellten sich einige österreichische Medien die Frage: Was darf Marketing überhaupt? Ein Medium, das sich dem annahm, war die Wienerin: In einer Podcast-Folge erörtert Redakteurin Magdalena Pötsch gemeinsam mit Vertreter_innen des Werberates und der Initiative „True Diskriminierung“, wieso Marketing nicht alles darf. Dabei wird auch diskutiert, ob es sinnvoll ist, dem Geschäftsführer durch die öffentliche Kritik eine Spielfläche zu geben, um seine diskriminierenden Marketing-Strategien zu verbreiten. Die Aufmerksamkeit und Zustimmung, die der Podcast bekam, hatten die Ausladung von Nic Lecloux zufolge.
Es steht also 1:0 für den Feminismus. Sind solche kleinen Erfolge Grund genug für die Definitionsmächtigen, um ihre Privilegien zu bangen?
Offensichtlich. Nicht selten kommt es vor, dass feministische Stimmen diskreditiert werden, es sind vor allem kritische Autorinnen und Journalistinnen, die als Bedrohung wahrgenommen werden. Sie sind es nämlich, die erste Schritte gehen und anderen Frauen die Türen öffnen, indem sie ungleiche Verhältnisse sichtbar machen, wie Wienerin-Redakteurin Pötsch das tut: „Wir sehen es als unsere Aufgabe, auf Missstände hinzuweisen und über Formen von Diskriminierung aufzuklären“. Dass man als Frau mit kritischer Haltung oft auf Widerstand stößt, schildert die Journalistin so: „Was auffällt, ist, dass inhaltliche Kritik nicht selten auf eine persönliche und emotionale Ebene gehoben wird, sprich: Wir als Medium üben auf inhaltlicher Ebene Kritik, versuchen für Leser_innen nachvollziehbar strukturelle Probleme runterzubrechen - die Reaktion passiert dann hingegen oftmals auf persönlicher Ebene. Und das, obwohl in den meisten Fällen nicht einzelne Menschen per se angeprangert werden, sondern ungleich zugeschriebene Privilegien.“ Vielleicht ist es aber gar nicht so wichtig, darüber zu reden, wer wem Übel will – denn so verfällt man selbst leicht den rechten Empörungsstrategien. Wichtiger ist anzuerkennen, dass die Diskussion um Meinungsfreiheit nichtig ist, wenn sie nur von einer Seite geführt wird.
Demokratie.
Was hat es nun mit dieser Demokratie auf sich, um die wir uns angeblich sorgen müssen? Nun ja: Seitens der liberalen Deutungshoheit hätte die politisch korrekte Sprache auch Einschnitte in die Demokratie zufolge. Das ist irgendwo natürlich auch ein Widerspruch in sich: Sie sagen, Demokratie lebe von Diskussion. Aber kritische Stimmen sollten sich dennoch nicht allzu viel Gehör verschaffen dürfen. Es scheint, als wäre viel weniger die politische Korrektheit repressiv, sondern die strategisch angelegten Versuche des konservativen Mainstreams, differenzierte Gegenstimmen zu entmachten.
Wirklich demokratische Debatte sieht anders aus als der liberale Diskurs, der von wenigen Privilegierten geführt wird. Folgt man der Idee einer radikalen und pluralen Demokratie, ist demokratischer Diskurs ebenso radikal, offen und pluralistisch. Verkürzt heißt das eigentlich, dass idealer Diskurs auch feministisch ist. Und das fängt bei der Sprache an: Ungleichheit und Diskriminierung wird maßgeblich durch unsere Kultur, also auch durch Diskurs reproduziert. Um Chancengleichheit zu garantieren, muss man einen gesellschaftlichen Rahmen schaffen, in dem alle zu Wort kommen dürfen. Einen Raum, in dem man sich auf Augenhöhe und mit Haltung gegenübertritt und Diffamierung und Diskreditierung nicht einmal zur Option stehen. Damit das mit der Meinungsfreiheit auch wirklich gelingt, ist wichtig zu erkennen, welche Strukturen hinter der Diskursstrategie stecken.
Idealer Diskurs.
Meinungsfreiheit klingt so selbstverständlich. Aber mittlerweile ist sie so selbstverständlich geworden, dass selten differenziert wird: Handelt es sich um relevante Argumente? Oder werden kritische Stimmen mit irrationalen Vorwürfen der „Sprechverbote“ abgewürgt? Es ist so, dass diskriminierende Äußerungen sich oft unter den Deckmantel der Meinungsfreiheit stellen. Durch das Infragestellen dieses Verständnisses von Meinungsfreiheit könnte im Sinne eines inklusiven Feminismus die Chance ergriffen werden, einen Raum zu schaffen, indem jede_r mitreden darf, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sexueller Orientierung. Das steht ganz im Sinne der Demokratie und ihrer egalitären Grundwerte. Somit wird ganz schnell erkenntlich werden, dass Meinungsfreiheit und offener Diskurs auch ohne jegliche Diskriminierung gehen.




