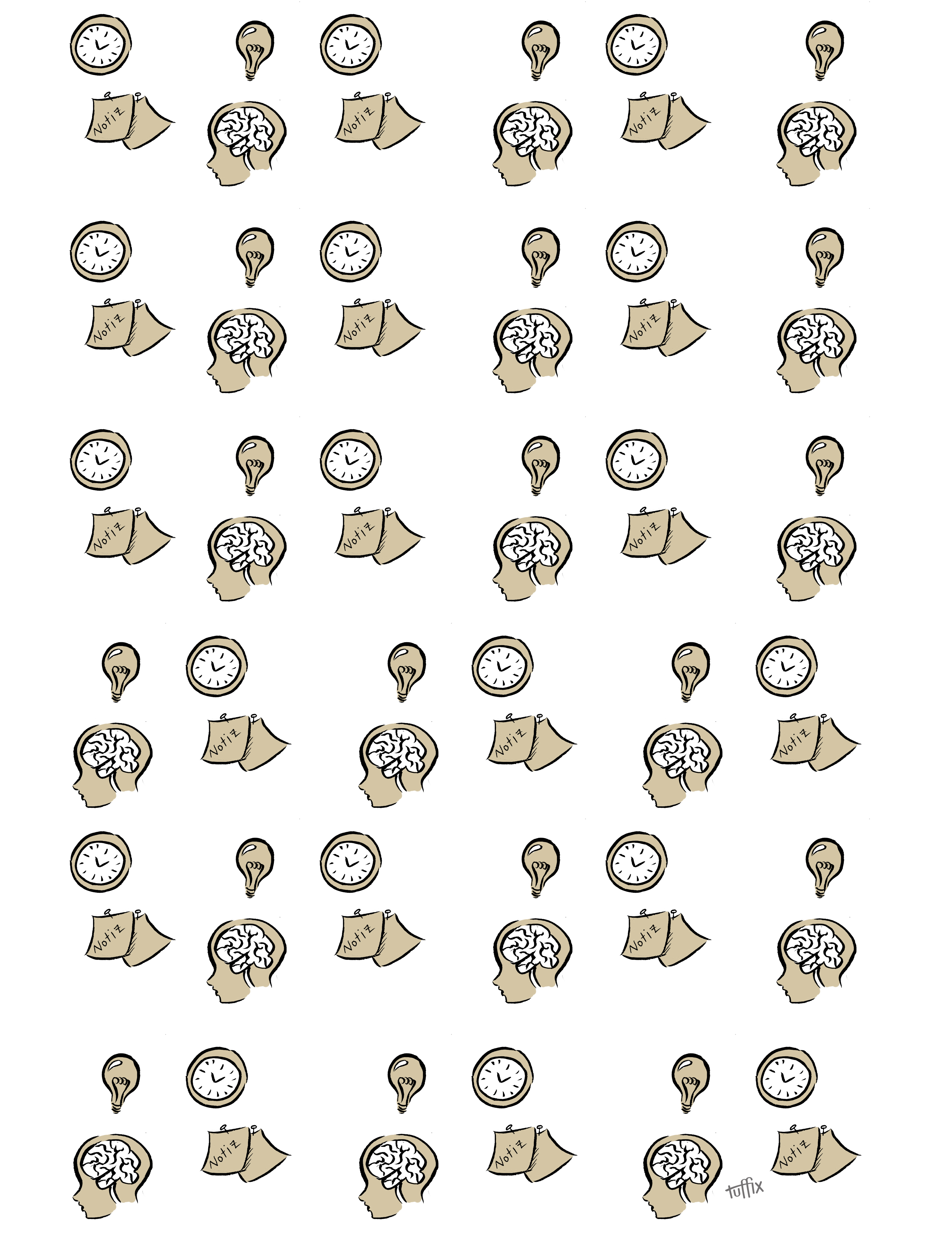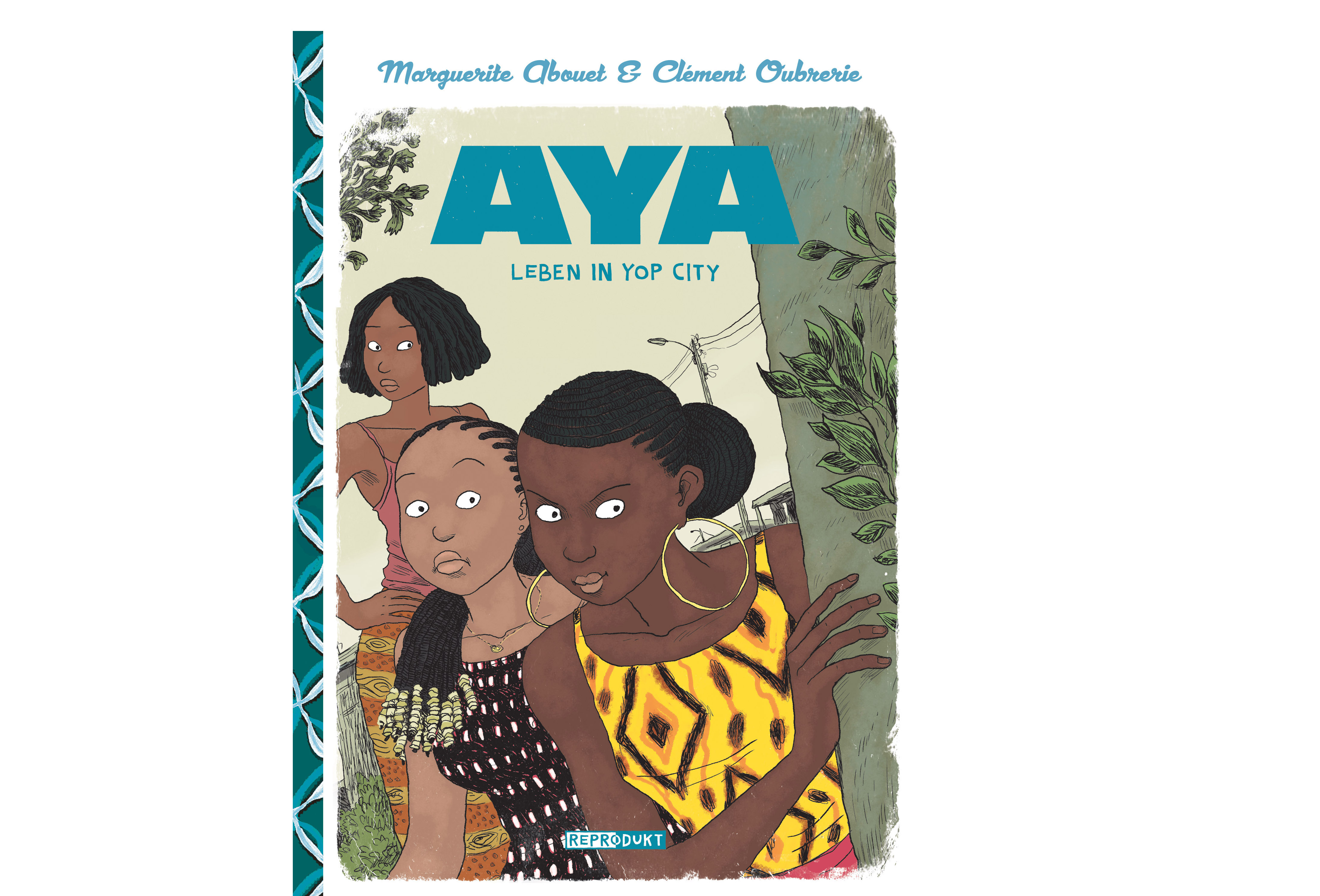Studieren ohne doppelten Boden
Für Menschen, die während des Studiums nicht auf familiären Rückhalt zählen können, ist der Weg durch die Uni besonders hürdenreich.

Für Menschen, die während des Studiums nicht auf familiären Rückhalt zählen können, ist der Weg durch die Uni besonders hürdenreich.
Sogenannte „Care Leaver“ sind Menschen, die die stationäre Jugendhilfe oder eine Pflegefamilie verlassen haben und meist im Alter von 18 Jahren selbständig ihr Leben bewältigen müssen. Also: ehemalige Heimkinder, ehemalige Pflegekinder und solche, die im Betreuten Wohnen unterkamen. Care Leaver sind in unserer Gesellschaft mit Problemen konfrontiert, die bisher wenig Aufmerksamkeit bekommen. Viele von ihnen kommen aus zerrütteten Familienverhältnissen. Umso mehr benötigen sie deshalb die Versicherung, dass sie Verlusterfahrungen und Existenzängste nicht erneut durchleben müssen. Das abrupte Ende der Jugendhilfe bei Erreichen der Volljährigkeit führt allerdings oft genau dazu. Denn während im europäischen Durchschnitt die meisten jungen Erwachsenen bis 25, wenn nicht bis 27 Jahre, bei ihren Eltern wohnen bleiben – in Österreich sind es durchschnittlich 24,6 Jahre – und so nach und nach in die Selbstständigkeit hineinwachsen können, endet für einen Großteil der Care Leaver die Versorgung durch die Jugendhilfe bereits an ihrem 18. Geburtstag.
JUGEND DER ARMUT. Die Jahre zwischen 18 und 25 werden in der Pädagogik nicht umsonst nicht mehr als bloße Verlängerung der Jugend erachtet, sondern vielmehr als eine Lebensphase, die für sich steht: die der „jungen Erwachsenen“, auch als „Emerging Adulthood“ bezeichnet. Diese Lebensphase spielt sich nicht außerhalb sozioökonomischer Kontexte ab, sondern bettet sich in eine Realität der steigenden Jugendarmut ein. Zu diesem Schluss kam die in Deutschland ansässige Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ). 20- bis 25-jährige gehören heutzutage zu den ärmsten Altersgruppen. Viele von ihnen leben aus diesem Grund noch bei den Eltern. Sie haben Jobs, die nicht in dauerhafte Anstellungen münden, beispielsweise in Leiharbeitsverhältnissen. Care Leaver trifft das besonders hart, weil sie sich der prekären Situation junger Erwachsener ohne familiären Rückhalt stellen müssen. Die Gefahr von Arbeits- und Wohnungslosigkeit ist für sie besonders hoch, die Bildungsaussichten sind gering. In Deutschland erreicht nur ein Prozent der Care Leaver den Hochschulsektor. Fehlende Ressourcen und fehlende persönliche Betreuung durchvertraute Ansprechpartner*innen sind dabei zentrale Hindernisse.
Wie die Internationale Arbeitsgemeinschaft für Jugendfragen (IAGJ) beschreibt, wurden Ende 2013 in Österreich 11.913 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Kinder- und Jugendhilfe stationär betreut, 1.066 von ihnen waren im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Zu den Hauptgründen der Unterbringung zählen die Gefährdung des Kindeswohls im Elternhaus sowie die dort fehlende Erziehungskompetenz. Die Jugendhilfe wird nur in Ausnahmefällen bis zum 21. Geburtstag verlängert und die betroffene Person muss auf jeden Fall zustimmen. In manchen Fällen sind es auch das Jugendamt oder andere Organisationen, die bestimmte junge Erwachsene nicht weiter betreuen wollen.
Während es in England und Australien bereits Möglichkeiten der Vernetzung für Care Leaver gibt, ist in Österreich bisher noch kaum etwas zu dem Thema zu hören. In Deutschland hat sich an der Universität Hildesheim eine Forschungsgruppe gebildet, die Angebote für studierende Care Leaver untersucht. Aus dieser Arbeit entwickelte sich auch ein Netzwerk für betroffene Care Leaver, die studieren. Sie organisieren gemeinsame Treffen und sind online auf Facebook und in einem eigenen Forum zu finden. Kürzlich haben sie auch einen Verein gegründet: Careleaver e.V.
EMOTIONALE VERSORGUNG. Die Hürden, die ehemalige Heim- und Pflegekinder auf dem Weg zum Studium überwinden müssen, sind besonders hoch, denn vor dem Studium müssen einige grundlegende Fragen wie die Finanzierung oder die Wohnsituation geklärt werden.
Studierende mit Familie haben oft die Option, bei der Familie wohnen zu bleiben, wenn sie in der Nähe studieren. Sie sparen damit einen Teil der Lebenshaltungskosten und bleiben zugleich in einer ihnen vertrauten Umgebung. Dadurch erleben sie nicht das entwurzelnde Moment, gleich mehrere lebensumwälzende Veränderungen auf einmal zudurchlaufen. Sollte es nach Studienbeginn doch noch zu dem Umzugswunsch kommen, können junge Menschen mit familiärem Rückhalt in aller Ruhe nach einem Zimmer Ausschau halten, ohne Angst haben zu müssen, auf der Straße zu landen. Bei der WG- oder Wohnungssuche sind die finanziellen Mittel die schwerwiegendsten Hindernisse: Viele Vermieter*innen fordern eine Kaution, die in Österreich drei Mal die Höhe der Monatsmiete betragen kann. Ein weiteres Fallbeil sind die Bürgschaften: Viele Eltern versichern, dass sie die Miete zahlen, sollte es einen finanziellen Ausfall von Seiten ihres Kindes geben. Care Leaver, die ihre Situation erklären, werden hingegen oft mit einem „Pech gehabt“ abgefertigt. Damit fallen viele Wohnmöglichkeiten weg. Oftmals bleibt nichts anderes übrig, als eine Untermiete einzugehen, was die meisten Care Leaver aber immer in größere Abhängigkeit zu den Hauptmieter*innen stellt.
Sollten sie umziehen, bekommen viele Studierende meist Unterstützung von der Familie: vom Ausdiskutieren, ob die Wohnung mit Schimmelbefall lieber links liegen gelassen und doch lieber das Studierendenwohnheim bevorzugt wird bis hin zur Besorgung des Umzugswagens. Die Tücken des Mietvertrags können in der Familie durchdiskutiert werden. Auch das soziale Netz ist meistens größer und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass immer irgendwer jemanden kennt, der*die gerade eine Wohnung verlässt oder ein Zimmer anbietet. Auch besteht die Möglichkeit, vertraute Gegenstände mitzunehmen, was wiederum kostensparend sein kann: Viele Care Leaver müssen sich von Grund auf neu einrichten und gleichzeitig vieles im Heim zurücklassen, was ihnen lieb geworden ist.
STUDIENBEIHILFE? NUR MIT ELTERN. Auch die Beantragung der Studienbeihilfe kann zum großen Problem werden. Für die Ausfüllung der Dokumente benötigt es nämlich weiterhin die Eltern, zu denen viele Care Leaver keinen Kontakt haben und die sich sehr oft auch nicht verantwortlich sehen. Eine Ausnahme bildet das Selbsterhalter*innenstipendium: Es gilt für alle, die durchgehend vier Jahre vor Studiumsbeginn Lohn bezogen haben. Für die anderen bedeutet das: Wenn bis zum 18. Geburtstag die Jugendhilfe zuständig war und dann plötzlich trotz Volljährigkeit wieder die häufig entfremdeten Eltern angeschrieben werden müssen, geschieht es nicht selten, dass Care Leaver monatelang auf Antworten warten müssen, weil die Ursprungsfamilie entweder überfordert ist oder ihrer Verantwortung einfach nicht nachgehen will oder kann. Es ist nicht klar, wie mit solchen Fällen umgegangen wird. Oftmals kommt es dabei auf die Nachsicht oder auch Willkür einzelner Beamt*innen an, die mit solchen Fällen konfrontiert werden. Nichtsdestotrotz führt so eine Situation fast immer mindestens zu einer verzögerten Auszahlung der Studienbeihilfe, was für die betroffenen Care Leaver oft Schulden und in einigen Fällen auch den Verlust ihres Wohnsitzes bedeutet.
Menschen, die eine Familie haben, erleben oft Rückhalt, sollte etwas nicht ganz nach Plan verlaufen. Sei es für ein Wochenende, an dem eins sich wieder bei Mama und Papa beziehungsweise Mama und Mama oder Papa und Papa einfindet und beim gemeinsamen Brunch mit ihnen über nervende Vermieter*innen klagt, sich mit ihnen gemeinsam über die viel zu hohen Heizungskosten wundert oder einfach nur mal anruft. Selbst wenn das Verhältnis nicht zum Besten steht, ein Bett oder ein warmes Abendessen helfen schon über manche Hürde. Care Leaver haben diesen „doppelten Boden“ in vielen Fällen nicht.
STIGMA UND AUFSTEIGER*INNENMYTHOS. Care Leaver müssen mit unterschiedlichen Dynamiken kämpfen: einerseits die eigene Biografie, in der physische und emotionale Gewalt und Vernachlässigung oft eine Rolle spielen. Dafür benötigen sie Unterstützung durch Beratung und/oder therapeutische Behandlung, die auf ihre Verhältnisse abgestimmt sein müssen und sie dort abholen, wo sie stehen. Anderseits erleben sie Stigmatisierung aufgrund ihrer Vergangenheit als Heimkinder oder Pflegekinder. Diese führt nicht selten bereits in der Schule zu Mobbing- und Ausschlusserfahrungen. Care Leaver sind dadurch in Gefahr, erneut in manipulative und emotional gewaltvolle Beziehungen zu Menschenzu geraten. Manche verheimlichen ihre Vergangenheit, um solche Situationen zu verhindern. Das führt allerdings nicht selten zu Isolation und erschwert die Anbindung an andere Menschen.
Gerade auch in der Umgebung der Hochschule, wo ein Großteil der Leute aus Akademiker*innenfamilien stammt und sich mit großer Selbstverständlichkeit dort bewegt, weil bereits die eigenen Eltern die Umgangsformen dieses Milieus verinnerlicht haben, erleben Care Leaver ähnliche Ausschlüsse wie etwa Studierende aus der Arbeiter*innenklasse. Die Kehrseite dieser Ausschlüsse ist die Romantisierung einer solchen Vergangenheit, gerade auch im Hochschulsektor. Care Leaver, die „es geschafft haben“, die „es allen gezeigt haben“, müssen als Beispiele für den Aufstiegstraum herhalten. Das vermittelt die Idee, dass der Wert eines Menschen daran gebunden ist, ob er*sie den sozialen Aufstieg geschafft hat. Eine solche Perspektive individualisiert soziale Probleme und überlässt dem*der Einzelnen die Mehr-Arbeit, die eigentlich auf strukturelle Probleme innerhalb einer Gesellschaft zurückzuführen sind, mit denen wir niemanden alleine lassen sollten.
Care Leaver benötigen ausreichende Beratung für die Zeit nach der Jugendhilfe, persönliche Betreuung durch Menschen, die sie selbst auswählen können und die ein fester Bezugspunkt bleiben in den ganzen umwälzenden Ereignissen im Leben der jungen Erwachsenen. Sie brauchen klare Bedingungen, die die Schwierigkeiten ihrer Situation anerkennen, in den Behörden, Ämtern und gerade auch an den Hochschulen. Und darüber hinaus brauchen sie das Zugeständnis, wie alle anderen jungen Erwachsenen Fehler machen zu dürfen, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen.
Tuba Alacalı studiert Latein und Bibliotheks- und Informationswissenschaften in Berlin.