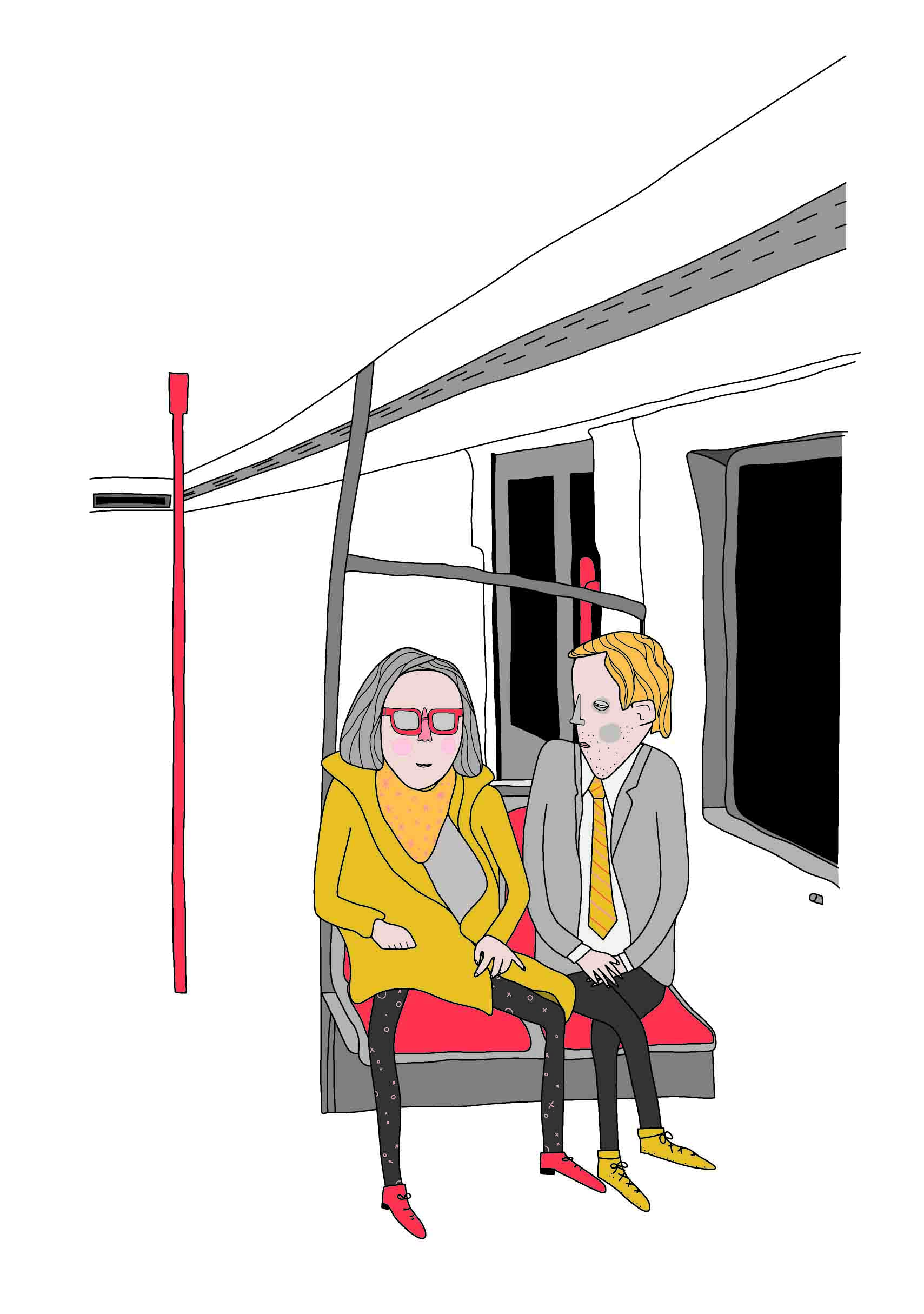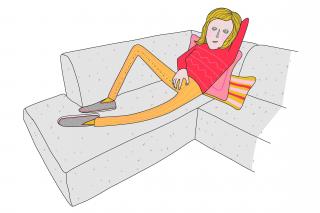In der täglichen Arbeit, aber auch schon während des Studiums wollen sich angehende und fertig ausgebildete SozialarbeiterInnen einen kritischen Zugang zu ihrer Arbeit bewahren. Das ist in der Praxis nicht immer einfach.
In der Zahnarztpraxis im neunerhaus im fünften Wiener Gemeindebezirk sitzen heute drei Personen im Wartezimmer. Aus dem Raum nebenan hört man das leise Rascheln eines Saugers, der wohl einem der beiden die Zahnbehandlung ausharrenden Patienten aus dem Mundwinkel hängt. Auch als die Tür aufgeht und sich eine grüngewandete Assistentin Unterlagen vom Empfang holt, unterscheidet sich weder der etwas angespannte Gesichtsausdruck des Patienten, an dem auf dem Stuhl gerade gewerkt wird, noch der leichte und doch eindringliche Geruch nach Desinfektionsmittel, der aus dem Behandlungsraum strömt, vom typischen, erwartbaren Szenario. Und doch ist es hier anders. Heute im Speziellen: „Es ist ein ganz ruhiger Tag“, sagt die Frau am Empfang, Susanne Schremser. Meistens sei das Wartezimmer voll, manchmal sogar überfüllt.
Aber auch generell: In der Praxis werden obdachund wohnungslose Menschen kostenlos versorgt – und zwar von ehrenamtlich tätigen ZahnärztInnen. Auch Schremsers Arbeit unterscheidet sich von jener am Empfangstresen in anderen Praxen. Hier geht es nicht nur um Terminvereinbarungen, e-Card oder Sozialversicherungsdaten. Letztere spielen überhaupt keine so große Rolle, weil hier Menschen mit, aber auch Menschen ohne Versicherung behandelt werden. Die 43jährige Susanne Schremser ist hier als Sozialarbeiterin tätig, bis zum kommenden Juni noch in berufsbegleitender Ausbildung – mit einem kritischen Ansatz. Das bedeutet hier in der Praxis: Sie ist nicht nur erste Ansprechpartnerin und versucht, den Leuten die Angst vor der Behandlung zu nehmen. Sie nimmt sich – falls gewünscht – Zeit für längere Gespräche: „Viele haben sehr schlechte Erfahrungen mit dem regulären Gesundheitswesen gemacht“, sagtSchremser. Oft geht es deshalb darum, dass KlientInnen überhaupt erst wieder Vertrauen zu ÄrztInnen und ins System gewinnen, um solche Leistungen wieder in Anspruch nehmen zu wollen. Bei der kritischen Sozialarbeit wird den KlientInnen nichts aufgedrängt. Man ist nicht verlängerter Arm des Staates. Die Entscheidung, wobei, inwieweit undwann Unterstützung benötigt wird, liegt bei den wohnungs- und obdachlosen Menschen selbst.
Niederschwellige Angebote. Schremser und ihre KollegInnen gehen während der Wartezeit direkt auf die PatientInnen zu. Sie klärt über rechtliche oder finanzielle Ansprüche auf, die jeder habe, aber von denen nicht jeder wisse – sofern das Gegenüber daran Interesse hat. Sie unterhält sich zum Beispiel mit Christian, der wegen eines ausgebrochenen Zahns in die Praxis gekommen ist. Angst hat er heute keine mehr, man hat ihm bereits angekündigt, dass bei der Behandlung an diesem Tag nichts Schmerzhaftes mehr ansteht. Bei Christian gehe es außerhalb der Zahnarztpraxis nun um die „aktive Jobsuche“, sagt er. Eine Gemeindewohnung hat er seit Kurzem. Die Zeit, als er im Männerwohnheim, später bei Freunden gewohnt hat, ist nun vorbei. Die PatientInnen können solche Gespräche aber auch ablehnen: „Ich sage eben, was ich kann, und wenn du willst, kann ich was für dich tun. Es geht auch ums Zuhören“, meint Schremser – wenn jemand aus der Vergangenheit erzählt, Ungewöhnliches, Normales, Lustiges oder auch von Depressionen. Wenn jemand will, vermittelt Schremser auch PsychologInnen. Das Du wird hier immer angeboten – und man kann auch das ablehnen. Es ist ein niederschwelliger Zugang: Kritische SozialarbeiterInnen bevormunden oder erziehen nicht. Im Gegenteil, sie versuchen Schwellen kleinzuhalten und Barrieren abzubauen – also den Zugang zu Leistungen zu erleichtern. Sie zeigen Möglichkeiten auf und unterstützen – falls notwendig.
Das sei bei allen Angeboten des neunerhauses so, erklärt Elisabeth Hammer, die fachliche Leiterin der sozialen Arbeit: in den drei Häusern mit Wohneinheiten für 250 Menschen, in den zehn betreuten Startwohnungen, bei der tiermedizinischen Versorgung genauso wie in der Zahnarzt- und der Arztpraxis. Insgesamt arbeiten rund 60 Personen im neunerhaus. Sie werden von etwa 70 Ehrenamtlichen und mehreren Zivildienern unterstützt. Die Grundsätze einer kritischen sozialen Arbeit fließen überall mit ein. „Es geht dabei um die Grundhaltung gegenüber den Klienten und Klientinnen“, erklärt Hammer, die sich neben ihrer Arbeit im neunerhaus auch beim Verein Kritische Soziale Arbeit, kurz kriSo, engagiert: „Wir sehen unsere Gegenüber nicht als EmpfängerInnen von mildtätigen Leistungen, sondern als Menschen, die über ihre Lebensgestaltung autonom entscheiden.“ Ein Ziel oder ein allgemeingültiger Weg wird von kritischen SozialarbeiterInnen dabei bewusst nicht vorgegeben.
Normen durchbrechen. Die Entscheidungen der Menschen müssen nicht mit gesellschaftlichen Normen konform gehen. Solche Normen seien schließlich nicht naturwüchsig gegeben, sondern von Menschen gemacht. Die kritische Sozialarbeit und ihre KlientInnen dürfen, können und wollen sie verändern: „Wir erarbeiten mit den Wohnungslosen gemeinsam Perspektiven, damit sie ihre Kompetenzen dazu nutzen können, sich selbst Gehör zu verschaffen.“ Darüber hinaus seien die MitarbeiterInnen auch anwaltschaftlich tätig, damit die KlientInnen zu ihren Rechten kommen.
In der praktischen Arbeit gibt es dabei aber Grenzen. Diese werden durch den rechtlichen, finanziellen und bürokratischen Rahmen gesetzt. Beispielsweise erhalten nicht alle vom Staat die sozialen Leistungen, die sie brauchen würden. Neue EUBürgerInnen haben zum Beispiel keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Ein Teil der Arbeit besteht deshalb auch darin, diesen Rahmen, wo es möglich ist, zu erweitern und auf politische wie gesellschaftliche Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Auch die zeitlich und finanziell beschränkten Ressourcen setzen der kritischen Sozialarbeit Grenzen. „Gerade dann ist es wichtig, darauf zu achten, dass man ein Creaming the poor vermeidet“, meint Hammer. In der kritischen Sozialarbeit geht es nicht darum, den „Rahm“ mit einfacher zu betreuenden KlientInnen abzuschöpfen, um so rasche Erfolge oder eine sogenannte Resozialisierung möglichst Vieler feiern zu können. Die Mittel und die Arbeit der SozialarbeiterInnen sollen allen, die sich an das neunerhaus wenden, zugutekommen, auch Personen, die mehr und länger Unterstützung brauchen als andere.
Kritik beim Studieren. Von solchen Grundsätzen, aber auch von begrenzten Möglichkeiten in der Praxis hört man auch in der Ausbildung an den Fachhochschulen. Rica Ehrhardt und Franz Widhalm studieren Soziale Arbeit am Fachhochschul-Campus Wien im zehnten Bezirk. Sie sind zwei von insgesamt 120 in Vollzeit und 40 berufsbegleitend Studierenden, die erst im letzten Herbst begonnen haben. Ihr erstes Semester geht nun bald zu Ende, die letzte Prüfung haben sie bereits absolviert. Im Wintersemester steht nur noch das erste zweiwöchige Praktikum an. Ein Modul, das sie noch im Zuge ihres Studiums absolvieren werden, setzt sich explizit mit der Sozialen Arbeit in Zwangs- und Normierungskontexten auseinander. Ein kritischer Zugang zur Sozialarbeit spielt aber auch in vielen anderen Lehrveranstaltungen eine Rolle. Bis zum Abschluss mit einem Bachelor sind jedenfalls sechs Semester Studium und 20 Wochen Lernen in der Praxis vorgesehen. Am Campus, auf dem es in der Mittagszeit von Studierenden, auch aus anderen Fachbereichen, nur so wuselt, erzählen Ehrhardt und Widhalm nun, wie der kritische Ansatz von Beginn an in die Ausbildung miteinfließt: „Die Vortragenden haben uns gleich in der Einführungswoche dazu aufgefordert, kritisch mit den Studieninhalten umzugehen und diese zu hinterfragen“, erklärt die 22jährige Ehrhardt.
Es ginge nicht nur um das Erlernen der Inhalte, unterstreicht auch Franz Widhalm und vergleicht das Studieren hier mit seiner Arbeit vor dem Studium, wo er die Produktion neuer Entwicklungen vorbereitet hat: „In der Industrie gibt es Hierarchien, die hin und wieder mit dem Gefälle zwischen Knecht und Herrscher vergleichbar sind.“ Er wurde wegrationalisiert, als ein Teil des Unternehmens in die Slowakei ausgelagert wurde. Er wollte beruflich aber ohnehin wechseln, „was Sinnvolleres machen“, sagt er. Beim Studium wird nun auf ein Miteinander-Arbeiten großen Wert gelegt. Die Vortragenden sind ein Teil des Teams, leiten an, erklären. Widhalm möchte das auch später in der Arbeit mit den KlientInnen ähnlich halten.
Selbstbestimmt statt kontrolliert. Bislang habe man sich vor allem mit den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit auseinandergesetzt. Dabei sei zum Beispiel auch das doppelte Mandat Thema gewesen. In vielen Bereichen wird von SozialarbeiterInnen verlangt, zugleich im Sinne des Staates und der KlientInnen zu handeln. Die SozialarbeiterInnen unterstützen dabei zwar, können und sollen zugleich aber auch Sanktionen setzen, wenn die betreuten Personen entweder gar nicht oder nicht in der Geschwindigkeit jenen Weg beschreiten, der ihnen vorgegeben wird. Auf die Arbeit mit Wohnungslosen umgemünzt könnte das zum Beispiel bedeuten, Druck auf die Menschen auszuüben, damit sie möglichst rasch wieder ohne Unterstützung auskommen und sich selbst eine Wohnung finanzieren. Ein doppeltes Mandat haben auch MitarbeiterInnen beim Jugendamt. Ähnlich wird oft mit Arbeitslosen in Beschäftigungsmaßnahmen verfahren. Unterstützung, Kontrolle und Sanktionen gehen dabei miteinander Hand in Hand.
Ehrhardt weiß bereits jetzt, dass sie nicht mit doppeltem Mandat arbeiten möchte: „Ich werde mir einen Bereich suchen, wo die Vorgaben nicht so strikt sind, oder wo man sie im Sinne der Klienten zumindest im eigenen Arbeitsfeld beeinflussen kann“, meint sie. Nach dem Wochenende geht es bei ihr zum Praktikum in ein Frauenhaus in Eisenstadt. Da heißt es bereits auf der Homepage: „Wir fördern die Selbstbestimmung und Eigenständigkeit der Frauen in der inhaltlichen sowie alltäglichen Arbeit mit den Bewohnerinnen.“ Ein Ansatz, der den Grundsätzen der kritischen Sozialarbeit entspricht: Es wird mit und nicht über den Kopf der Klientinnen hinweg gearbeitet. Wohin der Weg geht, entscheiden diese selbst. Die Mitarbeiterinnen unterstützen sie beim Erlangen ihrer Rechte nur da, wo diese auch tatsächlich Hilfe wollen und benötigen. Ehrhardt hat nun zwei Wochen Zeit herauszufinden, ob dieses Umfeld für ihren künftigen Berufsalltag möglicherweise das passende ist.