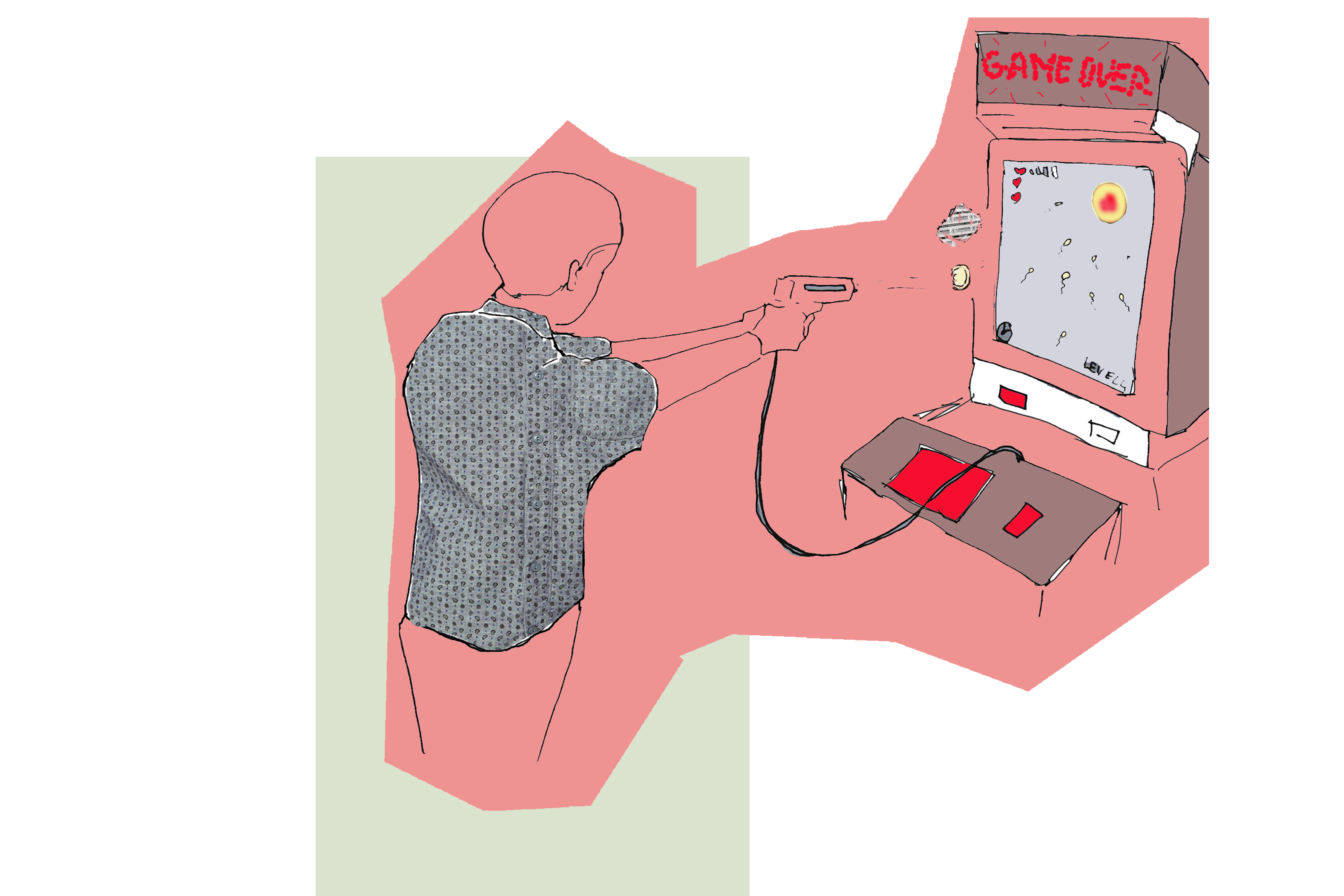Von fehlendem Halt zu Hass
Jugendliche ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz kämpfen mit einer unsicheren Zukunft. Vom Alltag frustriert, sind sie besonders empfänglich für Vorurteile.
Jugendliche ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz kämpfen mit einer unsicheren Zukunft. Vom Alltag frustriert, sind sie besonders empfänglich für Vorurteile.
Jugendliche provozieren mitunter gerne. Wenn es sich dabei um menschenfeindliche Äußerungen und Taten handelt, etwa im Kontext von rechtem oder islamistischem Gedankengut, stellt sich die Frage, wo die Wurzeln dafür liegen, und wie damit umgegangen werden kann. Das Phänomen lässt sich keineswegs nur auf Jugendliche beschränken. Trotzdem lohnt es sich, einen genauen Blick auf die Herausforderungen zu werfen, denen sich jene Menschen stellen müssen, die politische Bildungsarbeit und Sozialarbeit mit Jugendlichen leisten.
Nicht erfüllte Bedürfnisse. In den Räumlichkeiten des Vereins Backbone, der mobile Jugendarbeit im 20. Wiener Bezirk leistet, wird regelmäßig gemeinsam gekocht. In gemütlicher Atmosphäre reden die Jugendlichen mit den SozialarbeiterInnen darüber, was ihnen gerade durch den Kopf geht und was sie bewegt. Viele der jungen Menschen hier kommen aus ökonomisch und sozial benachteiligten Verhältnissen, manche befinden sich weder in Ausbildung noch in einem Arbeitsverhältnis. Bei Backbone wird ihnen nicht nur Unterstützung bei der Suche nach einer Lehrstelle oder beim Bewerbungsgespräch geboten, sie können auch in ihrer Freizeit die Räumlichkeiten nutzen. Die Jugendlichen können bei der Gestaltung des Freizeitangebots von Backbone mitreden, Regeln gibt es kaum. Dieser offene Zugang ermöglicht es den SozialarbeiterInnen, die Jugendlichen in all ihren Facetten kennen zu lernen.
Nicht selten übertragen die Jugendlichen den Frust, der sich aus ihrem Alltag ergibt, auf andere und greifen dabei auf Vorurteile, die sie entweder aus dem Elternhaus, den Medien oder von FreundInnen kennen, zurück. „Wir sind mit menschenfeindlichen Parolen, Ressentiments gegen verschiedene Minderheiten, Nationalismen in unterschiedlichster Ausformung und mit religiös-extremistischem Gedankengut konfrontiert“, erzählt Fabian Reicher, einer der Sozialarbeite rInnen bei Backbone. Die Gründe für solche Äußerungen und die Neigung mancher Jugendlicher zu diesen Weltbildern sind aus seiner Sicht vielfältig. Man dürfe nicht vergessen, dass die Jugend auch ohne zusätzlich erschwerte Umstände eine Phase des Experimentierens mit schnell wechselnden Einstellungen und Vorlieben ist. Die Zeit zwischen 12 und 15 Jahren sei oft wechselhaft, wie er am Beispiel eines Mädchens, das er schon länger kennt, illustriert: Bis vor einigen Monaten hatte sie oft ein T-Shirt der Band Frei.Wild, die dem Rechtsrock zuzuordnen ist, getragen und deren Musik gehört. Dann wiederum sah er sie vergangenes Frühjahr auf einer Demonstration gegen die rechte Gruppierung Die Identitären.
Im Klassenraum. Der Rechtsextremismus und Islamismus-Experte Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands, pflichtet dieser Einschätzung bei: „Wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, kann das zur Projektion etwa auf Juden, Muslime oder andere Gruppen führen. Je mehr man über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse weiß, desto geringer wird auch der Drang zur Projektion. Wenn Jugendliche in einem Milieu aufwachsen, das von physischer oder psychischer Gewalt geprägt ist oder in dem es kaum Anerken nung und Wertschätzung gibt, dann werden sie auch ein vergiftetes Selbstbild entwickeln.“ Peham ist seit 20 Jahren an österreichischen Schulen unterwegs, um Workshops zu Vorurteilen und Ressentiments zu halten. Diese Workshops sind Teil der politischen Bildung und sollen mitunter ein Beitrag zur Prävention sein. Für Peham liegt ein Problem darin, dass rechte Äußerungen oder Vorurteile oft nicht erkannt werden, etwa weil sie sehr indirekt oder undeutlich artikuliert werden. Aus seiner Erfahrung macht sich das vor allem unter jenen bemerkbar, die sich weiter oben in einer Bildungslauf bahn befinden und mit Rassismus oder Antisemitismus kokettieren. Dass LehrerInnen hier zu Sanktionen tendieren, liegt für Peham daran, dass ihnen schlicht die Zeit fehlt, um Vorurteile ausgiebig zu diskutieren. Die politische Bildungsarbeit kann hierfür Raum schaffen.
In seinen Workshops wird Peham mit unterschiedlichsten Vorurteilen konfrontiert. Aus seiner Erfahrung ist eines der häufigsten, dass alle AusländerInnen in der sozialen Hängematte liegen würden. Da solche Meinungen eben auch mit Emotionen verbunden sind, reicht es oft nicht, das nur faktisch zu widerlegen. Deshalb konfrontiert er die SchülerInnen auch mal mit unerwarteten Aussagen, wie: „Ich habe eigentlich selbst ein starkes Bedürfnis danach, versorgt zu werden.“ Das funktioniert zwar nicht immer, bringt manche aber dazu, sich dem Thema aus einer anderen Richtung zu nähern und so über die eigenen sozialen Verhältnisse anders nachzudenken. Dass in ein paar Stunden sämtliche Ressentiments, die mitunter bestehen, aufgelöst werden könnten, darüber macht sich Peham keine Illusionen. Er ist schon mit kleinen Erfolgen zufrieden. Besorgt zeigt er sich aber über eine Entwicklung, die er seit gut ei nem Jahr beobachtet: „Ein offensichtlicher Antisemitismus ist wieder bemerkbar, bis hin zu Mord und Vernichtungsphantasien.“
Begegnungen in Israel. Auch im Verein Backbone sehen sich die SozialarbeiterInnen immer wieder mit antisemitistischen Äußerungen jeglicher Art konfrontiert. Neben der alltäglichen Arbeit im Verein gibt es auch immer wieder Projekte, die es den Jugendlichen ermöglichen sollen, einen anderen Zugang zu sich und ihren eigenen Weltbildern zu bekommen. Im Herbst 2013 organisierte der Verein deshalb eine Reise nach Israel. Zwei Jugendliche sind mitgeflogen, deren Familien sich im Umfeld der Grauen Wölfe bewegen. Das ist eine rechtsradikale Gruppierung aus der Türkei, die auch antisemitische Positionen vertritt. Um sich auf die Reise nach Israel vorzubereiten, haben sich die beiden Jugendlichen einen Bart wachsen lassen, um sich abzugrenzen.
In Israel angekommen, haben sich die Erwartungen der beiden allerdings nicht bestätigt. „Zunächst waren sie überrascht über die Minarette, die sie dort gesehen haben. Auf der Straße sind sie außerdem laufend von Menschen gefragt worden, ob sie nicht mit ihnen gemeinsam beten wollen“, erzählt Reicher, der die Reise nicht nur mitorganisierte, sondern die Jugendlichen auch in Israel begleitete. So begannen die Jugendlichen bald festgefahrene Bilder neu zu überdenken. Es entwickelten sich auch Freundschaf ten. Dass sich durch die Reise bei den Jugendlichen etwas veränderte, steht für Reicher fest. Sie würden nun differenzierter mit vorgefertigten Ideen umgehen, die sie zuvor einfach übernommen hatten.
Jugendlichen unterschiedliche Blickwinkel aufzuzeigen, ist für den Sozialarbeiter eine weitreichende Aufgabe: „Von Jugendlichen wird erwartet, dass sie sich von menschenfeindlichem Gedankengut abgrenzen. In Wirklichkeit fehlt es den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, aber an den Voraussetzungen dafür, nämlich an Bildung. Sie können sehr schwer differenzieren.“ Deshalb ist es für ihn auch nicht verwunderlich, dass die Jugendlichen die häufig ebenso undifferenzierten Medienberichte sofort auf sich beziehen. Manchmal kommen Jugendliche wütend zu Backbone und ärgern sich über die Berichterstattung in einer der U-Bahn-Zeitungen, die sie zuvor gelesen haben, erzählt Reicher. Ein Jugendlicher sagte etwa zu ihm: „Wenn alle meinen, ich sei ein Terrorist, werde ich irgendwann wie ein Terrorist.“
Selbstwirksamkeit. Um diesem Ohnmachtsgefühl etwas entgegenzusetzen, haben Reicher und seine KollegInnen vergangen Sommer gemeinsam mit den Jugendlichen ein neues Projekt organisiert. Als im Frühjahr und Sommer 2014 die Konflikte im Nahen Osten wieder ein Thema wurden, bemerkten die SozialarbeiterInnen bei Backbone, wie sehr sich die Jugendlichen damit beschäftigten und dass daraus ein Gefühl der Lähmung erwuchs. Daraufhin entstand die Idee, ein Spendenprojekt zu organisieren und den Jugendlichen damit eine Möglichkeit zu geben, aktiv zu handeln. Gemeinsam mit den SozialarbeiterInnen produzierten die Jugendlichen Marmelade und Chili-Öl und verkauften diese. Ein Teil des Erlöses ging an das Internationale Rote Kreuz. Der andere Teil ging an das Projekt „Oase des Friedens“, ein Dorf nahe Tel Aviv, das gemeinsam von Muslimas und Muslimen sowie Juden und Jüdinnen aufgebaut wurde und sich als Teil der Friedensbewegung begreift. Für Fabian Reicher war diese Aktion ein voller Erfolg: „Die Jugendlichen konnten so Wertschätzung, Anerkennung und Selbstwirksamkeit erfahren. Das hat es wiederum ermöglicht, emotionalisierte Themen zu versachlichen.“
Georg Sattelberger studiert Internationale Entwicklung und Lehramt Geschichte und Englisch an der Uni Wien.