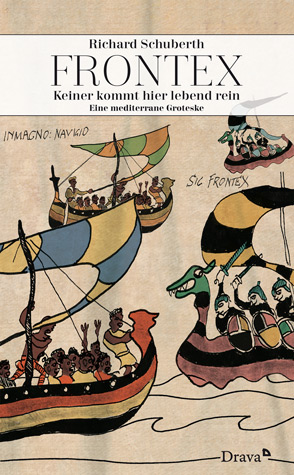Der Sexismus in und um Games eskaliert auf unterschiedlichen Ebenen und ist dabei erstaunlich facettenreich. Was stereotype Rollen und organisierte Hasskampagnen miteinander zu tun haben.
Weibliche Spielfiguren haben keine Rüstung, sondern Brüste. Sie haben keine Missionen, sondern Nöte. Sie haben keine Haupt-, sondern die Opferrolle. Sie erleben keine Abenteuer, sondern warten in Kerkern, Eisblöcken oder an Bahnschienen gekettet auf den Prinzen. Sie haben keine Laserschwerter oder Äxte, sondern Heiltränke oder Glaskugeln. Sie sind jemandes Frau, Tochter, Geliebte, Studentin oder Assistentin – nie eigenständig, nie selbst jemand. Sie haben keine eigene Biographie, keine intrinsische Motivation. Sie sind die Wurst-am-Stock für irgendeine grotesk überzeichnete Masse Männlichkeit.Sie gestalten keine Welten, sie flankieren und dekorieren. Sie haben keine speziellen Fähigkeiten, keinen mehrschichtigen Charakter, aber oft Angst oder Nervenzusammenbrüche. Sie retten nicht den Tag, vielleicht aber deine Seele, Ehre oder Potenz. Sie lösen Kriege aus, gewinnen aber keine. Sie sind magisch, aber nicht mächtig. Sie werden effektvoll entführt, geschlagen, gefoltert, vergewaltigt, getötet – für das Intro und die Heldeneinführung. Sie sind jung, schön, verträumt, ergeben, hetero und weiß.Große Game-Publisher wie Ubisoft behaupten schlicht, sie seien zu aufwändig zu animieren.
Auch männliche Figuren sind meist nach einem stereotypen Schema F gestaltet: Hypermaskuline Machomuskelmänner stützen das Narrativ vom kompetenten Typ auf Abenteuersuche. Drei Viertel aller Spielfiguren sind männlich, darunter finden sich unterkomplexe Charakterstudien wie der einsame Wolf, Held, Ritter, kleiner Junge auf Weltreise, der weiße Befreier oder Herrscher. Mindestens aber etwas in Richtung „generisches Arschloch in Uniform“. Gewalt ist Interaktions- und Kommunikationsmittel Nummer eins in Videospielen. Sie wird als „naturgegebener männlicher Anteil“ stilisiert, der Wagemut, Macht und Kompetenz untermauert. Misogyne Gewalt dient in den unterschiedlichsten Schattierungen vor allem der Storyline und sexualisierte Gewalt wird als erotisch dargestellt. Einvernehmlicher Sex auf der anderen Seite im europäischen und amerikanischen Raum weithin tabuisiert. Japan nimmt hier mit einem breiten Sortiment an pornographischen und Hentai-Spielen eine Sonderstellung ein. 2009 rügten die UN nach einem Medienaufruhr Japan für den Vertrieb von Vergewaltigungs-Simulatoren.
Ebenso wie „Killerspiele“ nicht unmittelbar Terrorist_innen hervorbringen, führt ein Spiel mit Frauen in Bikinis nicht automatisch zu mehr Übergriffen oder häuslicher Gewalt. Frauen als gesichtslose, durch Männer konsumierbare Objekte darzustellen, normalisiert jedoch Diskriminierung und Gewalt. Ganz sicher trägt die Objektifizierung jedenfalls nicht dazu, Frauen als gleichwertige Menschen zu betrachten oder grundsätzlich zu respektieren.
Kein Ort, nirgends. Weil auch Frauen Spaß daran haben, nach Feierabend zu metzeln, sieht eine Armee selbsternannter „Gamer“ sich in ihrem Territorium bedroht. Spielerinnen werden oft entweder als Anhängsel betrachtet oder direkt beschimpft. Auf fatuglyorslutty.com wurden Nachrichten gesammelt, die Spielerinnen in Spielen, auf Game-Plattformen und in Communitys erhalten. Sie werden darin als fett, hässlich oder nuttig bezeichnet, vielleicht auch unvermittelt zum Blasen aufgefordert – während sie eigentlich gerade einfach nur eine Quest bestehen wollten. „Tits or gtfo“ (get the fuck out) ist dabei der Evergreen unter den liebevollen Begrüßungsfloskeln. Auch das „Fake Geek Girl“-Mem ist von der Angst geprägt, die kleinere Schüssel Nachtisch zu erwischen und maßt sich an, Frauen mit Interesse an Nerddomänen pauschal sämtliche Expertise abzusprechen und ihnen Aufmerksamkeitsheischerei zu unterstellen.
Professionelle Spielerinnen müssen sich bei Turnieren härter bewerten und anfeinden lassen. Bei einer Promotion-Show für das Prügelspiel "Street Fighter X Tekken" fasste der Spieler und Teamleiter Aris Bakhtanians die Einstellung vieler zusammen: “This is a community that’s, you know, 15 or 20-years-old and the sexual harassment is part of a culture and if you remove that from the fighting game community, it’s not the fighting game community.” Ein „Hearthstone“-Turnier hat kürzlich ausschließlich männliche Teilnehmer zugelassen, mit der Begründung, eSport solle als klassischer Sport anerkannt werden. Dort werde schließlich auch die Trennung in „männlich“ und „weiblich“ vorgenommen.
Unternehmen schalten Stellenanzeigen für Entwicklerinnen, da sie „überzeugt sind, Frauen sind großartige Programmier (sic!). Frauen schreiben sexy Code: Ordentlich und sauber“, oder suchen ein „IT-Girl (Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung)“. Der Ruf nach mehr „weiblichen Fachkräften“ verhallt in der Ignoranz eines männlich dominierten Wirtschaftszweiges, in dem Ungleichbehandlung, Sexismen und Übergriffe am Arbeitsplatz geduldet sind. In der Spieleindustrie liegt der Frauenanteil bei 22 Prozent, Entwicklerinnen verdienen rund ein Viertel weniger als ihre Kollegen. Auf die Frage eines Kickstarter-Mitarbeiters hin, wieso es so wenig Spieleentwicklerinnen gäbe, sammelten 2012 tausende Frauen unter dem Hashtag #1reasonwhy erschreckende Eindrücke aus ihrem Arbeitsalltag in der Branche.
Auch auf Fachkonferenzen kommt es immer wieder zu Übergriffen, sexistischen Pointen in Vorträgen oder Belästigung. Das Geekfeminism-Wiki sammelt solche Vorfälle, die bis 1963 zurückgehen. Auf Messen im IT und Gaming-Bereich animieren „Boothbabes“, also Hostessen in Bikini oder knappen Kostümen eine Zielgruppe, die als „männlich und hetero“ festgeschrieben wird - unabhängig davon, wie divers sie längt ist. Solche Boothbabes sind nach Merkmalen wie Unterarmlänge, Oberschenkelumfang und selbstverständlich Körbchengröße aus einem Katalog wählbar. Das YouTube-Format „NosTeraFuTV“ der Game-Website Giga filmte so auch auf der Gamescom 2013 die Belästigung von Cosplayerinnen, Besucherinnen und Hostessen - zur Unterhaltung. In dieser feindlichen Atmosphäre sind Frauen nicht nur unterrepräsentiert, sondern wechseln auch wesentlich häufiger das Berufsfeld – laut einer Studie des National Center for Women & Information verlassen in den USA 56 Prozent der Frauen in ihren ersten zehn Berufsjahren den IT-Bereich für immer, obwohl 74 Prozent angeben, ihre Arbeit zu lieben.
Kübelweise Hass. Kontinuierlich und gezielt werden Entwicklerinnen, Journalistinnen und Spielerinnen angegriffen. Im August eskalierten die Hass-Postings unter dem Schlagwort „Gamer Gate“, zunächst waren sie gegen die Indie-Entwicklerin Zoë Quinn gerichtet. Bereits 2013 wurde sie zur Zielscheibe hasserfüllter Angreifer, weil ihre interaktive Geschichte „Depression Quest“ Aufmerksamkeit erhielt. Losgetreten wurde der neue Shitstorm durch den Blogpost eines Expartners. Quinns intime Beziehungen wurden an die Öffentlichkeit gezerrt. Als angebliche Intervention gegen Korruption im Gamejournalismus entstand eine Verschwörungstheorie, die unter anderem die Journalistinnen Mattie Brice und Jenn Frank dazu brachte, nicht länger über Spiele zu schreiben. Auch Anita Sarkeesian ist seit der Ankündigung ihrer Video-Reihe „Tropes vs. Women“ kontinuierlich Attacken ausgesetzt. Seit Jahren setzt sie sich in ihren Videos mit Sexismus und Popkultur auseinander, aber die Ankündigung, sich speziell mit Videospielen befassen zu wollen, ließ misogyne Online-Angriffe auf sie eskalieren, das so entstandene Spiel „Beat Up Anita Sarkeesian“ ist dabei nur eine von zahlreichen krassen Ausformungen. All diesen Frauen wird mit Gewalt, Folter, Vergewaltigung und Mord gedroht und private Informationen über sie werden veröffentlicht. Immer wieder müssen sie umziehen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen ändern. Das sind keine Einzelfälle und auch nicht bloß Ausfälle armer, einsamer Trolle. Es sind massive und organisierte Angriffe auf einflussreiche Frauen – mit dem Ziel, sie zu verdrängen, unsichtbar zu machen und ihre Stimmen zu ersticken. Die Dokumentation „GTFO“ widmet sich eindringlich 75 Minuten lang der ganzen Bandbreite des Harassment und und lässt Betroffene zu Wort kommen.
Schleifchen statt Substanz. Dennoch existiert eine zunehmend sichtbare Szene, die Diversity, die Wahl unterschiedlicher Geschlechtsidentitäten und die kritische Thematisierung von Diskriminierung zulässt und Geschichten erzählt, die mit den Normen der Videospielwelt brechen. Mattie Brices „Mainichi“ etwa erzählt von der Realität einer Trans*-Frau, das millionenfach verkaufte „Gone Home“ die Geschichte eines Teenager-Mädchens. Der „Consensual Torture Simulator“ setzt sich mit Konsens und Gewalt in Videospielen auseinander - in Spielform. Der großartige „Complete guide to gender design in games - Press X to make sandwich“ von Anjin Anhut liefert eine Anleitung für ein mehrschichtiges, sensibles Spieldesign ohne Sexismen. Gerade die Indie-Game-Szene zeigt auf, welche Möglichkeiten in diesem Medium stecken, das sich in den letzten 20 Jahren technisch immens, aber inhaltlich kaum weiterentwickelt hat.
Dieser Stillstand ist auch einem Marketing geschuldet, das seit den 1980er und -90er Jahren aggressiv auf eine junge, weiße, heterosexuelle, männliche Zielgruppe setzt, obwohl Studien seit Jahren zeigen, dass in allen gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen gespielt wird. Gerade Frauen verhelfen Spielen wie "Die Sims" zu ihren Erfolgen. Sogenannte „Casual Games“, wie „Angry Birds“ oder „Candy Crush“, die besonders bei einer weiblichen Zielgruppe gut ankommen, gelten automatisch als unechte, illegitime Videospiele.
Die Spiele „Mirror’s Edge“ oder „Remember Me“ stellen Women of Color in den Mittelpunkt. Im Sinne der Verwertungslogik hätten sie keine Daseinsberechtigung. Dass die Ursache für die Verkaufsergebnisse aber auch in festgefahrenen Marketingstrategien liegen könnte, wird ignoriert. Dass die Spielevermarktung auf eine junge, weiße, heterosexuelle, männliche Zielgruppe setzt, ist zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworden.
Das Medium Videospiel, die Industrie und ihre Anhänger spiegeln nicht nur einen gesellschaftlich verankerten Frauenhass und Sexismus wider, sie sind daran beteiligt, diesen fortzuschreiben. Frauen werden auf allen Ebenen bekämpft und kleingehalten. Als Charakter, Zielgruppe, Mitarbeiterin, Entwicklerin, Designerin, Gründerin, Kritikerin, Journalistin - und Spielerin.
Anne Pohl macht was mit Kommunikation, ist Gründerin von feminismus101.de und schreibt manchmal bei herzteile.org über digitale Spielkultur.
„No girls allowed“ – über Gendermarketing
„GTFO“ – Dokumentation über Harassment: www.gtfothemovie.com
„Gaming in Colour“ – Dokumentation über die queere gaming community: gamingincolor.vhx.tv
„Press X to make Sandwich“ – A complete guide to gender design in games: http://howtonotsuckatgamedesign.com/2014/05/press-x-make-sandwich-complete-guide-gender-design-games/