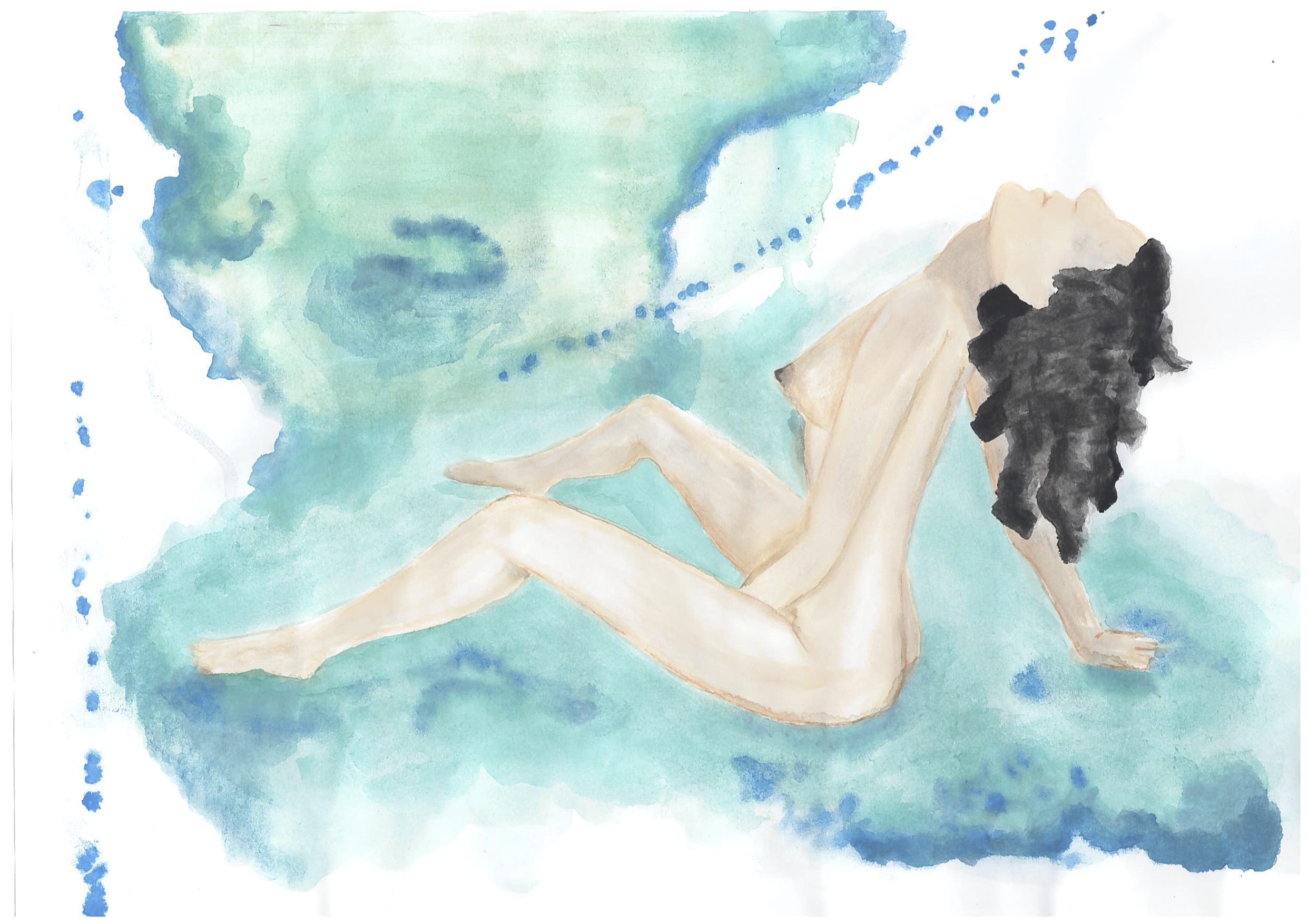„Unsere Zukunft ist so schwarz wie der Bildschirm“
Vor über einem Jahr wurde der staatliche griechische Rundfunk von einem Tag auf den anderen geschlossen - ein Novum in der Geschichte der EU. Was ist seitdem geschehen? Dieter Diskovic hat sich über die Hintergründe und Auswirkungen der Schließung, die Protestbewegung und die aktuelle griechische Medienlandschaft informiert.

Vor über einem Jahr wurde der staatliche griechische Rundfunk von einem Tag auf den anderen geschlossen - ein Novum in der Geschichte der EU. Was ist seitdem geschehen? Dieter Diskovic hat sich über die Hintergründe und Auswirkungen der Schließung, die Protestbewegung und die aktuelle griechische Medienlandschaft informiert.
11. Juni 2013. Die griechische Bevölkerung ist fassungslos: Soeben hat Regierungssprecher Simos Kedikoglou in einer Fernsehansprache angekündigt, den staatlichen Rundfunk ERT, das griechische Äquivalent zum ORF, innerhalb der nächsten Stunden zu schließen. Sofort strömen tausende wütende Bürger_innen zur Rundfunkstation in Athen, singen Widerstandslieder, versuchen diesen beispiellosen Akt der Regierung irgendwie zu verhindern. Ohne Erfolg: Um 23 Uhr wird das Signal gekappt, die Bildschirme werden schwarz.
„Wie in Zeiten der Militärdiktatur“
Die Mitarbeiter_innen, die dieses Vorgehen vollkommen unvorbereitet getroffen hat, geben jedoch nicht auf: Sie okkupieren die Rundfunkstationen, senden trotz Drohungen der Regierung weiterhin ein Notprogramm – erst über den Kanal der kommunistischen Partei, später mit Unterstützung der Europäischen Rundfunkunion.
In den nächsten Tagen formiert sich eine breite Protestbewegung: Neben einem Streik der Journalist_innen und einem 24-stündigen Generalstreik verurteilen die Generaldirektor_innen wichtigster europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten – u.a. ZDF, ARD, ORF und der Schweizer RTS – die Aktion als „undemokratisch und unprofessionell“. Um das nach wie vor besetzte Hauptgebäude von ERT finden zahlreiche Solidaritätskonzerte statt. Viele Menschen können es noch immer nicht glauben: „Es ist, als würden wir wieder die Zeit der Militärdiktatur erleben“, sagt eine Demonstrantin in einem Interview. „Unsere Zukunft ist so schwarz wie der Bildschirm.“ Andere erwarten einen baldigen Rückzieher der Regierung. Doch diese bleibt hart: Sämtliche 2.656 Mitarbeiter_innen von ERT werden entlassen. Gleichzeitig bedeutet dies das Ende von fünf Fernsehprogrammen, 29 nationalen und regionalen Radiostationen, einer Zeitschrift, einem Internetportal und drei der besten Orchester und Chöre des Landes.
Als der Oberste Gerichtshof die Schließung des öffentlichen Rundfunks für verfassungswidrig erklärt, zieht sich die Regierung mit einem Taschenspielertrick aus der Affäre: Ab Oktober werden aus einem angemieteten Studio unter dem Namen EDT (Hellenisches Öffentliches Fernsehen) nonstop alte Filme aus den 50er und 60er Jahren gezeigt, Nachrichtensendungen gibt es keine.
Die Schlachtung der heiligen Kuh
Die Schließung von ERT war ein Alleingang von Ministerpräsident Antonis Samaras und seiner rechtspopulistischen Nea Dimokratia. Nicht einmal die sozialdemokratischen Koalitionspartner waren informiert, die DIMAR (Demokratische Linke) verließ aus Protest gegen diese Vorgehensweise die Regierungskoalition. Regierungssprecher Simos Kedikoglou begründete die drastische Maßnahme mit der schlechten Führung und den hohen Kosten des Senders. Tatsächlich war ERT jedoch einer der wenigen öffentlichen Unternehmen, die Gewinne erwirtschafteten. Etwa 120 Millionen des Gewinns flossen jährlich in die Staatskasse, die Schließung des Senders brachte also keine finanziellen Vorteile. Die Regierung hatte sich jedoch gegenüber der Troika verpflichtet, weitere 2.000 Staatsbedienstete zu entlassen. Mit der Schließung von ERT konnte diese Vorgabe auf einen Schlag erfüllt werden, dem nächsten Hilfspaket stand nichts mehr im Weg.
Katerina Anastasiou, Aktivistin und Mitglied von Solidarity4all Vienna, sieht jedoch auch andere Motive: „Die Schließung hatte vor allem politische Hintergründe: ERT galt als linker Sender, war offen für Bewegungen von unten und sendete großartige, kritische Dokumentationen. ERT war eine heilige Kuh, und nach ihrer Schlachtung hatte die Regierung die Medien komplett unter ihrer Kontrolle.“ Schon vor der Schließung war ERT der Regierung ein Dorn im Auge: Während die privaten Sender weitgehend auf Regierungslinie waren, kritisierte ausgerechnet der öffentliche Rundfunk staatliche Austeritätspolitik, Misswirtschaft und Polizeigewalt. Noch im Jahr vor der Einstellung des Senders hatte man kritische Journalist_innen entlassen und durch Parteisoldat_innen in „Beraterpositionen“ mit teils exorbitanten Gehältern ersetzt.
Die Stürmung des „Widerstandszentrums“
7. November 2013: Spezialeinheiten der griechischen Polizei stürmen das Gebäude des ehemaligen Staatsrundfunks in Athen, das bereits seit fünf Monaten von Beschäftigten besetzt gehalten wird. Sämtliche Büros werden geräumt und etwa 200 Besetzer_innen auf die Straße gedrängt. Laut Regierungssprecher Simos Kedikoglou wurde die Räumung angeordnet, um Recht und Gesetz wiederherzustellen: „Sie hatten das Rundfunkgebäude in eine Art Widerstandszentrum gegen die Regierungsentscheidungen verwandelt".
ERT Open, wie sich der selbstverwaltete Sender der ehemaligen ERT-Mitarbeiter_innen nennt, sendet unterdessen von anderen Orten weiter. Anastasiou: „ERT Open ist besser als es ERT jemals war, das belegen auch die Zuschauerzahlen. Generell hat sich die Qualität seit der Selbstverwaltung enorm gesteigert. Die Ressourcen werden jedoch immer weniger, denn die Leute arbeiten ohne Gehalt. Trotzdem hat dieses Projekt Auswirkungen auf die gesamte griechische Medienlandschaft: Es entstehen neue selbstverwaltete und basisdemokratische Medienströmungen als Gegenpol zur Regierungspropaganda.“
NERIT - Der Sender, den keiner will
4. Mai 2014: Nachdem die Rundfunkeinrichtungen wieder in den Händen der Regierung sind, geht der neue, verschlankte staatliche Rundfunk Griechenlands, NERIT, erstmals auf Sendung. Katerina Anastasiou hält davon wenig: „Der neue Fernsehsender ist viel weniger kritisch und wurde dubios besetzt.“ Mit dieser Meinung steht sie nicht alleine da. Die größte Oppositionspartei Syriza erkennt NERIT nicht an, verweigert Interviews und jede Zusammenarbeit. Die Journalist_innen stehen nun vor der Wahl, ohne Maulkorb, aber mehr oder weniger unentgeltlich für ERT Open zu arbeiten, oder sich beim neuen Sender NERIT zu bewerben. Die meisten der Journalist_innen stehen inhaltlich ERT Open näher, für viele ist es jedoch eine Frage der finanziellen Machbarkeit. Während die Entschädigungen noch nicht voll ausgezahlt wurden, ist die einjährige Arbeitslosenhilfe bereits ausgelaufen. Die Journalist_innengewerkschaft unterstützt ERT Open mit Lebensmittelpaketen und Geldern aus Streikfonds. Auch viele einfache Bürger_innen, besonders in kleinen Städten, helfen ihren regionalen Sendern mit Geld und Sachspenden aus. Das ist besonders für die Motivation der Mitarbeiter_innen wichtig.
Am ersten Jahrestag der Schließung des öffentlichen Rundfunks kommt es in zahlreichen Städten Griechenlands, aber auch in anderen Ländern, zu den bislang letzten großen Demonstrationen gegen die Schließung von ERT. Während man in Athen vor dem Rundfunk-Hauptgebäude protestiert, gibt es auch im Wiener Resselpark einen Flashmob. Die Regierung soll daran erinnert werden, dass man noch lange nicht vergessen und schon gar nicht vergeben hat.
In der griechischen Medienlandschaft schaut es derweil nicht allzu rosig aus: Man hat nun einen relativ unkritischen staatlichen Sender, dem die Mehrheit der Bevölkerung misstraut, einige private Sender, die allesamt in der Hand der reichsten griechischen Familien sind und sich aus dem politischen Geschehen weitgehend raushalten, und selbstverwaltete Medien wie ERT Open, die kritisch und unabhängig, aber in einer finanziell äußerst prekären Lage sind. So gibt es für ERT Open drei mögliche Szenarien: die Auflösung aus Mangel an Ressourcen, die Umwandlung in einen kommerziellen Privatsender oder der Weiterbestand durch ausreichende lokale und internationale Unterstützung. Die Vorbehalte gegen den neuen staatlichen Sender NERIT haben sich derweil als begründet erwiesen: Im September traten der Direktor und sein Stellvertreter zurück. Regierungschef Samaras hatte interveniert, um die Übertragung einer Rede von Oppositionsführer Alexis Tsipras (Syriza) zu verhindern.
Dieter Diskovic studiert Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien und engagiert sich bei der Screaming Birds Aktionsgruppe.