Einfach zu brauchbar
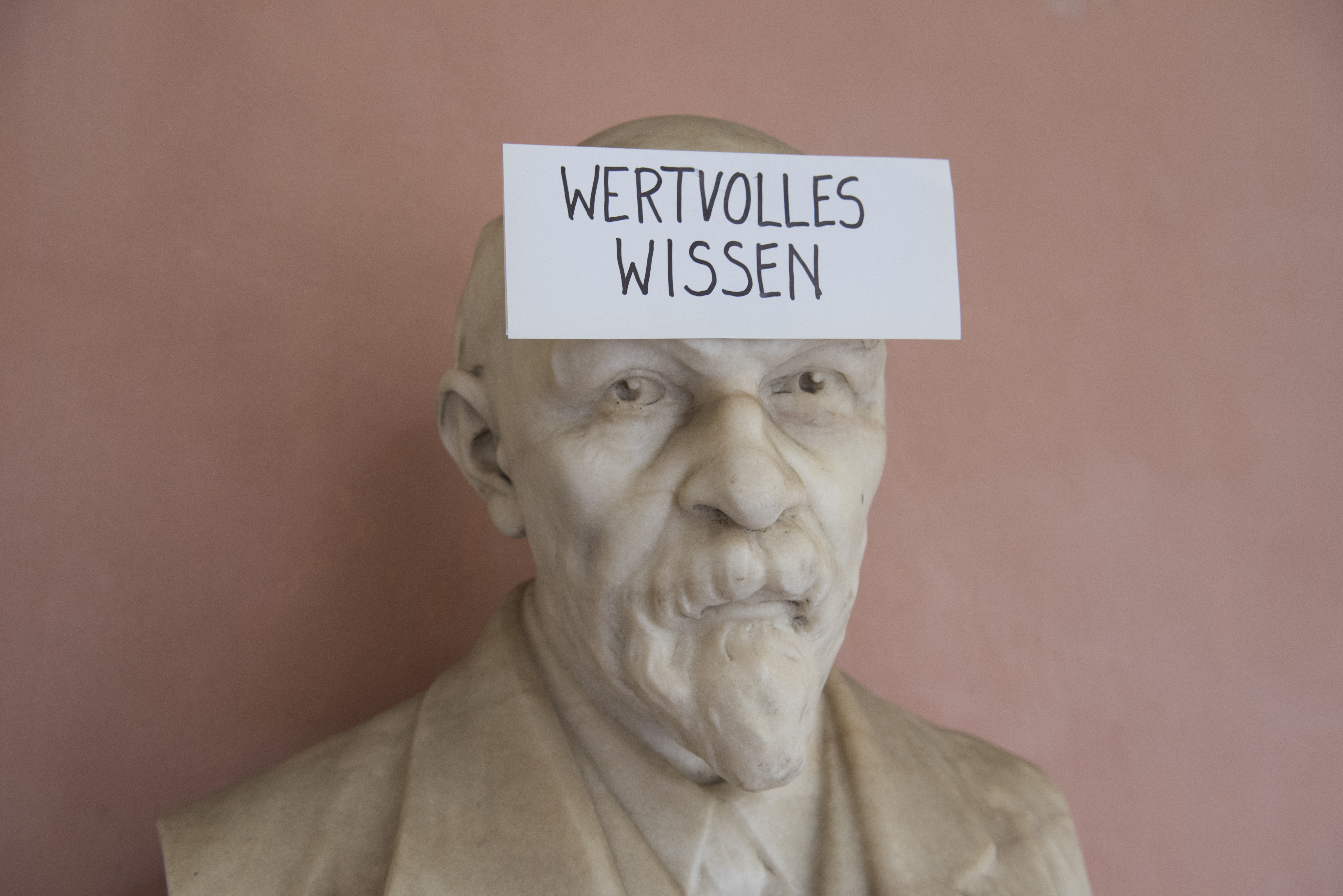
Mediale Angriffe auf die Gender Studies.
Was die Gender Studies so machen, sei nicht nachvollziehbar für die Durchschnittsbevölkerung: eine beliebte Beschwerde in Mainstreammedien. Forschungsfragen und Ergebnisse seien unverständlich und das Konzept Gender widerstreite „der ursprünglichsten Wahrnehmung und Empfindung der meisten Menschen“, wie es der Leiter des Politteils der Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) Volker Zastrow stilbildend auf den Punkt brachte.
UNVERSTÄNDLICH. Was impliziert dieser Vorwurf genau? Kann von einer Wissenschaft verlangt werden, dass man ihre Tätigkeiten ohne jegliches Vorwissen verstehen und beurteilen kann? Gilt das auch für andere Wissenschaften, Baustatik zum Beispiel? Ich würde eher sagen, dass das unrealistisch ist. Wissenschaftliche Disziplinen haben notgedrungen ihre eigene Sprache, mit der Phänomene analytisch genauer gefasst werden als mit Alltagssprache. Es bleibt wünschenswert, ihre Ergebnisse in geeigneter Weise an Lai_innen zu kommunizieren. Doch gerade hier kann man den Gender Studies kaum ein Versäumnis unterstellen. Denn es gibt unzählige einführende Texte in Flyer-, Buch- und digitaler Form, die alltagsweltlich bestens verständlich sind. Hätte sich Volker Zastrow den einen oder anderen davon zu Gemüte geführt, könnte er kaum behaupten, das Konzept Gender würde in Widerspruch zur „ursprünglichsten Wahrnehmung und Empfindung der meisten Menschen“ stehen, denn diese Wahrnehmung und Empfindung ist zentraler Bestandteil dessen, was mit Gender gefasst werden soll. Und auch wenn es in den Gender Studies unterschiedliche Sichtweisen zum Verhältnis von Kultur und Natur gibt, ist mir noch nie die Behauptung untergekommen, diese „Wahrnehmung und Empfindung der meisten Menschen“, sich als Mann oder Frau zu fühlen, würde schlicht nicht existieren. Wobei man Zastrow ja fast dankbar sein muss, dass er hier von den „meisten“ und nicht von allen Menschen schreibt. Denn das trägt dem Umstand Rechnung, dass es sehr wohl Menschen gibt, die sich nicht in das Mann- Frau-Zweierschema einordnen lassen, oder deren „ursprünglichster Empfindung“ das zugewiesene Geschlecht nicht entspricht. Folgerichtig müsste das als abnormal abgestempelt werden – aber was wäre damit gewonnen? Das widerstrebt mir als Privatperson und auch als Wissenschaftlerin ist es illegitim, ein System für Analysen zu benutzen, das biologisch und in seinen sozialen Konsequenzen nicht treffsicher ist. Spannend ist hier eher, woher der Wunsch kommt, diese strikte Trennung zu erhalten. Ja, die Leute sollen sich fühlen, wie sie sich fühlen. Gerade bei „ursprünglichsten“ Gefühlen sollte die Gefahr, dass sie einem weggenommen werden, ja eigentlich absurd erscheinen. Woher rührt also die Angst, das Genderkonzept würde Menschen zu geschlechtslosen Wesen umerziehen? Und was ist das überhaupt für ein Argument? Ist wissenschaftliche Forschung nur dann wissenschaftlich, wenn sie mit der „Wahrnehmung und Empfindung der meisten Menschen“ übereinstimmt? Gilt das auch für Baustatik?
WIDERSTREITEND. Folgt man Zastrow weiter, widerstreitet Gender nicht nur „der ursprünglichsten Wahrnehmung und Empfindung der meisten Menschen“, sondern auch „den Religionen und naturwissenschaftlicher Forschung“. Auf den vermeintlichen Widerspruch zu naturwissenschaftlicher Forschung bin ich in der letzten progress-Ausgabe („Genderwahn an Hochschulen“) schon eingegangen und möchte hier nur einwerfen, dass die Gender Studies interdisziplinär sind und naturwissenschaftliche Forschung daher ein wesentlicher Bestandteil ist. Bleibt noch der Widerspruch zur Religion und da muss man Zastrow ehrlich zu Gute halten: Das stimmt! Das Konzept Gender widerspricht zumindest in weiten Teilen religiösen Vorstellungen von Mann und Frau. Das ist wahr und das Argument gefällt mir nicht nur so gut, weil es wahr ist, sondern auch weil Zastrow keinen Genierer hat, es im selben Satz mit naturwissenschaftlicher Forschung zu bringen. Die Frage, ob naturwissenschaftliche Forschung nicht auch den Religionen in dem einen oder anderen Punkt „widerstreitet“, könnte ich mir jetzt vielleicht sparen. Aber „widerstreitet“ Religion nicht häufig auch der „ursprünglichsten Wahrnehmung und Empfindung der meisten Menschen“? Stichwort Sexualmoral.
Andere Leute hätten vielleicht Bedenken, diese drei Aspekte so nebeneinanderzustellen. Zastrow hingegen formt diesen Widerspruch um zu einer praktikablen Lösung für den Umgang mit Gender: Du kannst dir aussuchen, wem Gender widerspricht, ob deinem Bauchgefühl, deinem religiösen Glauben oder dem was du als „echte“ Wissenschaft gelten lässt.
NUTZLOS. Naheliegend ist dann auch der medial populäre Vorwurf, die Gender Studies würden keine nützlichen Ergebnisse liefern. Und damit sind wir paradoxerweise genau dort angelangt, wo wir in der letzten progress-Ausgabe stehengeblieben sind: bei dem Vorwurf, dass die Gender Studies zu nahe an politischen Interessen und Vorgängen angesiedelt, also gewissermaßen zu nützlich sind (wie es Villa und Hark in ihrem „Anti-Genderismus“-Buch beschreiben). An dieser Stelle stellt sich für mich schon die Frage, wie eine Wissenschaft, die gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen untersucht, ihre Nützlichkeit anders beweisen sollte, als gesellschaftlich relevantes Wissen über Ungleichheit zu erzeugen. Also wie könnte dieses Wissen nützlich sein, wenn es gleichzeitig keinen Einfluss haben darf? Nutzlos ist das erzeugte Wissen nicht, es ist nur wenig hilfreich für die Argumentation gegen gesellschaftliche und sexuelle Vielfalt. Und das scheint eher das Problem zu sein.
Carina Brestian studiert Soziologie an der Universität Wien.










