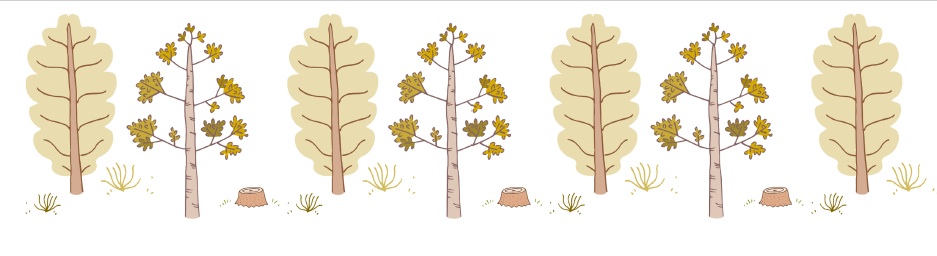force, power and violence
Sechs Dinge über Gewalt, die du noch nicht wusstest.

stark sein
Der Begriff Gewalt kommt von dem althochdeutschen Wort „waltan“, was so viel wie „stark sein“ oder „beherrschen“ bedeutet. Im Allgemeinen werden damit Vorgänge, Handlungen, aber auch soziale Zusammenhänge bezeichnet, mit denen auf Menschen, Tiere und – der besorgte österreichische Umgang mit Fensterscheiben und Mistkübeln lässt es schon erahnen – Gegenstände eingewirkt werden kann. Und zwar so, dass diese beeinflusst, verändert oder geschädigt werden. Je nach Kontext kann mit Gewalt ein direkter Einfluss oder auch nur eine Machtquelle, wie beim Begriff „Gewaltentrennung“, gemeint sein. Im Englischen gibt es für diese unterschiedlichen Bedeutungen eigene Wörter: Wer mit Gewalt einen Nagel einschlägt, benutzt force, die Gewalt als Machtquelle wird power genannt.
unterhaltsame Gewalt
Diskussionen über Gewaltdarstellungen in Filmen und Videospielen beherrschen regelmäßig Schlagzeilen, oft in Zusammenhang mit angeblich davon inspirierten nicht-virtuellen Gewalttaten. In Österreich hat jedes Bundesland sein eigenes Jugendschutzgesetz, was prinzipiell neun verschiedene Zulassungen von Filmen bedeuten könnte. In der Praxis prüft jedoch die Jugendmedienkommission des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur Filme und spricht eine Altersempfehlung aus, die von allen Bundesländern mit der Ausnahme Wiens übernommen wird. In der Hauptstadt sieht sich ein eigener Filmbeirat die Werke vor der Veröffentlichung an und gibt eine Altersempfehlung aus. Verpflichtend sind diese Empfehlungen jedoch weder bei Filmen noch bei Computerspielen. Anders sieht es in Deutschland aus: Dort wird von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) jedes Computerspiel durchgespielt, von unabhängigen Expert_innen geprüft und mit einer verbindlichen Altersfreigabe versehen.
thermonukleare Metaphernexplosion
Sollte es in naher Zukunft in Österreich zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen, wird manchen Medien die sprachliche Munition ausgehen. So werden jedes Jahr im Jänner bereits im Vorfeld die Proteste gegen den FPÖ-„Akademikerball“ als „Chaos“, „Krawalle“, „Ausschreitungen“ beschrieben, es wird vor „Gewaltexzessen“ gewarnt und nach den Protesten werden dann gar „bürgerkriegsähnliche Zustände“ herbeifabuliert. Diese verbale Aufrüstung wurde heuer auch von der Forderung der Bezirkshauptfrau des 1. Wiener Gemeindebezirkes nach einem Bundesheereinsatz in der Innenstadt begleitet. Wer sich Bilder von Städten wie Kobanê oder Aleppo, wo tatsächlich Bürger_innenkrieg herrscht, ansieht, wird relativ schnell erkennen, dass es sich bei Demonstrationen, an deren Rand Mistkübel umgeworfen (und wieder aufgestellt) und Fensterscheiben zerbrochen werden, mitnichten um Ereignisse handelt, die man als „Krieg“ bezeichnen könnte.
„bürgerkriegsähnliche Zustände“
ohne Graustufen
Die „erotische“ Romanreihe „Fifty Shades Of Grey“ von E. L. James ist von den Bestsellerregalen in die Kinos gewandert und feierte auch dort Erfolge. Während die Buchreihe von einigen als sexuelle Befreiung gefeiert wurde, hagelt es gerade aus der BDSM-Szene Kritik: Der beschriebene Sex sei zwar BDSM-Praktiken nachempfunden, die dargestellte Beziehung sei jedoch durch Missbrauch gekennzeichnet. Während in der BDSM-Szene Vertrauen, Konsens und sogenannte Safe-Words (Wörter, die im Vorhinein ausgemacht werden und „Stop“ oder „Nein“ bedeuten) eine wichtige Rolle spielen und das Ausleben gewisser Kinks überhaupt erst möglich machen, kommen diese Aspekte in James’ Roman überhaupt nicht vor. Nein-Sagen wird von der Romanfigur Grey konsequent ignoriert und gewalttätige Praktiken wie Stalking und Gaslighting werden glorifiziert und als sexy dargestellt. Laut einer Studie der Michigan State University haben Fifty-Shades- Leserinnen* ein höheres Risiko, in einer missbräuchlichen Beziehung zu leben, was zusammen mit dem Bild, das das Buch von BDSM vermittelt, zu einer Normalisierung häuslicher Gewalt führen könnte.
Monopol
In modernen Demokratien herrscht das sogenannte „Gewaltmonopol“ des Staates. Dieser Begriff stammt vom deutschen Soziologen Max Weber und drückt aus, dass die Mitglieder einer Staatsgemeinschaft darauf verzichten, selbst Gewalt auszuüben, um ihre Rechte durchzusetzen. Einzig die (meist demokratisch legitimierte) Exekutive hat das Recht, mittelbare (physische) oder unmittelbare Gewalt anzuwenden, um „Recht und Ordnung“ durchzusetzen. Lange Zeit galt dieses Gewaltmonopol in jedem Bereich, außer einem: der Familie (vgl. nächste Box). Aber auch Staaten geben gerne Stückchen und Scheibchen ihres Monopols ab: Private Sicherheitsfirmen oder gar Söldner_innen übernehmen Aufgaben des Staates und schrecken dabei – oft nicht ganz legal – vor Gewaltanwendung nicht zurück. Ein besonders schwerwiegender Fall ist das Militärunternehmen Blackwater (heute Academi). Im letzten Irakkrieg haben dessen Mitarbeiter_innen in mehreren Fällen Zivilist_innen getötet und Gefangene misshandelt. In Europa gibt es eine einzige legale Privatarmee: Die Atholl Highlanders stehen im Dienst des schottischen Duke of Atholl und sind heute eine Tourismusattraktion.
ungeschützt
Nicht alle sind gleichermaßen vor Gewalt geschützt. Während dies bei Eigentum und weißen Männern wenig Probleme bereitet, gibt es Personengruppen, die unverhältnismäßig oft Gewalt erleben. Zum Beispiel Kinder: Eltern hatten in Österreich bis 2000 (!) das Recht, zur „Erziehung“ Gewalt gegen ihre Kinder zu verüben. Auch gegen Gewalt in der Ehe, die meist von Männern ausgeht, gibt es erst seit 1997 ein eigenes Schutzgesetz, das Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie. In diesem Jahr beschloss die EU eine Kampagne zur „vollständigen Ächtung von Gewalt gegen Frauen“. Auch Gewalt gegen trans*Menschen ist traurige Normalität: Das Transmurder Monitoring Project der NGO Transgender Europe, das systematisch Hassmorde an trans*Menschen analysiert, hat seit Projektbeginn im Jänner 2008 über 1.600 Morde an trans*Personen gezählt.
Joël Adami studiert Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur Wien.
Mehr im Dossier Gewalt:
Gespenstische Gewalt Was haben eingeschlagene Scheiben und Burschenschaften mit Gewalt zu tun? progress hat im Gespräch mit Michael Staudigl, Dozent für Philosophie an der Universität Wien, den Weg zu einem differenzierten Gewaltbegriff gesucht.
8 Monate Rassistische Skandale, Misshandlungen, Eskalation und Repression, die Beobachter_innen und Zeug_innen trifft: eine Bestandsaufnahme österreichischer Polizeigewalt.
Kein Asyl ohne Erektion Nach dem Mord an der Trans* Frau Hande Öncü wird an den Asylverfahren von LGBTI-Personen scharfe Kritik geübt. Mit der geplanten Einführung von Schnellverfahren droht nun eine weitere Verschlechterung.
The internet is for hate Wie sich Hass in der Gesellschaft im Internet offenbart.
Achtung, Triggerwarnung! Ein Foto, eine Filmszene, eine Phrase – sogenannte „Trigger“ können an traumatisierende Erlebnisse erinnern. Die psychischen Auslösereize beeinträchtigen den Alltag von Betroffenen ungemein.
Was bedeutet Gewalt für dich? Sechs Studierende zum Gewaltbegriff in unserer Umfrage.