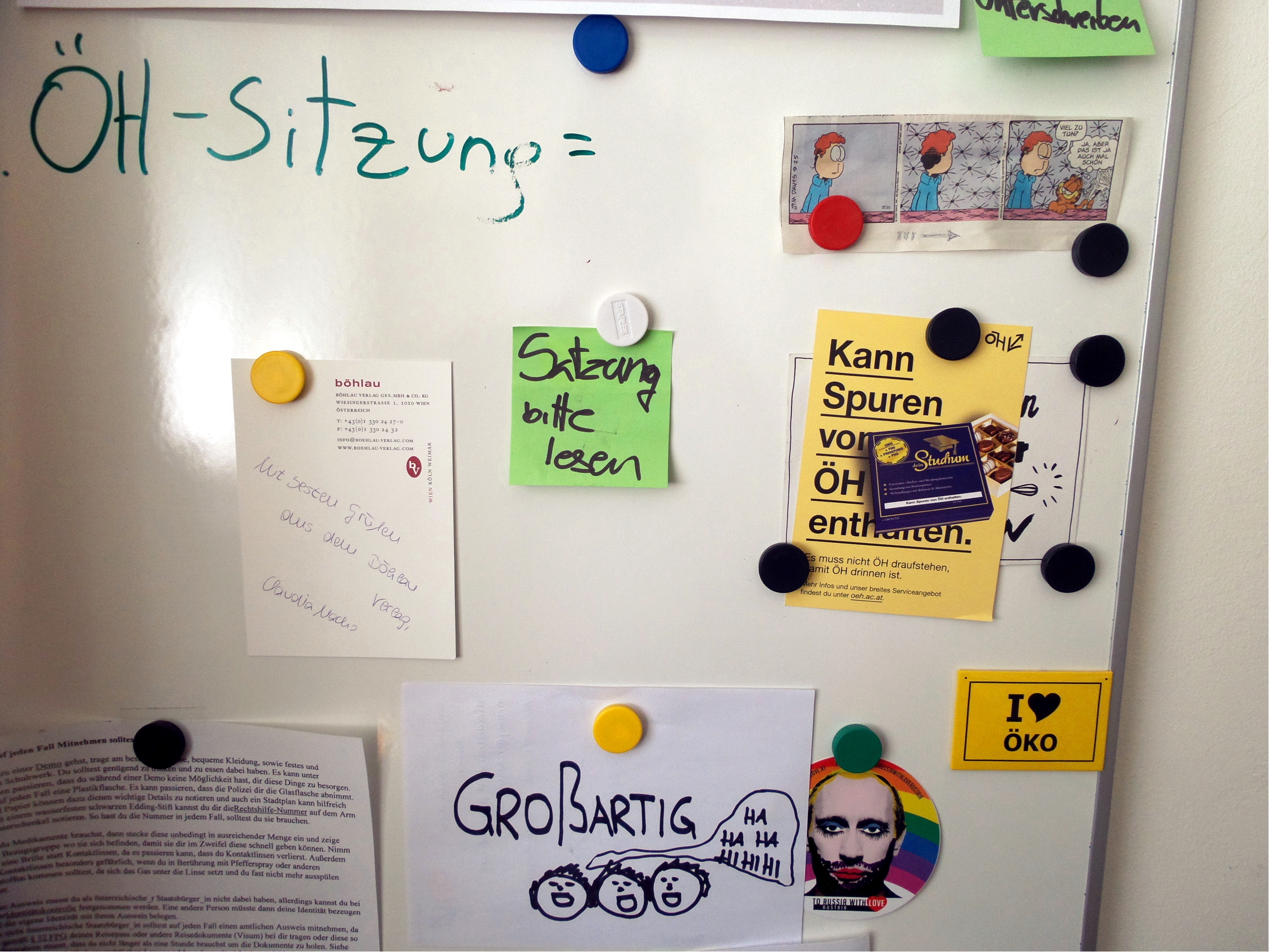Unseren Bass den könnt ihr haben
Seit fünf Jahren gibt es nicht nur Demos und Blockaden gegen den Akademikerball der FPÖ (ehemals WKR-Ball), sondern auch einen Gegenball. Wir haben mit dem „Ballkommitee” des WTF?!-Ball über politische Partys, Barrierefreiheit und Mitternachtseinlagen gesprochen.

Seit fünf Jahren gibt es nicht nur Demos und Blockaden gegen den Akademikerball der FPÖ (ehemals WKR-Ball), sondern auch einen Gegenball. Wir haben mit dem „Ballkommitee” des WTF?!-Ball über politische Partys, Barrierefreiheit und Mitternachtseinlagen gesprochen.
progress: Am 15.1. findet der WTF-Ball zum 5. Mal statt. Wie kam es vor fünf Jahren zum ersten WTF-Ball?
WTF-Ballkomitee: Vor 5 Jahren gab es von einigen Personen aus dem Umfeld des backlab-Kollektivs und einigen weiteren die Idee, die Proteste gegen den damaligen WKR-Ball um eine Facette zu erweitern und eine Art Gegenball zu machen, der Protest, Demoaufruf und gleichzeitig Party sein sollte. Natürlich wollten wir uns aber nicht in die Reihe der „normalen” Bälle einordnen, sondern das Konzept eines Balles auch gewissermaßen persiflieren. Außerdem war es uns wichtig, mit dem Ball Zeichen gegen jene Dinge zu setzen, die den WKR-Ball und jetzt den Akademikerball auszeichnen, also entschieden gegen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und Homophobie aufzutreten.
Wie ist das Team hinter dem Ball organisiert? Ist es „nur" eine weitere Party vom backlab-Kollektivs oder ist das Organisationsteam größer?
Das „Ballkommitee” hat sich über die Jahre hinweg etwas verändert. Im Kern gibt es immer noch Menschen, die auch bei backlab engagiert sind. Das war aber nicht vorrangig für das Entstehen des Orga-Teams: Es handelte sich vorrangig um das Umfeld der früheren discolab-Party, die sich immer als Event mit politischem Anspruch verstanden hat. Über die Jahre kamen interessierte Freund_innen und Genoss_innen dazu. Das Künstler_innenkollektiv backlab, welches ja ursprünglich auch aus Oberösterreich stammt, veranstaltet heuer zudem erstmals den WurstvomHund-Ball, der als Gegenball zum Linzer Burschenbundball konzipiert ist und am 6. Februar in Linz stattfindet.
Wie wählt ihr die Künstler_innen aus, die am WTF-Ball auftreten? Was ist euch dabei wichtig?
Wir versuchen einerseits immer einen Mainact zu haben, der_die in das politische Konzept des WTF?!-Balls passt und auch einen gewissen Bekanntheitsgrad mit sich bringt. Wichtig ist auch, dass sich die Kosten der Acts in Grenzen halten und durch solidarische Auftritte der Spendenbetrag größer wird. Wir bemühen uns auch so gut es geht, nicht nur Männer als Mainacts zu haben. Das ist uns in den meisten Jahren geglückt. Auch heuer gibt es in der Fluc Wanne keinen Slot ohne mindestens eine Frau.
Viele Partys sind nicht für alle zugänglich, weil an Barrierefreiheit oder an Awarenessteams nicht gedacht wird. Wie geht ihr mit diesen Themen um?
In den ersten beiden Jahre des WTF?!-Balls mussten wir organisatorisch noch einiges lernen und schafften es noch nicht ausreichend Engagement in Barrierefreiheit und Awareness zu setzen. Seit wir im Fluc sind und auch schon etwas Routine bekommen haben, haben wir uns verstärkt auf diese Themen konzentriert. Das Fluc selbst ist überwiegend barrierefrei. Bezüglich der Awareness haben wir uns dafür entschieden, das Thema auf dem gesamten Ball präsent zu haben. Schon beim Eintritt bekommen alle Besucher_innen einen Flyer und eine kleine „Ballspende”, die sie auf die Thematik aufmerksam machen sollen. Außerdem haben wir über die gesamte Zeit der Veranstaltung an der unteren Kassa eine zusätzliche Person aus dem Orga-Team als Ansprechperson, auf die auch auf dem Flyer verwiesen wird. Die Ansprechperson hat die Aufgabe, im Fall von Übergriffen oder Grenzüberschreitungen gemeinsam mit den Securities vom Fluc einen Rauswurf zu veranlassen, wenn die belästigte Person dies wünscht. Darüber hinaus gibt es an vielen Orten im Fluc Plakate, die noch einmal auf die “no means no”-Policy und die Vorgehensweise hinweisen. Wir freuen uns außerdem sehr, dass das Fluc seit einem Jahr auch abseits des WTF-Balls bemüht ist, eine „no means no”-Policy umzusetzen.
Wie sorgt ihr dafür, dass sich am WTF-Ball alle sicher fühlen können?
Die genannten Maßnahmen sind der Beitrag den wir leisten können, um den Ball für alle Besucher_innen so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten. Wir sind uns aber bewusst, dass wir es mit unserem Konzept nicht schaffen werden, den Ball als Gesamtes zum einem „Safe-Space” zu machen. Es ist uns wichtig von vornherein eine eindeutige Botschaft auszusenden, dass Übergriffe, Belästigung und Gewalt auf unserem Ball nichts verloren haben. Wir hoffen und vertrauen darauf, dass diese Botschaft auch bei den Besucher_innen ankommt und dass es, falls es doch zu Problemen kommen sollte, diese schnell an uns herangetragen werden, damit wir reagieren können.
Der Reinerlös des Balls geht heuer an die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung Wien und die QueerBase. Warum?
Diese beiden Organisationen unterstützen jene Menschen, die unter der Hetze der Besucher_innen des Akademikerballs am meisten zu leiden haben. Wir kennen und schätzen die Arbeit beider Organisationen und es ist uns ein Anliegen, sie mit dem Reinerlös des Balls zu unterstützen. Wir spenden generell vorwiegend an Organisationen, die kritsche und/oder emanzipatorische Unterstützung für Geflüchtete und Flüchtende anbieten. Die meisten davon sind auf private Spenden angewiesen.
Von der Party zur Politik: Seit letztem Jahr gibt es neben dem Akademikerball der FPÖ auch den „Wiener Ball der Wissenschaften". Letzterer ist eine Reaktion auf den Akademikerball. Seht ihr darin einen weiteren Gegenball?
Der “Wiener Ball der Wissenschaften” ist eher nicht als Gegenball einzuschätzen. Viel mehr ist er eine Reaktion, in der es darum geht sich den Ball als bürgerliches Konzept nicht wegnehmen zu lassen und auch das Wort „Akademiker” im Kontext eines Balles nicht der FPÖ zu überlassen. Gleichzeitig ist es vorstellbar, dass es Besucher_innen gibt, die sich auf beiden Bällen wohl fühlen. Immerhin reproduziert der Wissenschaftsball auch klassische Geschlechterrollen und ein gewisses Elitendenken. Für den WTF?!-Ball können wir ausschließen, dass sich FPÖler_innen und Burschenschafter wohlfühlen.Dafür sollen sich bei uns alle wohl fühlen, die sich nicht in irgendwelche Rollen oder Konzepte zwängen lassen.
Der Akademikerball wird, so heißt es zumindest, in der rechten Szene weniger wichtig. Das Bündnis NOWKR hat sich – unter anderem deswegen – 2015 aufgelöst. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich der Fokus des WTF-Balls verschiebt?
Sollten sich die Proteste gegen den Akademikerball gänzlich auflösen, würde der WTF?!-Ball in seiner derzeitigen Form nicht mehr funktionieren. Der WTF?!-Ball soll eben nicht nur eine Party sein, sondern auch Protest und Mobilisierung zu Protesten, weswegen wir auch immer den Organisationen, die zu Demonstrationen und Blockaden gegen den Akademikerball aufrufen, anbieten, mit einem Infostand am Ball vertreten zu sein. Unserer Einschätzung nach ist es nach wie vor notwendig, gegen diesen Ball zu protestieren und so lange es größere organisierte Proteste gibt, macht auch der WTF?-Ball Sinn.
Wie viel kann eine Party wie der WTF-Ball in der Szene, der Gesellschaft verändern und bewirken? Was sind eure Erfahrungen aus den letzten fünf Jahren?
Indem wir immer wieder Mainacts und sonstige Künstler_innen haben, die auch abseits des politischen Kontextes Menschen anziehen, denken wir, dass wir es sehr gut schaffen, mit dem WTF?!-Ball auch Menschen zu mobilisieren, die ansonsten keinen direkten Zugang zu den Protesten gegen den Akademikerball haben. Natürlich ist es für uns schwer nachvollziehbar, wie viele Menschen wir tatsächlich mobilisieren, aber eine gewisse Medienöffentlichkeit und die Verbreitung über Social Media tragen gewiss einen Teil zur Wirksamkeit bei. Auch die Wahl unserer Locations und Acts soll vor allem Menschen abseits der Politszene und junge Leute ansprechen, sich als Teil einer Gegenöffentlichkeit zu verstehen und ein niederschwelliger Einstieg ist nun einmal das gemeinsame Feiern.
Für alle, die noch nie auf einem Ball waren: WTF ist eine Mitternachtseinlage und warum lässt ihr da eine Partei auftreten?
Unsere Mitternachtseinlage ist Teil der Persiflage von herkömmlichen Bällen und immer irgendeine künstlerische Darbietung, die auf normalen Bällen wohl für Kopfschütteln sorgen würde. Am WTF?!-Ball funktioniert sie jedoch gut und passt auch in unser Konzept. Wir verbinden die Mitternachtseinlage immer mit einem expliziten Aufruf, sich an den Protesten zu beteiligen. Der Cut zwischen den Acts gibt uns die Möglichkeit dazu. Obwohl wir uns als WTF?!-Ball als politische Veranstaltung verstehen, haben wir uns von Parteipolitik bisher distanziert. Dass sich das heuer ändert, liegt wohl an der performativen Kompetenz der Perversen Partei Österreichs (PPÖ).
Links:
Webseite
Facebookevent
Gewinnspiel der ÖH-Bundesvertretung für Eintrittskarten zum Ball.
Das Interview führte Joël Adami.