Bio-Dinosaurier-Sackerl
Naturschutz ist wichtig, da sind sich fast alle einig. Nur: Was genau soll da eigentlich geschützt werden?
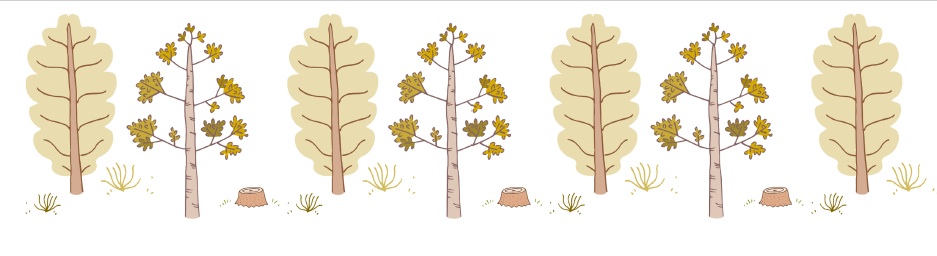
Naturschutz ist wichtig, da sind sich fast alle einig. Nur: Was genau soll da eigentlich geschützt werden?
Statt Plastiksackerln gibt es in manchen Supermärkten Taschen mit Aufdrucken wie „Umweltschutz ist für mich natürlich!“ zu kaufen. Dieses schlechte Wortspiel zeigt eine Reihe von Problemen auf, die uns begegnen, wenn wir uns näher mit dem Thema Umwelt- oder Naturschutz beschäftigen. Das Sackerl aus Kunststoff sei nicht umweltfreundlich und es sei vor allem nicht natürlich, im Gegensatz zu der Stofftasche oder dem biologisch abbaubaren Ersatzsackerl aus Maisstärke. Dabei besteht das Plastiksackerl genauso aus organischem Material wie das Stärkesackerl, nämlich aus Erdöl, das vor Jahrmillionen noch Dinosaurier und Urzeitpflanze war. Und bis aus der Maisstärke ein Einkaufssackerl werden kann, durchläuft sie viele komplizierte technische Prozesse – ähnlich wie das Erdöl, bevor es ein Plastiksackerl wird.
Mit diesem einfachen Beispiel wird klar, dass die Trennung zwischen dem „Natürlichen“ und dem „Künstlichen“ nicht so simpel ist, wie sie auf den ersten Blick scheint. Zwar können wir uns beim Plastiksackerl darauf einigen, dass Erdöl eine endliche Ressource ist, die Herstellung viel Energie verbraucht, das Sackerl nicht verrottet und aus diesen Gründen abzulehnen ist. Aber was ist denn so schlimm daran, wenn in der Natur unzersetzte Plastiksackerl herumliegen?
Die meisten werden wahrscheinlich antworten, dass das Sackerl da nicht hingehört, weil menschliche Dinge nun einmal nicht in die Natur gehören. Es gibt viele verschiedene Definitionen davon, was „Natur“ ist, eins haben sie aber fast alle gemein: Sie gehen von der Abwesenheit des Menschen aus. Die Umweltpsychologinnen Susan Clayton und Susan Opotow definieren Natur oder „naturnahe Umgebung“ als jene Teile der Umwelt, bei denen der Einfluss des Menschen sehr gering und nicht augenscheinlich ist.
Wenn wir über Naturschutz reden, klingt das sehr oft so, als würden wir die Natur vor den Menschen beschützen
wollen. Dabei ist das meiste von dem, was wir heute als unsere „natürliche Umwelt“ wahrnehmen, von Menschen gemacht. Wer in Österreich in die Natur fährt, um wandern zu gehen, fährt in eine künstlich geschaffene Kulturlandschaft, die genauso „natürlich“ (oder eben unnatürlich) wie Disneyland ist.
Wildnis unerwünscht. Das gilt aber nicht nur für den Wanderweg, den Klettersteig oder die Skipiste. Auch Naturschutzgebiete bestehen sehr oft aus Landschaften, die erst durch Bewirtschaftung entstanden sind. Ein Beispiel hierfür wäre die Perchtoldsdorfer Heide, ein Natura 2000-Schutzgebiet am südlichen Rand Wiens: Heute werden dort Trockenrasen geschützt, die zum allergrößten Teil erst durch die Nutzung der Flächen als Ackerlandschaft entstanden sind. Damit sich in der Heide weiterhin Ziesel, Smaragdeidechsen und an Nährstoffarmut angepasste Pflanzen wie die Kuhschelle wohlfühlen, müssen die Trockenrasen gepflegt werden. Freiwillige entfernen deshalb Sträucher und junge Bäume, zusätzlich wird der Rasen durch Schafe beweidet. Ohne diese Maßnahmen würde die Heide innerhalb weniger Jahre verbuschen und bald (bis auf sehr wenige Hügelkuppen) wieder einen Teil des Wienerwaldes bilden. Die Natur wird hier also nicht nur vor Hundekot und Mountainbiker*innen, sondern vor allem vor sich selbst geschützt. Die natürliche Sukzession, also die Abfolge von verschiedenen Pflanzengemeinschaften, die letztendlich in einem Hochwald und damit einer echten Wildnis mündet, ist im Naherholungsgebiet nicht erwünscht.
An der Perchtoldsdorfer Heide zeigt sich, dass Naturschutz oft nicht heißt, eine metaphorische Glasglocke über ein Gebiet, das als schützenswert gilt, zu stülpen, sondern es menschlicher Anstrengungen bedarf, damit es „natürlich“ bleibt. Oder eher: Damit die Landschaften so bleiben, wie wir Menschen sie haben wollen.
Hallo Anthropozän! Es gibt auf der Erde keinen Flecken mehr,der noch nicht vom Menschen beeinflusst wäre. Selbst in der Antarktis waren schon 1889, Jahre vor den großen Antarktisexpeditionen, Spuren menschlichen Lebens zu finden: Blei aus australischen Minen konnte etwa in Eisbohrkernen nachgewiesen werden. Der Ozean ist voll mit Plastikteilen, die Atmosphäre voll mit dem CO2 unserer Verbrennungsmotoren, auf der ganzen Erde lässt sich radioaktiver Staub, der von Atomwaffentests stammt, finden und sogar den Weltraum um unseren Planeten herum haben wir vermüllt. Die menschlichen Aktivitäten sind so gravierend, dass sie als „Anthropozän“ eine klar erkennbare geologische Schicht bilden werden. Zu diesem Schluss kam auch die Geological Society of London, seit dem heurigen Sommer steht der Begriff auch im Oxford English Dictionary. Die Erkenntnis, wie wenig „Natur“ auf unserem Planeten noch vorhanden ist, mag auf den ersten Blick niederschmettern, auf den zweiten Blick kann sie jedoch befreiend sein: Wir gestalten unsere Umwelt seit tausenden von Jahren, gleichzeitig ändert sich diese ständig. Wir sind bei unseren Entscheidungen über Naturschutz also nicht daran gebunden, was „natürlich“ wäre, denn „Natur“ ist ein soziales Konstrukt. Wir haben also in einem gewissen Rahmen Gestaltungsfreiheit.
Es gibt verschiedene Zugänge und Motivationen, mit denen Naturschutz gerechtfertigt wird: Grob können materialistische,
moralische, ästhetische und wissenschaftliche Motivationen unterschieden werden. Als ökologischwissenschaftlich werden Zugänge beschrieben, denen es um ein größtmögliches Verstehen der Strukturen, Funktionen und Beziehungen in der Natur geht. In politischen Diskursen überwiegen oft materialistische Motivationen – hier bedienen sich die Menschen der natürlichen Ressourcen und müssen sich vor negativen Aspekten wie Krankheiten, Katastrophen
und wilden Tieren schützen. Das ist immer noch ein oft gezeichnetes Bild, das sich auch in medialen Bedrohungsszenarien wie „Wildtiere in der Stadt“ (Marder fressen Autos auf) oder „fremde Arten wandern ein“ (asiatische Pflanzen breiten sich in „unserer“ Natur aus) niederschlägt. Die Natur muss hier vor fremden („ausländischen“!) Einflüssen geschützt und Ressourcen müssen nachhaltig genutzt werden: Dieser Schutz dient aber immer dem Überleben des Menschen. Diese Denkweise überwiegt auch beim Kampf gegen den Klimawandel, der ja gemeinhin als „Klimaschutz“ bezeichnet wird. Welches Klima wir genau schützen oder behalten wollen, hängt nicht mit einer bestimmten „natürlichen“ Idealvorstellung zusammen, sondern mit dem, was wir mit großer Wahrscheinlichkeit überleben können und was bezahlbar ist. Spätestens wenn zur Abwendung einer größeren Katastrophe Geo-Engineering als letzte Rettung vorgeschlagen wird, wird klar, dass vor allem unsere jetzige Lebensweise gesichert werden soll. So schlagen zum Beispiel manche Wissenschaftler*innen vor, Schwefelpartikel in die Atmosphäre über den Polen einzubringen. Damit ließe sich zwar die globale Erwärmung verringern, es würde allerdings vermehrt zu sauren Niederschlägen kommen – wahrscheinlich das Todesurteil für die arktische Taiga.
Tiefe Ökologie. Diesen Argumentationsmustern stehen moralische Aspekte entgegen. Die Liebe zur Natur oder die ethische Verpflichtung, die belebte und unbelebte Umwelt wegen ihres intrinsischen Wertes zu schützen, werden hier besonders betont. Dies geht manchmal auch mit einer Kritik an der Natur/Mensch-Dichotomie einher. Die „Deep Ecology“ ist in den 1970ern in Skandinavien als Gegenbewegung zu einer „flachgründigen Umweltbewegung“ entstanden und vertritt die Ansicht, dass alle Lebewesen das gleiche Recht auf Leben haben. Dieser „biosphärische Egalitarismus“ wurde als neue Spielart des Kulturimperialismus kritisiert, weil eine „Wildniserfahrung“ für eine gewisse sozioökonomische Schicht (meist Weiße in „Entwicklungsländern“) bewahrt werden sollte. In den USA findet sich mit dem „Environmental Impact Statement“ ein politisches Instrument, das von „Deep Ecology“ inspiriert scheint und die Auswirkungen sowohl auf kulturelle als auch auf natürliche Umwelten prüft.
Auch im Feminismus existieren Denkrichtungen, die unter dem Label „Ökofeminismus“ zusammengefasst werden und ökologische Fragestellungen mit feministischer Analyse verbinden. Manche finden auch in den Werken der Frankfurter Schule eine moralische Verpflichtung zum Naturschutz und sehnen sich nach einer Wiederverzauberung, die sie in einer intakten Natur finden wollen. Hier finden sich Anknüpfungspunkte zu einem eher romantischen Naturschutzverständnis, das sich aus naturalistischen oder ästhetischen Motivationen nährt. Mit naturalistisch sind hier die Befriedigung, Ehrfurcht und Faszination gemeint, die Menschen beim Kontakt mit der Natur, etwa beim Wandern oder Bergsteigen, empfinden.
Die „Biophilia“-Theorie, die besagt, dass Menschen durch ihre evolutionäre Entwicklung durch die Natur angezogen werden, scheint Recht zu bekommen, wenn man sich fragt, wieso Menschen gerne wandern oder klettern gehen. „Ich mag es grundsätzlich, in der Natur zu sein, weil man da seinen Kopf wieder frei bekommt. Selbst wenn man draußen etwas Anstrengendes macht wie Bergsteigen, fühlt man sich nachher viel frischer und energiegeladener. Ich denke, es ist die Freiheit, die frische Luft, die angenehme Atmosphäre, der schöne Ausblick, das ruhige Gefühl, das man bekommt, wenn man in die Weite einer schönen Landschaft schaut“, erzählt Ina, die an der Universität für Bodenkultur studiert und eine Pfadfinder*innengruppe betreut. Viele der Antworten, die ich bei der Recherche in sozialen Netzwerken bekam, ähneln sich: Vor allem die Stille, Einsamkeit und die gute Luft werden betont. Viele gaben auch an, dass ihnen weit entlegene Berge lieber wären als ein Park – der Ruf der vermeintlichen Wildnis.
Flauschiger Naturschutz. Schützen wir die Natur letzten Endes also, weil sie so hübsch aussieht und wir uns gut fühlen, wenn wir darin spazieren gehen? Es scheint zumindest so, denn auch Naturschutzorganisationen benutzen seit Jahren das Konzept der „Flagship Species“, um ihre Anliegen zu vermarkten. Kampagnen, bei denen süße oder sympathische Tiere geschützt werden sollen, laufen weit besser als „Wir wollen dieses stinkige Moor schützen!“ – obwohl das angestrebte Ziel oft das gleiche ist. Zum Problem kann das werden, wenn Biotope ohne Sympathieträger*innen unter Schutz gestellt werden sollen. Nicht jedes Tier, das wir aus moralischer oder wissenschaftlicher Motivation schützen wollen, lässt sich knuddeln.
Naturschutz ist gegen rechtsextreme Ideologien (Stichwort „Heimatschutz“) genauso wenig gefeit wie vor der Vereinnahmung durch neoliberale Wirtschaftssysteme. Wer die frische Luft und Einsamkeit in den „wilden“ Bergen oder am menschgemachten Trockenrasen genießt, sollte im Hinterkopf behalten, welchen gesellschaftlichen Schichten Naturschutz heute vor allem dient. Eine Überlegung, welche Motivation hinter dem dreisäuligen (ökologisch, wirtschaftlich, sozial) Nachhaltigkeitsparadigma steht, wäre natürlich (!) auch lohnend.
Joël Adami studiert Umwelt- und Bio- Ressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur Wien.




