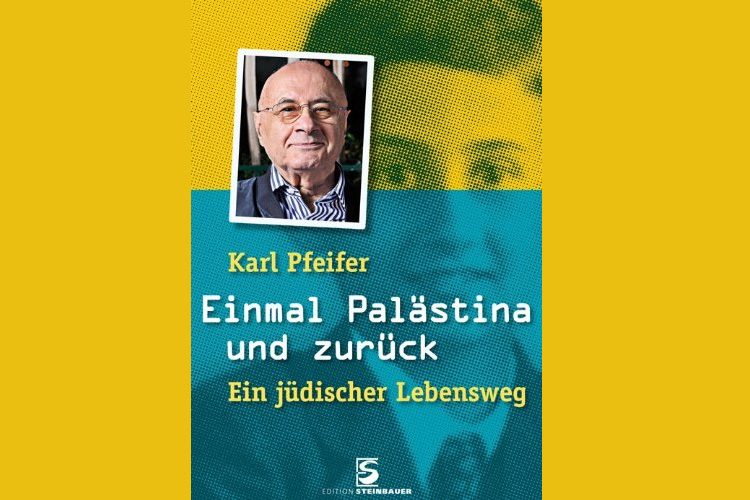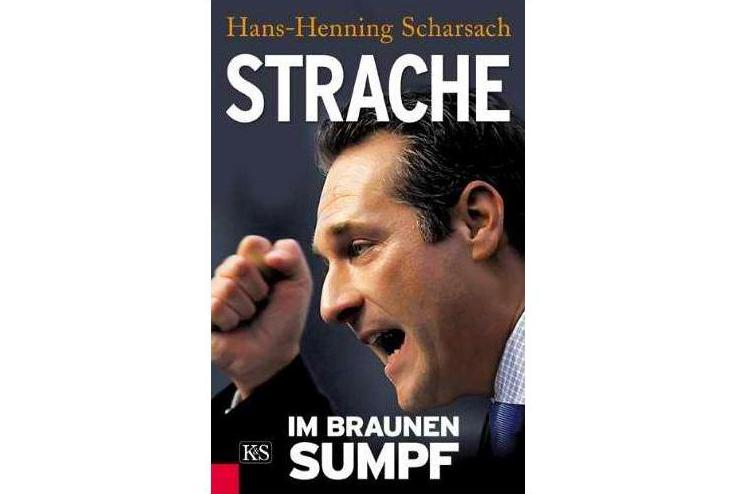Heimweh nach La Paz
Die pensionierte Kinderärztin Miriam Rothbacher (*1935, geb. Krakauer) musste wegen des nationalsozialistischen Antisemitismus mit ihrer Familie 1939 Deutschland verlassen. Bolivien gewährte der Familie damals Zuflucht. Im Interview erzählt sie von ihrem Leben und ihrem Hilfsprojekt Pro Niño Boliviano.

Die pensionierte Kinderärztin Miriam Rothbacher (*1935, geb. Krakauer) musste wegen des nationalsozialistischen Antisemitismus mit ihrer Familie 1939 Deutschland verlassen. Bolivien gewährte der Familie damals Zuflucht. Im Interview erzählt sie von ihrem Leben und ihrem Hilfsprojekt Pro Niño Boliviano.
progress: Wie sind Sie mit Ihrer Familie nach Bolivien gekommen?
Miriam Rothbacher: Wir sind sehr spät im Jahr 1939 ausgewandert und hatten das Problem, dass die meisten Zufluchtsländer ihre Grenzen für die jüdischen Flüchtlinge bereits geschlossen hatten. Sogar eine Flucht in die großen lateinamerikanischen Länder Argentinien und Brasilien war nicht mehr möglich. In Bolivien hatte mein Vater eine entfernte Cousine, deren Mann als Ingenieur in den Bergminen gearbeitet hat. Mit ihr hat mein Vater Kontakt aufgenommen und sie um Hilfe gebeten. Mein Vater war Lehrer und Studienrat und meine Cousine hat für meinen Vater ein Visum über den Rektor der Methodistischen Schule in La Paz besorgt.
Gab es einen politischen Hintergrund für die Aufnahme von jüdischen Flüchtlingen in Bolivien?
Bolivien hatte damals den Krieg gegen Paraguay hinter sich und der damalige General Germán Busch Becerra hatte die Juden ins Land geholt, um das Land aufzubauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen dann rechte Diktatoren an die Macht, die geflohenen Nazis Zuflucht gewährten.
Viele jüdische Flüchtlinge hatten große Probleme, im Zufluchtsland ihrem Beruf nachzugehen. Wie war das in Ihrer Familie?
Mein Vater hatte das Glück, schon in Deutschland Studienrat gewesen zu sein und Sprachen unterrichtet zu haben. Er konnte auch Spanisch und hat eine Anstellung als Lehrer an der amerikanischen Schule von La Paz bekommen. Meine Mutter hatte in Deutschland Schwedische Massage gelernt und als Masseurin gearbeitet. Sie hat sehr gut verdient, da die alten eingesessenen Deutschen von La Paz verrückt nach ihrer Massage waren und eine Fachkraft in diesem Bereich rar war.
Haben Sie in Bolivien Antisemitismus von den ansässigen Deutschen erfahren?
In Bolivien lebten viele Deutsche, die vor oder unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg ins Land gekommen sind. Es gibt heute noch eine deutsche Wurstfabrik in La Paz und in den tropischen Gegenden besaßen die Deutschen große Ländereien und Farmen. Die meisten von ihnen hatten nichts gegen Juden und haben den Nationalsozialismus in Deutschland auch nicht erlebt. Es hat jedoch eine deutsche Schule in La Paz gegeben, in der ein Hitlerbild hing und die Jüdinnen und Juden nicht besuchen durften. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs hatte diese Schule nicht mehr viele Lehrer, da diese meist aus Deutschland kamen und dort in den Krieg gezogen waren. Da überlegte die Schulverwaltung der deutschen Schule, meinen Vater – den Herrn Krakauer – als Lehrer an die Schule zu holen. Der Elternverein sprach sich jedoch dagegen aus, da mein Vater ein „J“ (Anm.: für Jude) im Pass hatte.
Hatten Sie als Kind Kontakt mit den Kindern der deutschstämmigen Bevölkerung? Ich bin zwölf Jahre in die amerikanische Schule gegangen und hatte mit den deutschen Kindern keinen Kontakt. Mit meinen SchulkollegInnen aus der Maturaklasse der amerikanischen Schule treffe ich mich aber immer noch.
Sind Sie einem der geflohenen Nazis einmal begegnet?
Nicht wissentlich. Aber ich kann folgende Anekdote erzählen: Als Kind habe ich mit meiner Mutter in den Winterferien das Hotel Hamburgo in der Ortschaft Chulumani in den Tropen besucht. In das Hotel sind viele EmigrantInnen auf Urlaub gefahren, weil die Besitzerin eine alte Hamburgerin war und europäisches Essen gekocht hat. Nach 1945 haben in dem Ort auch der „Schlächter von Lyon“ Klaus Barbie und andere Nazigrößen gelebt. Bei einer meiner späteren Bolivienreisen wollte ich meinem Mann das Hotel zeigen. Ich habe es jedoch nicht auf Anhieb gefunden und als wir bei einem Haus vorbeikamen, hat mich ein Mann gefragt, was ich suche. Er hat mir dann gesagt, dass von dem Hotel nur noch das Schwimmbad existieren würde. Und er habe erzählt, dass das der alten Nazifrau gehört hat, die damals den geflohenen Naziverbrechern Teller und Bestecke mit Hakenkreuz-Emblem serviert habe. Ich hab mir damals gedacht: Um Gottes willen! Meine Mutter würde sich im Grab umdrehen, wenn sie das wüsste!
Haben Sie damals Vorurteile seitens der bolivianischen Bevölkerung gegenüber Ihnen als Europäerin gespürt?
Ich habe keinen Antisemitismus durch die bolivianische Bevölkerung erfahren, außer manchmal von der katholischen Kirche, wenn der Pfarrer von der Kanzel gepredigt hat, dass die Juden Jesus Christus getötet hätten. Der Sozialmediziner Ludwig Popper war auch in Bolivien im Exil und hat das Buch „Bolivien für Gringos“ geschrieben. Auch er berichtet, dass er dort niemals Antisemitismus gespürt habe.
Was verbindet Sie bis heute mit Bolivien?
Ich wollte mein Leben lang wieder zurück nach Bolivien. Aber es hat sich dann ergeben, dass ich in Österreich geblieben bin. Dennoch ist Bolivien mein Land und meine Heimat. Ich war sehr lange wegen meiner drei Kinder und auch aus finanziellen Gründen nicht in Bolivien. Erst 1981 – als meine Kinder alt genug waren, um dieses Land zu verstehen – sind wir zusammen mit zwei meiner Freundinnen nach Bolivien gefahren. Damals war ich sehr aufgeregt. Viele meiner Freunde hier warnten mich davor, dass mich nach so langer Zeit niemand mehr in Bolivien kennen würde. Aber als ich nach La Paz gekommen bin, war es so, wie wenn ich niemals weggewesen wäre. Meine bolivianischen Freunde haben mich gleich erkannt und mich zu ihnen und ihrer Familie zum Essen eingeladen. Und obwohl damals die Situation wegen der Militärdiktatur eher trist war, hatte ich das Gefühl hier zu Hause zu sein. Als ich dann wieder nach Österreich zurückgekehrt bin, hatte ich wirklich großes Heimweh. Da ist es mir so gegangen wie 1955, als ich als junges Mädchen von Bolivien nach Heidelberg zum Studieren ging. Wenn ich hier keine Familie hätte, würde ich trotz Armut und sozialer Ungleichheit in Bolivien leben wollen.
Welche Erfahrungen haben Sie in Deutschland während Ihres Studiums gemacht?
Ich bin 1955 nach Deutschland gefahren, um in Heidelberg Medizin zu studieren. Ich wäre natürlich viel lieber in die USA zum Studium gegangen als nach Deutschland. Aber mein Vater hatte eine Pension bekommen, von der ich in Deutschland studieren konnte. Ich hatte damals sehr großes Heimweh nach Bolivien und habe meine Eltern sehr vermisst. Hinzu kam, dass die Deutschen sich als die einzigen Opfer des Zweiten Weltkriegs betrachtet haben. Die ganze Zeit über habe ich mir als Studentin anhören müssen, wie schlimm die Bombenangriffe waren und wie arm die Deutschen nicht gewesen wären. In Deutschland habe ich als Studentin zur Untermiete gewohnt und die Vermieterin hat mir gleich erzählt, dass ihr Bruder einem Juden in Karlsruhe ein Haus abgekauft habe und dass dieser es wieder zurückhaben wolle. An der Uni in Heidelberg haben auch die Burschenschaften eine zentrale Rolle gespielt. Ich selbst bin auf der Uni immer mit „Herr Miriam“ angesprochen worden, weil der Name überhaupt nicht bekannt war. Er war von den Nazis ausradiert worden. Und natürlich hat damals jeder Deutsche behauptet, von den Verbrechen an den Juden nichts gewusst zu haben. Ich hatte damals kaum Kontakt mit deutschen Studierenden. Meine Studienzeit in Deutschland war keine schöne Zeit. Auch später habe ich keine guten Erfahrungen mit Deutschland gemacht. In Schöneiche bei Berlin hatten meine Großeltern und mein Großonkel zwei Grundstücke. Das eine Grundstück von meinem Großonkel wurde mir als Alleinerbin geschenkt. Ich hätte aber für dieses Grundstück sehr viel Schenkungssteuer zahlen müssen und musste es veräußern. Und das, obwohl man meiner Familie das Grundstück weggenommen hatte.
Wie sind Sie nach Österreich gekommen?
Ich habe 1961 eine Freundin nach Wien begleitet, die sich im St. Anna Kinderspital vorgestellt hat. Der damalige Primar hat mich gesehen und mich gefragt, ob ich mich auch vorstellen möchte. Da habe ich mir gedacht, dass ich doch auch ein Jahr in Wien bleiben könnte. Während dieser Zeit habe ich aber meinen Mann kennengelernt und bin in Wien geblieben. Hier war vieles lustiger als in Deutschland, die ÖsterreicherInnen haben eine leichtere Art zu leben als die Deutschen. Ich finde, dass Österreich Bolivien ähnlicher ist als Deutschland. Ich war und bin gerne in Wien.
Wie ist Ihr Projekt Pro Niño Boliviano entstanden?
Als ich in Pension war, hat meine jüngere Tochter mich daran erinnert, dass ich geplant hatte, für längere Zeit nach Bolivien zu gehen. Sie wollte selbst nach Bolivien reisen, um zu sehen, wo ich aufgewachsen bin. 1996 sind wir dann gemeinsam mit ihrem damals eineinhalb-jährigen Sohn für längere Zeit nach Bolivien gereist. Damals ist mir die soziale Ungleichheit aufgefallen, doch ich hatte nicht die Absicht ein Projekt zu leiten. Daher habe ich nur ein bisschen in der Caritas vor Ort geholfen und mir Schulen angeschaut. Dabei habe ich dann beschlossen, zurück in Österreich Schulmaterial für die bolivianischen SchülerInnen zu sammeln. Doch die Sammelaktion hat eine Eigendynamik bekommen und mit der Zeit haben sich einzelne Projekte entwickelt.
Welche Projekte haben Sie seither verwirklicht?
Zunächst habe ich eine staatliche Schule in einer sehr abgelegenen Gegend von El Alto unterstützt. El Alto ist eine Satellitenstadt in der Nähe von La Paz, von der man sagt, dass sie die ärmste Stadt Lateinamerikas sei. In dieser Schule gab es nur zwei nackte Räume ohne Schulmöbel für 240 Kinder. Da haben wir damit begonnen Schulklassen zu bauen und Tische und Sessel für die Kinder zu organisieren. Wir haben uns bei diesem Projekt immer nach den Wünschen der Kinder und LehrerInnen gerichtet. Mittlerweile ist aus dieser Schule eine Maturaschule geworden, in der viele Klassen maturieren konnten. Nach diesem Projekt ist jemand gekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht auch eine andere Schule unterstützen wolle. Das haben wir dann getan, indem wir die Kinder mit Schulmaterial versorgt haben. Außerdem haben wir dort eine mobile Bücherei ins Leben gerufen. Danach habe ich bei einer meiner Reisen den Frauen gesagt, dass sie Handarbeiten anfertigen könnten und ich diese in Österreich verkaufen könnte. Heute machen wir fünfbis sechsmal im Jahr Verkaufsstände mit den Handarbeiten der Frauen. Mittlerweile können 20 Frauen von unserem Projekt leben. Und wir haben auch ein Tuberkuloseprojekt. Die Abwicklung der Projekte ist leider nicht einfach, da Bolivien für die österreichische Entwicklungspolitik kein Schwerpunktland ist.
Der Verein Pro Niño Boliviano sucht laufend ehrenamtliche MitarbeiterInnen: http://www.proninoboliviano.org/ Kontakt: office@proninoboliviano.net
Das Interview führte Claudia Aurednik.