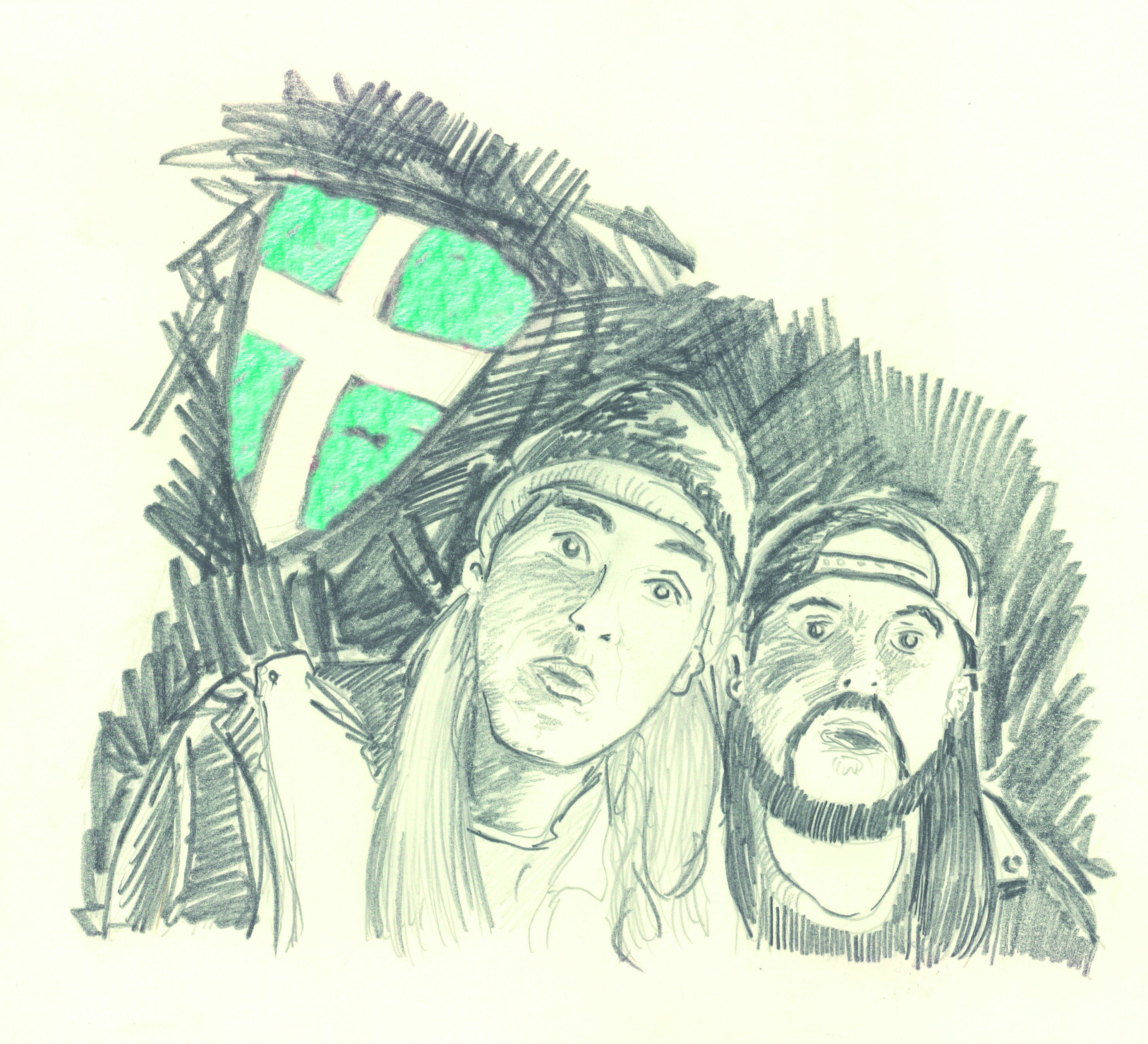Jüdische GenossInnen

„Wir müssen Revolution machen, weil Gott es uns befiehlt. Gott will, daß wir Kommunisten sein sollen!“ *
Viele der bedeutendsten VertreterInnen der ArbeiterInnenbewegung waren nicht jüdisch. Ebenso waren die meisten RevolutionärInnen, SozialistInnen oder KommunistInnen nicht jüdisch. Und dennoch trugen Juden und Jüdinnen gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil überproportional zur Entwicklung des Marxismus bei. Dies zeigt sich bereits an den Gründerfiguren dieser Bewegung: Karl Marx, Moses Hess, Ferdinand Lassalle, Rosa Luxemburg und Leo Trotzki wurden zu regelrechten Ikonen der internationalen ArbeiterInnenbewegung. Ihre jüdische Herkunft und die „Judenfrage“ beachteten die meisten von ihnen kaum. Antisemitismus war für sie Symptom der kapitalistischen Gesellschaft und würde in einer klassenlosen Gesellschaft nicht mehr existieren. Juden und Jüdinnen hätten sich im Lauf der Zeit assimiliert.
Als Leo Trotzki in seinem Wiener Exil die Oktoberrevolution plante, hätte er auch Vertreter des „Bunds“ oder der „Poale Zion“ treffen können. Beides jüdische Arbeitervereinigungen, die von Assimilation nichts wissen wollten. Sie kämpften explizit für die jüdischen ArbeiterInnen. Mit dem Ausbruch der Oktoberrevolution blickte die ganze Welt auf Russland, die Hoffnung auf eine gerechtere Welt weckte vielerorts große Erwartungen. Der bewusste Bruch der Sowjets mit dem Antisemitismus des Zarenreichs euphorisierte viele Juden und Jüdinnen, die begeistert im neuen Staat und an der Entwicklung eines neuen Menschen mitarbeiteten. Gleichzeitig litt vor allem die jüdische Bevölkerung in den Schtetln unter der neuen Wirtschaftspolitik und der religionsfeindlichen Haltung.
SOWJETISCHES ZION. In Wien verwies die jüdische, liberale Zeitung Dr. Blochs Wochenschrift am 14. Dezember 1917 stolz auf die jüdische Herkunft Trotzkis: „Trotzki hat seine Zugehörigkeit zum Judentum nie verleugnet, und als in einer politischen Diskussion ein Redner auf seine Abstammung die Anspielung machte, erwiderte er, er habe doch nie Ursache gehabt, seine Abstammung zu bedauern, der er ein geschärftes Verständnis für das Menschenelend der Vergangenheit und für die Aufgaben sozialer Gerechtigkeit in der Zukunft vielleicht zu danken habe.“ Kein Jahr später wurde in Wien die Kommunistische Partei Deutsch-Österreich gegründet. Von Beginn an nahmen einige jüdische GenossInnen bedeutende Positionen in der Bewegung ein, andere leisteten ihr Leben lang Parteiarbeit im Hintergrund. So Prive Friedjung, sie stammte aus einem Schtetl in Galizien, in den 20er-Jahren kam sie nach Wien und schloss sich der kommunistischen Partei an. Als es für sie nach dem Verbot der Partei 1933 und dem Februaraufstand 1934 immer schwieriger in Wien wurde, emigrierte sie in die Sowjetunion. In diesem Jahr kam es auch zu der offiziellen Gründung von Birobidschan, das als autonomes Siedlungsgebiet für jüdische SowjetbürgerInnen gedacht war. Das Projekt des sowjetischen Zion scheiterte an den schweren klimatischen Bedingungen und einer mangelnden logistischen Umsetzung, an der der verschwindende Wille an einer Forcierung einer jüdisch-sowjetischen Nation ablesbar war.
PARADIES AUF ERDEN. Bereits in diesen Jahren fanden die ersten Schauprozesse statt, die sich vor allem gegen (vermeintliche) trotzkistische AbweichlerInnen richteten, unter ihnen auch etliche JüdInnen. Zu Kriegszeiten war hingegen das Jüdische Antifaschistische Komitee auf Tour, um für Unterstützung im Krieg gegen Nazi-Deutschland zu werben. 1948 wurde dieses Komitee aufgelöst. Es folgten die sogenannten „Schwarzen Jahre“, in denen zahlreiche jüdische wie nicht-jüdische Personen verurteilt, verschickt und ermordet wurden. Das stalinistische Terrorsystem erreichte in diesen Jahren seinen Höhepunkt. Prive Friedjung befand sich zu dieser Zeit bereits wieder in Wien und arbeitete für sowjet-nahe Betriebe. Zu Zeiten des Kalten Krieges erlebte sie die feindliche Stimmung gegenüber der KPÖ, einer Partei, die in Österreich immer mehr in der politischen Bedeutungslosigkeit versank. Enttäuscht durch den innerparteilichen Umgang mit Mitgliedern und einer fehlenden Auseinandersetzung mit den Ereignissen in Ungarn und Prag, trat sie 1969 aus der Partei aus. 14 Jahre später trat sie ihr wieder bei, in der Hoffnung, die Partei würde die richtigen „Formen finden, die richtigen Wege gehen, um ihre Funktionen zu erfüllen“. Zu dieser Zeit hatte in der Sowjetunion die Refusenik-Bewegung und in Folge die Emigration sowjetischer Juden und Jüdinnen eingesetzt. Die meisten wanderten über Wien aus, einige blieben. Prive Friedjungs Memoiren tragen den Titel „Wir wollten nur das Paradies auf Erden“ und erzählen vom Traum einer jungen Frau aus einem Schtetl von einer gerechteren Welt. Lebensgeschichten, die von diesem Traum und oftmals von dessen Scheitern erzählen, werden in der Ausstellung im Jüdischen Museum Wien die jüdische Geschichte des Kommunismus – auf sowjetischer und auf österreichischer Seite – veranschaulicht.
Ausstellungshinweis: Genosse. Jude. Wir wollten nur das Paradies auf Erden.
6. Dezember 2017 bis 29. April 2018, Jüdisches Museum, Dorotheergasse 11, 1010 Wien
Gabriele Kohlbauer-Fritz ist Kuratorin im Jüdischen Museum Wien und Sammlungsleiterin.
Sabine Bergler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Jüdischen Museum Wien.