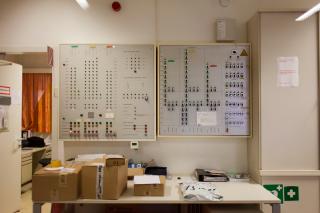Rassistische Skandale, Misshandlungen, Eskalation und Repression, die Beobachter_innen und Zeug_innen trifft: eine Bestandsaufnahme österreichischer Polizeigewalt.
Der damals 20-jährige Student Alex Plima* wollte gerade bei einem Würstelstand nahe einer Wiener U-Bahn-Station Schottentor Bier kaufen, als er Zeuge einer gewaltvollen Verhaftung wurde. Mehrere WEGA-Beamt_innen schleiften einen Mann, der nicht bei vollem Bewusstsein war und am Kopf blutete, die Treppen hoch. Alex stellte sich vor sie und schrie, um Passant_innen auf die Situation aufmerksam zu machen. Mehrmals forderte er die Beamt_innen auf, den Verhafteten ins Krankenhaus zu bringen und ihn ärztlich versorgen zu lassen. Angriffig, beleidigend oder gewalttätig wurde er aber nicht. Die Reaktion der Beamt_innen war für ihn überraschend und unerwartet aggressiv. „Von hinten hat mir ein Polizist die Hoden gequetscht. Nachdem ich ihn fragte, was das soll, wurde ich von sechs WEGA-Polizist_innen festgenommen. Auf meine Frage nach dem Grund für die Festnahme erhielt ich keine Antwort.“ Trotz Verhaftung wurde er jedoch nicht in Untersuchungshaft genommen. Erst ein halbes Jahr später erhielt er einen Brief, in dem er darüber informiert wurde, dass er wegen drei Vergehen angeklagt wird: Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und schwere Körperverletzung. Grund dafür sei ein wildes Herumschlagen seinerseits gewesen. Alex beteuert, nie Gewalt angewendet zu haben.
Eine Beschwerde wegen des Verhaltens der Polizei legte Alex jedoch nicht ein: „Du hast nur wenig bis keine Chance, dass dir Recht gegeben wird. Ich bin mir so ohnmächtig vorgekommen, weil sich die Polizist_innen so skrupellos über das Rechtssystem hinweggesetzt haben. Außerdem hätte es Energie, Zeit und Geld gekostet eine Beschwerde einzureichen und ich hatte nichts davon, weil ich mitten in der Vorbereitung für meine Studienberechtigungsprüfung steckte.“ Bei einer sogenannten Maßnahmenbeschwerde tragen von Polizeigewalt Betroffene ein Kostenrisiko von zirka 800 bis 900 Euro. Dass Personen, die eine Beschwerde einlegen, das Verfahren verlieren, ist statistisch eher die Regel als die Ausnahme. Nur zirka 10 Prozent der Misshandlungsvorwürfe werden überhaupt verhandelt.
„Rechtsschutz ist eine Frage der Ökonomie“, fasst die Verfassungsjuristin Brigitte Hornyik diesen Zustand zusammen. Sie legte kürzlich Maßnahmenbeschwerde gegen das Vorgehen der Polizei während der ersten Pegida-Kundgebung in Wien ein. „Eingekesselt wurden alle, auch Personen mit Presseausweis. Diese Freiheitsberaubung – wir wurden einzeln kontrolliert, Identitätsfeststellung, Perlustrierung – geschah frei nach US-Cop-Serien: Beine auseinander, Hände an die Wand! Die gesamte Aktion war einfach nur willkürliche Polizeirepression. Es hatte ja niemand von uns irgendwas verbrochen.“ Das wollte Hornyik nicht unwidersprochen lassen. Sie überlegt, bei Abweisung bis zum Verfassungsgerichtshof zu gehen. Sie ist sich aber ihrer Privilegien bewusst: „Das Institut für Kriminalsoziologie hat in den 80er Jahren eine Studie gemacht, welche Menschen ihr Recht am meisten verfolgen und welche am wenigsten: Akademisch gebildete Menschen männlichen Geschlechts standen ganz oben auf der Skala, Hausfrauen und Alleinerzieherinnen ganz unten – Rechtsschutz hat also auch eine geschlechtsspezifische Komponente.“
KEINE BEDAUERLICHEN EINZELFÄLLE. In den Sicherheitsberichten des Bundesministeriums für Inneres werden unter dem Punkt „Misshandlungsvorwürfe gegen Organe der Sicherheitsbehörden und ähnliche Verdachtsfälle“ Beschwerden gegen Polizist_innen statistisch erfasst und offengelegt. In den letzten zehn Jahren gingen 8.958 solcher Vorwürfe ein. Davon wurden ganze 8.004 Verfahren eingestellt.
Die hohe Zahl an Beschwerden und die vergleichsweise kleine Verfahrensanzahl wird wie folgt verteidigt: „Bei dieser Auswertung muss berücksichtigt werden, dass […] in einer überwiegenden Anzahl der angezeigten Fälle geringfügige Verletzungen beispielsweise durch das Anlegen von Handfesseln oder den Einsatz von Pfeffersprays eintrat (sic!) – zum Teil ohne dass ein Misshandlungsvorwurf gegen das einschreitende Organ erhoben wurde.“ Aufschlussreich ist die Tatsache, dass Verletzungen durch die Verwendung von Handfesseln und Pfefferspray als geringfügigbezeichnet werden, obwohl Pfefferspray in Österreich offiziell als Waffe gilt, die nur zur Notwehr eingesetzt werden darf, und jemanden zu fesseln als Nötigung.
„Ich denke, dass in einigen Fällen an den Vorwürfen gegen Polizist_innen tatsächlich nichts dran ist, sondern sich von Amtshandlungen Betroffene subjektiv ungerecht behandelt fühlen und sich über die Beamt_innen beschweren, obwohl die ihren Job korrekt gemacht haben“, sagt Anwalt Clemens Lahner, der unter anderem im Landfiredensbruchsprozess gegen Josef S. und im Fluchthilfeprozess gegen mehrere Aktivisten der Refugee-Bewegung Verteidiger war. Nun: Das 1989 gegründete „European Committee for the Prevention of Torture“, kurz CPT, kritisiert seit seinem Bestehen die Bedingungen der österreichischen (Schub-)Haft und die Zustände in Wachzimmern sowie Gefängnissen. Sogar bei absoluten Grundlagen sieht das CPT in Österreich Nachholbedarf und forderte etwa 1994 die österreichischen Behörden auf, in der Praxis den Haftbericht allgemein zu verwenden und richtig auszufüllen. Die Stellungnahme der Regierung: „Das richtige und vollständig (sic!) Ausfüllen der Haftberichte ist und wird Gegenstand der berufsbegleitenden Fortbildung sowie interner Schulungen sein.“ Im aktuellsten Bericht von 2010 wünscht sich das CPT von der österreichischen Regierung, „Polizeibeamte in ganz Österreich in regelmäßigen Abständen daran zu erinnern, dass jede Form von Misshandlung (z.B. auch Beschimpfungen) von Häftlingen nicht akzeptabel ist und Gegenstand strenger Sanktionen sein wird“. Sind die Festgenommenen einmal unter Kontrolle gebracht, gäbe es keinen Grund, sie zu schlagen. Lahner führt aus: „Gerade in Situationen, wo Gedränge und Lärm herrschen und die Beamt_innen eine Menschenmenge subjektiv pauschal als feindlich wahrnehmen, liegen die Nerven oft blank. Es kommt zu unverhältnismäßigen Einsätzen und bei Festnahmen werden Menschen oft am Boden fixiert, obwohl das gar nicht nötig wäre.“
Weiters kritisierte das CPT die niedrigen Strafen für straffällig gewordene Polizist_innen und rief angesichts bisheriger Fälle dazu auf, die Straftat „Folter“ so bald wie möglich in das Strafgesetz aufzunehmen, was Ende 2012 dann auch geschah. Schon 1991 schrieb das CPT über Österreich: „There is a serious risk of detainees being ill-treated while in police custody.“ 1999 erstickte der Nigerianer Marcus Omofuma während seiner Abschiebung in einem Flugzeug; 2006 wurde der Gambier Bakary J. von drei Polizisten nach einer gescheiterten Abschiebung in eine leere Lagerhalle gebracht und schwer misshandelt. 2009 erschoss ein Kremser Polizeibeamter einen unbewaffneten 14-jährigen. In allen drei Fällen fassten die Hauptangeklagten nur acht Monate Haft aus, Entlassungen folgten erst viele Jahre später oder gar nicht. Seit 1999 wurden mindestens acht Fälle bekannt, bei denen Schwarze Männer bei Festnahmen oder in Polizeigewahrsam gestorben sind. People of Color, Migrant_innen, Demonstrant_innen, Sexarbeiter_innen, Obdachlose, drogenabhängige und sozial schwache Menschen sind laut sämtlichen NGOs überdurchschnittlich von Polizeigewalt betroffen.
BESCHWERDE? GEGENANZEIGE! Dina Malandi berät beim Verein Zara (für „Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit“) Betroffene und Zeug_innen von Rassismus und dokumentiert im jährlich erscheinenden Rassismusreport auch Fälle rassistischer Polizeigewalt. Besonders körperliche Übergriffe seien schwierig nachzuweisen. Sollte man es doch versuchen, muss man mit einer sofortigen Gegenanklage wegen schwerer Körperverletzung rechnen. „Es wird schnell einmal gesagt, dass schwere Körperverletzung vorliegt. Diese Schutzbehauptung wird getätigt, um einer Beschwerde entgegenzuwirken. Jede kleinste Verletzung auf Seiten der Polizist_innen – ein Kratzer oder ein blauer Fleck – sind von Rechts wegen schon schwere Körperverletzung. Hier findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt.“
Aber auch Zeug_innen und Beobachter_innen mit Zivilcourage erfahren, wie etwa Alex’ Fall zeigt, massive Repression. Mit Geld- und Verwaltungsstrafen oder auch Verhaftungen wird es Menschen schwer gemacht, bei Übergiffen einzuschreiten, auf Missstände aufmerksam zu machen oder auch nur eine Demonstration, einen Einsatz oder eine Festnahme zu beobachten.
Maria Nym* saß an einem Freitagabend in einem Lokal, als sie vor dem Fenster eine Festnahme bemerkte. Sie versuchte, die gewaltsame Festnahme zu beobachten und ließ sich auch nicht durch Beleidigungen, Drohungen und physische Übergriffe durch die Polizei einschüchtern oder vertreiben. Nun werden ihr vier Verwaltungdelikte vorgeworfen: „öffentliche Anstandsverletzung“, „ungebührliche Erregung störenden Lärms“, „aggressives Verhalten gegenüber einem Organ der öffentlichen Aufsicht“ und Nicht-auf-dem-Gehsteig-Gehen. Die Höhe der Strafe: 350 Euro. Diese könnte sie zwar zahlen, aber sie hätte dann kein Geld mehr für die Miete. Deswegen legte Maria nun Einspruch ein und hofft darauf, dass die Strafe heruntergesetzt oder ganz fallen gelassen wird.
Dass nur wenigen, die wie Maria gegen Polizeigewalt und Schikane vorgehen wollen, Recht gegeben wird, liegt oft daran, dass die eigene Aussage gegen jene mehrerer Polizist_innen steht. „Unter den Polizist_innen gibt es nicht unbedingt den Willen, gegen Kolleg_innen auszusagen. Da herrscht noch oft eine falsch verstandene Solidarität“, so Dina Malandi. Das kann sich verheerend für die Person auswirken, die die Maßnahmenbeschwerde eingereicht oder Anzeige erstattet hat. Sobald Verantwortliche durch Kolleg_innen gedeckt werden, kann der_die Betroffene auch wegen Verleumdung angeklagt werden – statistisch gesehen passiert dies in fast vier Prozent der Fälle. Laut Malandi sind dies wesentliche Gründe dafür, dass viele Betroffene erst gar nicht Beschwerde einreichen. Die Dunkelziffer dürfte dementsprechend hoch sein.
FUCK THE SYSTEM. Diese „Cop-Culture“ zu brechen, sieht auch Florian Klenk als eine der wichtigsten Aufgaben im Rahmen der Polizeigewaltprävention: „Es braucht eine Beförderungsstruktur, die BeamtInnen, die auf Misstände hinweisen, belohnt. Momentan ist es noch so, dass jemand, der oder die seine Kollegen und Kolleginnen kritisiert oder verpfeift, absolut unten durch ist.“ Gerade machte Klenk einen Fall bekannt, bei dem eine 47-jährige Frau zu Silvester bei einer Tankstelle der Wiener Innenstadt offenbar ungerechtfertigt wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen und misshandelt worden ist. Steißbeinbruch, Schädelprellungen und Blutergüsse: für ihre Verletzungen oder für die Sicherstellung der Videobeweise nach der Anzeige der Frau interessierte sich die Staatsanwaltschaft vorerst nicht.
Der Falter-Chefredakteur und Jurist, der seit den 90ern investigativ über Missstände in österreichischen Gefängnissen und bei der Exekutive berichtet, meint, es habe sich aber seit damals auch einiges getan. Brigitte Hornyik dazu: „Der Polizei sind durch das Sicherheitspolizeigesetz nach wie vor sehr weitreichende Befugnisse eingeräumt. Vor 1991 war das noch schlimmer. ´Übergangsbestimmungen von 1929 waren oft die einzige Grundlage polizeilichen Handelns.“
Trotzdem kritisiert Klenk (genau wie das CPT und der Menschenrechtsbeirat der Volksanwaltschaft) die immer zunächst schleißig und intern angestellten Nachforschungen: „Es muss endlich eine unabhängige Stelle geben, die für Beschwerden gegen die Exekutive zuständig ist.“ Alle von progress kontaktierten Expert_innen sind sich übrigens einig, dass eine Kennzeichnungspflicht für Polizist_innen (etwa eine sichtbar an der Uniform angebrachte Dienstnummer) sowie am Körper angebrachte Kameras bei der Gewaltprävention aber auch bei der Aufklärung extrem hilfreich wären. Doch dagegen wehrt sich die Polizeigewerkschaft vehement. „Die blau unterwanderte Polizeigewerkschaft stellt sich leider allzu oft auf die Seite der schwarzen Schafe und diskreditiert damit die Arbeit der korrekten Polizistinnen und Polizisten. Sie ist Teil eines Systems des Schweigens und Verharmlosens. Wie in der RichterInnenschaft sollte auch bei der Polizei Äquidistanz zu politischen Parteien herrschen“, meint Klenk.
Zudem sähen Richter_innen und Staatsanwält_innen die Polizei als Verbündete im Kampf gegen das Verbrechen und wähnten einander trotz Gewaltenteilung auf derselben Seite, sagt Klenk. „Sie poltern zwar manchmal im Gerichtssaal, verhängen dann aber sehr milde Strafen. Man soll sich nur vorstellen, was zwei Nigerianer ausfassen würden, wenn sie einen Polizisten so gefoltert hätten wie es Bakary geschah.“ Verschwindend niedrig ist die Zahl der Polizist_innen, die nach einer Anklage überhaupt schuldig gesprochen werden. In den letzten zehn Jahren, von 2004 bis 2013, waren das insgesamt 13 Beamt_innen.
Im Fall von Edwin Ndupu, der von 15 Justizwachebeamten verprügelt worden war und kurz darauf in der Justizanstalt Krems/Stein starb, gab es sogar Anerkennung: Laut Falter 41/04 lud Justizministerin Miklautsch Anfang Oktober 11 der 15 an dem Einsatz beteiligten Justizbeamten zu sich ins Ministerium ein. Da die 11 Beamten bei dem Einsatz mit dem Blut des HIV-positiven Häftlings in Berührung gekommen waren, erhielten sie 2.000 Euro Schadensersatz.
Brigitte Hornyik meint, dass diese Zusammenarbeit zwischen Justiz und Exekutive kein Zufall sei: „Für mich ist das Ausdruck eines autoritären und hierarchischen Denkens: Die Staatsgewalt braucht eben Repression, um an der Macht zu bleiben. Letztlich sind das Ausläufer des Absolutismus und des Metternich’schen Überwachungsstaates.“
Zusammengefasst: Die Polizei handelt (nicht selten) gewaltsam. Es gibt keine unabhängigen Untersuchungsgremien bei Streitfällen. Sich zu wehren oder zu beschweren ist ein finanzielles, rechtliches und gesundheitliches Risiko. Die Justiz stärkt gewalttätigen und straffälligen Polizist_innen den Rücken, die Politik weigert sich zu handeln, obwohl internationale Gremien seit Jahrzehnten warnen und mahnen. Der längere Ast, auf dem die Staatsgewalt sitzt, ist ein Prügelknüppel. „Trotzdem würde ich vorschlagen, an diesem längeren Ast zu sägen und die Rechtmäßigkeit des polizeilichen Handelns in Frage zu stellen“, sagt Brigitte Hornyik. „Durchaus mit Hilfe der Gerichte, so lange wir noch nichts Besseres haben.“
*Name von der Redaktion geändert.
Marlene Brüggemann studiert Philosophie an der Uni Wien.
Olja Alvir studiert Physik und Germanistik an der Uni Wien.