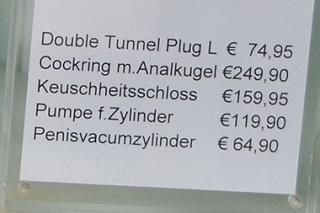Ein Interview mit dem Soziologen Christoph Reinprecht über die politischen Hintergründe der Vertreibung von obdachlosen Menschen aus dem Stadtpark, die zunehmende Kommerzialisierung und Kontrolle des öffentlichen Raumes sowie über mögliche Lösungen, Armut und Obdachlosigkeit wirksam zu bekämpfen.

progress online: Im Oktober 2013 wurden Obdachlose von der Polizei aus dem Stadtpark vertrieben. Haben Sie eine Vermutung, was die Hintergründe für diese Aktion sein könnten?
Reinprecht: Die Hintergründe der Vertreibung der Obdachlosen aus dem Stadtpark sind sicherlich stadtpolitischer Art. Die Stadt Wien legt relativ viel Wert auf ein breit aufgefächertes sozialpolitisches Programm, insbesondere auch im Bereich der Betreuung und Versorgung von Gruppen, die Schwierigkeiten in unterschiedlichsten Lebensbereichen haben. Die Stadt Wien ist sehr daran interessiert, diese Dinge auch geordnet zu regeln. Aus dieser Perspektive wird wahrscheinlich alles, was öffentlich sichtbar ist, als problematisch angesehen. Das war auch sichtbar an der Reaktion der Stadträtin: „Wir haben unsere Programme, wir haben unsere Einrichtungen und die Leute sollen in diesen Einrichtungen unterkommen. Der Stadtpark hat nicht die Funktion eines Ersatzwohnraumes.“ Das war wahrscheinlich der Hauptgrund für dieses überraschende, starke Eingreifen. Es ist auch im Zusammenhang zu sehen mit einer ganz bestimmten Art und Weise, solche Probleme in Wien zu regeln: zum einen sehr stark integrativ mit Programmen, zum anderen doch mit sanktionierenden Maßnahmen, mit Polizei und Räumung. Diese Doppelstrategie ist sehr charakteristisch und wurde auch hier wieder angewandt. Erstaunlich war sicher die Heftigkeit, mit der das passiert ist.
Es gab früher das Klischee des Obdachlosen, der bärtig und betrunken ist. Die Leute, die wir getroffen haben, entsprechen diesem Klischee teilweise gar nicht. Ist das ein Anzeichen dafür, dass die Obdachlosigkeit jetzt vermehrt auch breitere Gruppen betrifft?
Reinprecht: Es gibt Klischeevorstellungen der Obdachlosigkeit, insbesondere was den Clochard oder den Bettler betrifft. Das sind Vorstellungen, die gesellschaftlich sehr verankert sind, weil sie mit der Vorstellung von Armut verbunden sind. Was ist ein Armer? Was ist ein Outsider? Heute gibt es eine Diversifizierung der Obdachlosigkeit, teilweise ist auch der Begriff Obdachlosigkeit nicht ganz zutreffend. Wir haben bei Neubeschäftigten zunehmend prekäre oder atypische Erwerbstätigkeit, die nicht dazu reicht, ein Einkommen zu generieren, das zum Leben reicht. Gleichzeitig haben wir zunehmend Veränderungen am Wohnungsmarkt, wo die zugänglichen Segmente weniger werden - die billigen, die vielleicht auch schlechter ausgestatteten, aber zugänglichen Wohnungen. Das Risiko, in eine Situation zu geraten, in der man mit Wohnungslosigkeit oder ungesicherten Wohnverhältnissen konfrontiert ist, nimmt zu. Interessanterweise steigt es nicht nur bei bestimmten klassischen Klischeegruppen, die vielleicht auch in Konsequenz von Veränderungen in der psychiatrischen Versorgung und in anderen Bereichen klassisch den Obdachlosen zugerechnet werden, sondern die Personen kommen aus ganz unterschiedlichen Schichten, Berufsgruppen, Regionen und Milieus. Diese Diversifizierung der Wohnungslosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen ist eine Folge der Differenzierungen und Veränderungen am Arbeits- und Wohnungsmarkt. Und daher finden wir auch Personengruppen, die wir klassisch überhaupt nicht diesem Stereotyp zuordnen und unterordnen können.
Es gibt ja in Wien recht viele Einrichtungen für Obdachlose, aber es gibt nun einmal auch Obdachlose, die in diesen Einrichtungen nicht leben wollen oder können. Was wären denn Lösungsmöglichkeiten, dass diese Leute trotzdem selbstbestimmt leben können?
Reinprecht: Die Schwierigkeit liegt sicher darin, dass die sozialpolitischen Maßnahmen sehr stark von normierten Vorstellungen ausgehen. Was ist Versorgung? Was bedeutet Wohnen? Welche Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein? Was sind überhaupt diese Grundbedürfnisse? Das kommt auch daher, dass wir hier in einem Land leben, in dem der geförderte Wohnbau und der soziale Gemeindewohnbau eine starke Stellung haben - und in diesen Bereichen hat man sehr definierte Vorstellungen eines guten Wohnraumes. Diese Dinge werden in Prozessen definiert, in die die Betroffenen nicht einbezogen sind. Heute können wir aber auch beobachten, dass Wohnkonzepte ins Spiel kommen, die mit diesen sehr stark definierten, fixierten Wohnvorstellungen wenig gemein haben. Es gibt ja recht interessante Bewegungen, die zwar klein sind, aber sozialpolitisch meines Erachtens sehr interessant: Das können die Wagenleute sein, das können Leute sein, die Häuser besetzen. Dahinter sind Vorstellungen eines nicht kommodifizierten, vermarkteten Wohnraums, dass Wohnen vielleicht mehr ein kollektives Gut ist, das auch kollektiv genutzt wird und nicht nur privat angeeignet ist. Das ist deshalb so wichtig, weil ja die letzten zwanzig, dreißig Jahre doch durch eine starke Ökonomisierung des Wohnens gekennzeichnet sind. Wohnen wird heute zunehmend auch bei jungen Leuten als ein Gut gesehen, das auch eine Anlage ist, eine Altersversicherung darstellt, das eine Investition repräsentiert und nicht als etwas, das mit der Lebenswelt verbunden ist. Das ist eine wichtige Frage, weil sie das Thema der Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit berührt, weil hier ja auch unterschiedliche Wohnvorstellungen aufeinanderprallen. Es ist ganz klar, dass die Notunterkünfte für spezielle Gruppen sinnvoll und angemessen sind. Aber es gibt unter jenen Personen, die im öffentlichen Raum übernachten, sehr unterschiedliche Bedürfnislagen und Lebenssituationen. Daher ist diese standardisierte Form und diese Normierung wahrscheinlich der falsche Weg. Man müsste zum Teil einfach die Zugänge zum Wohnungsmarkt verbessern und die Möglichkeiten auch für vorübergehendes Wohnen öffnen. Man müsste Segmente des Wohnungsmarktes so gestalten, dass Personen, die wenig Einkommen haben oder die vielleicht auch nur vorübergehend in der Stadt sind, auch eintreten können. Man kann beobachten, dass diese Segmente des Wohnungsmarktes, etwa Kategorie D-Wohnungen, immer weniger zur Verfügung stehen. Daher sind viele Leute, die früher in diesen Bereichen des Wohnungsmarktes untergekommen sind, zunehmend angewiesen, alternative Lösungen zu finden, ein Teil davon findet sich auf der Straße. Man bräuchte also mit Sicherheit eine wohnpolitische Lösung. In Bezug auf Versorgungsmaßnahmen und Notschlafstellen sollte man mehr versuchen, die realen und heterogenen Lebenssituationen der Menschen mit einzubeziehen, denn auch hier gibt es extrem normierte Vorstellungen: Wer ist überhaupt unser Klient? Viele, die von Wohnungslosigkeit oder dem Risiko der Wohnungslosigkeit betroffen sind, passen überhaupt nicht in dieses Schema.
Spielen bei diesen Änderungen wirtschaftliche Mechanismen oder Ziele eine Rolle? Ist was dran am „Wettbewerb der Städte“?
Reinprecht: Bei der Gestaltung der Wohlfahrtspolitik spielt die Frage der Positionierung der Stadt eine wichtige Rolle. Das ist allerdings nichts Neues. Nehmen wir das viel besungene Rote Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Auch der kommunale Wohlfahrtsstaat des Roten Wien war eine gewisse Positionierung im Konzert der europäischen Städte, die von der Arbeiterbewegung und den damit verbundenen Kämpfen und Konflikten erfasst wurden. Heute ist die Positionierung der Städte weniger auf der Konfliktlinie zwischen Arbeit und Kapital, rechts und links - also politisch - angesiedelt. Vielmehr stellt sich jetzt die Frage: Bin ich eine Global City oder bin ich eher peripher? Es geht hier um Wettbewerbsüberlegungen, um die Attraktivität der Städte in Hinblick auf qualifizierte Arbeitskräfte, auf Standorte von Unternehmen, auf Tourismus. Und selbstverständlich ist die sozialpolitische Gestaltung ein wesentlicher Bestandteil davon. Wien wirbt ja damit, die höchste Lebensqualität der Städte zu haben - und die Sozialpolitik ist ein ganz wesentlicher Pfeiler davon: geförderter Wohnbau, gepflegte Parks, Ausstattung mit Kindergärten etc. Das Thema Obdachlosigkeit ist aber ein Thema, das diese Vorstellung einer perfekt gestalteten Stadt mit hoher Lebensqualität aufbricht, weil sich da plötzlich im öffentlichen Raum Elemente des Nicht-Zugehörigen einnisten, die sich wie eine Störung in diesem wunderschönen perfekten Modell darstellen. Das ist ein Grund, warum Städte sehr viel investieren, um diese Erscheinungen zumindest an der Oberfläche des Stadtraums zu neutralisieren. Ich sage das bewusst sehr hart. Das kann sein, dass man versucht, die Zahl der Obdachlosen zu reduzieren oder dass man sie zumindest in unsichtbare Zonen bringt, damit man sie nicht im Zentrum hat, wo der Tourismus ist, wo vielleicht die Wohlbetuchten oder die qualifizierten Arbeitskräfte angezogen werden sollen. Das kann aber auch sein, dass man das Betteln reguliert oder verbietet, dass man bestimmte Formen des Sichtbaren unsichtbar macht. Diese ganz neue Form der Regulation von Armut ist eine Art der Unsichtbarmachung. Das geschieht teilweise mit sehr diffizilen und subtilen Methoden und nicht immer mit polizeilichen Maßnahmen. Insofern war die Räumung des Stadtparks eher eine Ausnahmeerscheinung. Meistens geschieht das viel subtiler, mit Hilfe von Sozialarbeit und ähnlichen Mitteln. Aber so sehe ich diesen Konnex von Ökonomie, Stadtpolitik, Wettbewerb und einer Sozialpolitik, die dieses Lebensqualitätsmodell auf Hochglanzpapier transportieren möchte.

Sie haben einiges über den öffentlichen Raum geforscht. Glauben sie, dass die Wiener und Wienerinnen ein Bewusstsein für den öffentlichen Raum haben? Würde sich Protest regen, wenn er zu sehr privatisiert und reguliert wird?
Reinprecht: Der öffentliche Raum entsteht dadurch, dass er gelebt und angeeignet wird und die Menschen ihn für ihre Dinge nutzen. Jetzt ist Wien eine Stadt, in der der öffentliche Raum sehr stark von oben herunter reguliert und gestaltet ist. Die spontane Aneignung des öffentlichen Raumes ist etwas, das hier keine sehr lange Tradition hat oder zumindest nicht sehr verankert ist. Es gibt in den letzten Jahren verstärkte Versuche, den öffentlichen Raum kreativ und spontaner anzueignen, also zu einem wirklichen öffentlichen Raum zu machen. Die Diskussion um die Mariahilfer Straße ist natürlich ein Kristallisationspunkt. Aber an diesem Beispiel zeigt sich auch, dass die Diskussion letztlich sehr stark unter dem Gesichtspunkt ökonomischer Rentabilitätskriterien erfolgt. Es geht nicht so sehr darum, dass hier ein öffentlicher Raum entsteht, sondern primär darum, dass sie eine nette Einkaufsstraße wird. Und das ist charakteristisch für die Wiener Situation: die bekannten Orte, die wir als neue öffentliche Räume zelebrieren oder die zelebriert werden, wie zum Beispiel das Museumsquartier, sind hoch regulierte Orte, die alles andere als öffentlich im Sinne von aneigenbar und zugänglich für jedermann sind. Das ist ein sehr interessanter Aspekt für Wien, daher bin ich nicht so zuversichtlich, dass die ökonomische Aneignung, die Privatisierung, also die Unterordnung des Öffentlichen unter privatökonomische Interessen, auf viel Widerstand stößt. Es ist eher im Gegenteil ganz interessant zu beobachten, wie die sogenannte Belebung des öffentlichen Raums durch Schanigärten, durch das Aufstellen von Weihnachtsmärkten, von Ostermärkten – quasi einer Verhüttelung der Stadt - sehr positiv rezipiert wird. Es gibt hier ein ganz schräges Verständnis des öffentlichen Raums, wo diese folkloristische Art der Nutzung sehr positiv bewertet wird, während etwa die Nutzung, die daraus besteht, dass Menschen diesen Raum etwa als Arbeitsraum aneignen - nehmen wir das Thema Betteln - sehr negativ bewertet wird. Ich sehe eine starke Tendenz einer Folklorisierung des öffentlichen Raums, die ihr Echo im Selbstbild der Stadt und der Menschen findet.
Gibt es die Tendenz, Randgruppen unsichtbar zu machen, auch in anderen Ländern? Könnte man von einer Art Trend sprechen?
Reinprecht: Ja. Die soziale Frage, die ja zu Beginn im 19. Jahrhundert eher eine Frage der Arbeit war, wandelt sich in eine Frage der Armut. Der Konnex Arbeit - Armut verschiebt sich, er verändert seine Gestalt. Ein bestimmter Typus von der Gestaltung der Beziehung Arbeit - Armut, das was man als das Zeitalter der Vollbeschäftigung, der goldenen Jahrzehnte des Wohlfahrtsstaates nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet, dieser hat sich sehr stark gewandelt - und zwar in Richtung eines Modells, das man in der Forschung die „ausschließende Armut“ nennt. Armut wird nicht mehr als Sonderfall wahrgenommen und definiert. Es gibt eine erhebliche größere Zahl an Menschen, die aufgrund der Transformationen am Erwerbsarbeitsmarkt in Armut, Armutsgefährdung oder Prekarisierung leben und Schwierigkeiten haben, am Wohnungsmarkt unterzukommen. Selbst wenn man beschäftigt ist, heißt das nicht, dass man mit seinem Einkommen überleben kann. Die Art, wie die Gesellschaft mit dieser Frage der Inklusion und Exklusion umgeht, hat sich seit den 1960er Jahren extrem gewandelt. Heute gibt es ein viel stärkeres Prinzip der Ausschließung. Man versucht, Armut zu individualisieren, indem man sagt: Du musst selber schauen, dass du hineinkommst, du bist selbst verantwortlich für dein Leben. Man versucht zu aktivieren: Du musst schauen, dass du dich anstrengst. Das Beispiel der Obdachlosigkeit ist in diesem Zusammenhang interessant, weil die Kluft zwischen der Art des Umgangs der Gesellschaft mit diesem Thema und der Präsenz des Phänomens so stark ist. Sie haben einen gesellschaftlichen Diskurs, der immer auf Leistung und Wohlstand und individuelle Glücksbefriedigung hinausläuft, und sie haben auf der anderen Seite eine zunehmende Präsenz von Prekarität, da ist ein großer Widerspruch. Der große Bereich jener, die sich nicht individualisieren, nicht einbinden, nicht aktivieren lassen, der im Widerspruch zum Selbstmodell der Gesellschaft steht, wird tendenziell unsichtbar gemacht. Und das ist etwas, das wir nicht nur in Österreich haben. Diese Veränderung, wie der Wohlfahrtsstaat heute funktioniert, können wir in allen europäischen Ländern weitgehend beobachten.
Durch diese Änderungen im Sozialstaat hat die Armutsmigration innerhalb der EU stark zugenommen. Wie könnte die EU, wie könnte Österreich reagieren? Momentan werden Obdachlose in Ungarn vertrieben und wenn sie nach Österreich kommen, werden sie wieder vertrieben. Gibt es Lösungsansätze, wie man das verhindern könnte?
Reinprecht: Das ist ein extrem interessanter Fall, weil sich am Beispiel der sogenannten Armutsmigration die ganze Frage aufbaut: Was ist überhaupt das Sozialmodell Europa? Es gibt noch kein Sozialmodell Europa. Es gibt keine institutionalisierte Form des Wohlfahrtsstaates auf europäischer Ebene, alles ist nationalstaatlich geregelt. Es gibt zwar zunehmend Versuche, diese Systeme zu verbinden, zu homogenisieren, aber alle diese Versuche waren in der Vergangenheit gewissermaßen aus der Perspektive des Zentrums definiert, also für Mittelschichten, für Beschäftigte in qualifizierten Berufen, die mobil sind und auf Grund dieser Mobilität auch die Systemharmonisierung benötigen. Nun wird aber dieses Prinzip der Freizügigkeit selbstverständlich nicht nur von jenen genutzt, die am Arbeitsmarkt gut integriert sind oder die auch sonst wohlhabend sind - siehe die Pensionisten, die im Alter nach Mallorca übersiedeln - sondern es wird auch von jenen Menschen realisiert, die wenig haben und diese Freizügigkeit als Möglichkeit wahrnehmen, um aus ihren teilweise sehr schwierigen Kontexten im Herkunftsgebiet zu entkommen oder Chancen wahrzunehmen, die sie vielleicht noch gar nicht genau einschätzen können. Durch ihre Wanderung im europäischen Raum konfrontieren sie Europa mit dem eigenen Prinzip der Freizügigkeit bei gleichzeitigem Fehlen eines Sozialmodells. Ich finde das aktuell eine sehr wichtige Phase, weil es die Gelegenheit gibt, dieses Sozialmodell profund zu diskutieren. Es kann nicht sein, dass das Sozialmodell nur eines für die gut integrierten ist und alle anderen in ihren Herkunftsländern bleiben sollen. Das wäre genau dieses Prinzip des Unsichtbarmachens. Im Grunde genommen kann die Lösung nur ein europäisches Sozialmodell sein, das die Frage der Armut integriert betrachtet, als etwas, das aus der Gesellschaft heraus erzeugt wird, durch ungenügende oder ungleiche Chancen im Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Wohnungsmarkt etc.
Es gibt verschiedene Ansätze, was eine Neugestaltung des Sozialsystems betrifft. Könnten Mietobergrenzen, wie sie in letzter Zeit diskutiert wurden, eine Lösung sein?
Reinprecht: Wir haben in Österreich seit den 1980er Jahren eine sukzessive partielle Deregulierung des Wohnungsmarktes. Der Wohnungsmarkt in Österreich war sehr reguliert, auch was die Mieten betrifft. Vor allem in Wien war er durch einen hohen Anteil an Sozialwohnungsbau, Gemeindebau und öffentlich gefördertem Wohnbau geprägt. Insofern hat man die Probleme am Wohnungsmarkt lange nicht sehr ernst genommen. Die Effekte von Reformen sind ja nicht sofort sichtbar. Wenn eine Reform stattfindet, ist der Effekt erst zehn, fünfzehn Jahre später wirklich spürbar. Etwa die langfristigen Effekte der Stadterneuerung: Der Wohnraum wurde besser, aber teurer in der Weitervermietung. Noch in den 1980er Jahren gab es in Wien viel schlecht ausgestatteten Wohnungsbestand. Heute kommen in Zyklen neue und neu renovierte Wohnungen auf hohem Standard auf den schwach regulierten Markt. Die Chancenungleichheit im Zugang zum Wohnungsmarkt nimmt dadurch stark zu. Eine Deckelung der Mieten wäre daher eine ganz logische Konsequenz. Die jetzigen Mechanismen sind einfach zu weich, aus der Mieter und Mieterinnenperspektive ist die Situation sehr schwierig geworden. Wenn man diese längerfristigen Effekte der Wohnungsreformen, der Deregulierung sieht, dann wäre eine Re-Regulierung in diesem Sinn sicher sehr wünschenswert.
Wäre das Bedingungslose Grundeinkommen einen Versuch wert?
Reinprecht: Das Bedingungslose Grundeinkommen wäre sicherlich eine interessante Lösung, allerdings müssten meines Erachtens zwei Dinge berücksichtigt werden. Das Erste ist: es müsste darauf geachtet werden, dass es nicht an Bedingungen geknüpft ist - darum heißt es ja bedingungsloses Grundeinkommen. Ich sage das deshalb, weil die Ansätze, die es im europäischen Raum gibt, etwa das RSA (Revenu de Solidarité active) in Frankreich, zu Leistungen wie Aktivierung, Arbeitsplatzsuche und Ähnlichem verpflichtet. Der zweite wichtige Punkt wäre allerdings: das Bedingungslose Grundeinkommen ändert so lange nichts, so lange wir nicht massiv versuchen, den Arbeitsbegriff neu zu definieren. Ein Schlamassel der Gesellschaft besteht ja darin, dass das Erwerbsarbeitskonzept nach wie vor so zentral ist. Nun ist aber die Erwerbsarbeit in den letzten zwanzig, dreißig Jahren durch die Veränderung technologischer und organisatorischer Art in einer Weise strukturiert, dass sie zunehmend jene Elemente niedrig hält, die gesellschaftliche Integration über den reinen Einkommenserwerb gewährleisten. Was ich damit sagen will: Erwerbsarbeit wird zunehmend nur unter Effizienzkriterien gesehen, unter dem Gesichtspunkt der ökonomischen Rationalität und immer weniger unter dem Gesichtspunkt der Kommunikation, der Solidarität, der Gemeinschaft oder der gemeinschaftlichen Interessen. Diese entsolidarisierende Funktion der Erwerbsarbeit ist eigentlich ganz grotesk, weil es ja früher genau das Gegenteil war: da war Erwerbsarbeit das integrative Element. Heute ist Erwerbsarbeit gewissermaßen das spaltende Element und das weist darauf hin, wie wichtig es wäre, den Arbeitsbegriff vom Erwerbsarbeitsbegriff herauszulösen und die Debatte um das Bedingungslose Grundeinkommen an die Redefinition des Arbeitsbegriffes zu knüpfen. Ich halte das für ganz, ganz entscheidend, denn nur dann gelingt es auch, aus all jenen, die ein Grundeinkommen beziehen, aber nicht am Erwerbsarbeitsmarkt integriert sind, nicht wieder stigmatisierte, marginalisierte Out-Groups zu machen. Es geht um eine Redefinition: Was ist überhaupt der Kern der gesellschaftlichen Eingliederung? Und das kann nicht nur und sollte nicht nur die Erwerbsarbeit sein.
Christoph Reinprecht ist Soziologe an der Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Sozialstruktur und soziale Ungleichheit, politische Soziologie, Soziologie der Migration und Stadtsoziologie.
Das Interview führte Dieter Diskovic. Er hat Kultur- und Sozialanthropologie studiert und engagiert sich bei der Screaming Birds Aktionsgruppe.