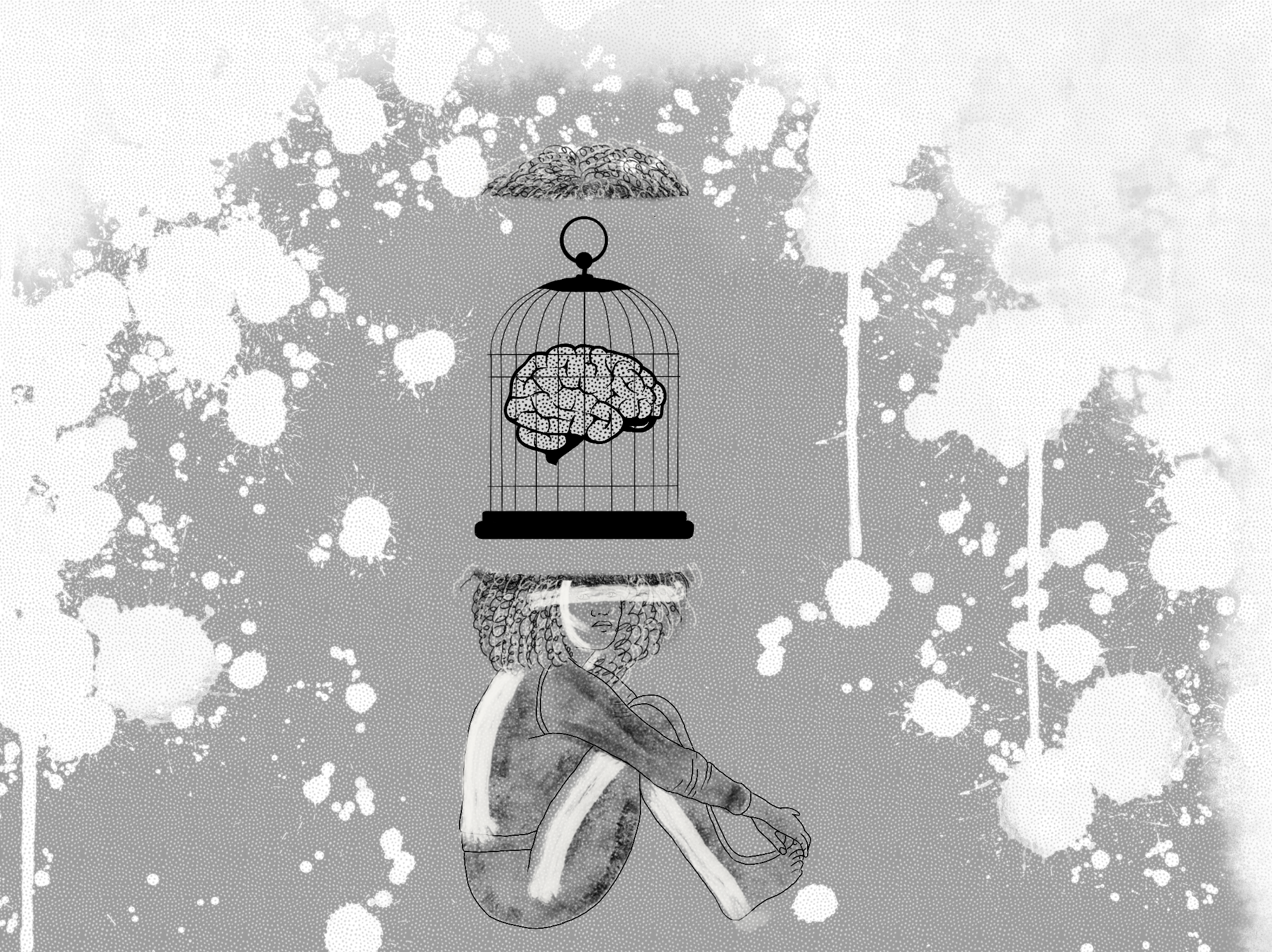Ein roter Faden durch gefährliche Selbstoptimierung, die neoliberale Idee dahinter und ihren Zusammenhang mit unserer mentalen Gesundheit im Studium.
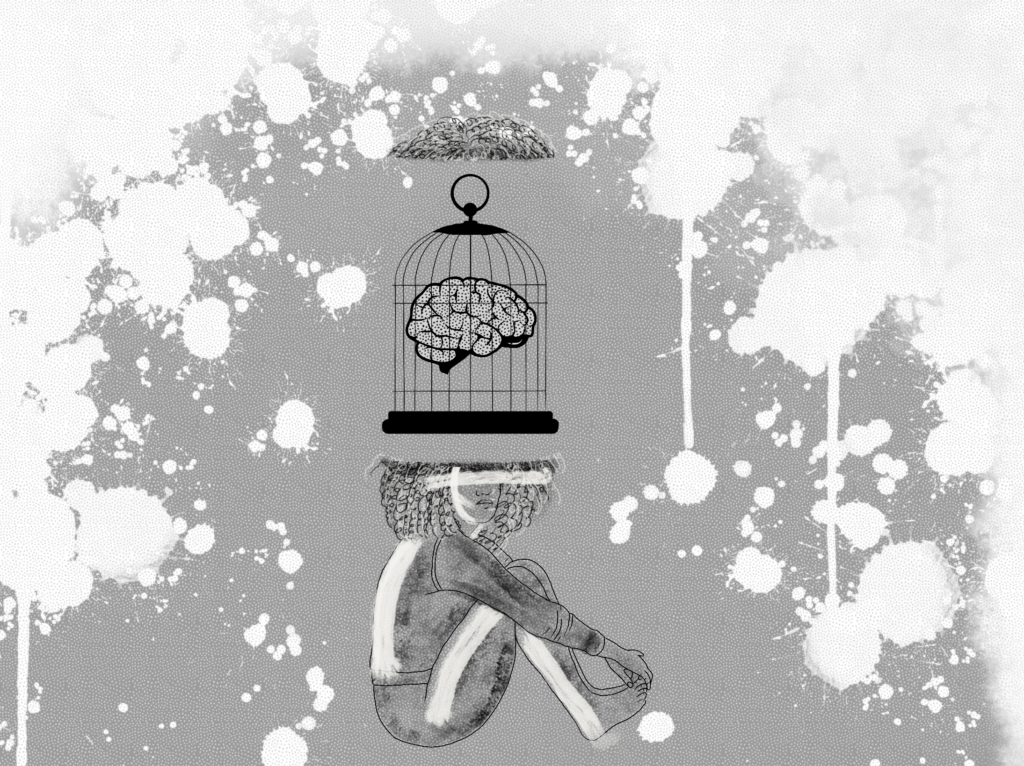
Wer heute lange genug durch diverse soziale Medien browst, stolpert früher oder später auf Selbstoptimierer_innen. Wenn man Instagram, Facebook und Co. glauben will, wirken Selbstoptimierer_innen zumindest in ihren Beiträgen als Fitnesstrainer_in, Vorzeigestudent_in und Ernährungscoach so, als hätten sie über jedes kleinste Detail in ihrem Leben die vollkommene Kontrolle und als schafften sie es, sich selbst auf einen hingeträumten „Optimalzustand“ des menschlichen Seins zu bringen. Mit dem Mindset „wer lange genug an sich arbeitet, schafft das, was ich geschafft habe“ setzen sie über soziale Medien unrealistische und gefährliche Standards. Ob das Leben der Influencer_innen offline tatsächlich so glamourös abläuft, dringt nicht durch.
Diese gefährlich hoch angesetzten Standards wirken auf außenstehende – und vor allem junge – Leute oft extrem belastend. Der konstante Druck, nicht gut genug zu sein und mehr an sich arbeiten zu müssen, trägt immens dazu bei, dass junge Erwachsene mit ihrer psychischen Gesundheit kämpfen müssen. Auch Jugendliche und Kinder sind diesen nicht einhaltbaren Standards ausgesetzt und erleben schon früh den Stress und Druck, nicht mit anderen mithalten zu können. Das erklärt die seit Jahren steigenden Zahlen der psychischen Krankheiten bei Personen unter 30.
Psychische Belastungen und Krankheiten haben durch die Corona-Pandemie stark zugenommen. Eine Studie der Donauuniversität Krems erhob, dass im Jahr 2019 rund fünf Prozent der jungen Erwachsenen eine depressive Symptomatik aufwiesen, während im Jahr 2021 fast die Hälfte der jungen Erwachsenen betroffen waren. „Besonders deutlich sind die sehr schweren Fälle, die sich in den letzten Jahren verzehnfacht haben“, meint der Leiter des Departments für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit an der Donauuniversität Krems Univ.-Prof. Dr. Christoph Pieh. Er ortet einen deutlichen Rückgang der Lebensqualität, der besonders Frauen, Arbeitslose und Alleinstehende trifft.
Von einer „Radikalisierung von arm und reich“ spricht in diesem Zusammenhang Prof. Dr. Benigna Gerisch, Psychoanalytikerin von der IPU Berlin. „Das heißt, dass mit den entsprechenden Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, man besser durch die Pandemie kommt, als wenn man die eben nicht hat. Einigen ist es also ziemlich gut gelungen, die Pandemie für sich ausgesprochen konstruktiv zu nutzen.“ Damit einhergehend steigt die öffentliche Präsenz von Selbstoptimierer_innen und vor allem auch der durch die fehlenden sozialen Kontakte entstehende Drang, die eigenen Erfolge in den sozialen Medien mit anderen zu teilen.
Selbstoptimierung und der dadurch resultierende Druck sind also kein neues Phänomen, wurden aber durch die Pandemie stark verschärft. Doch nicht alle haben die Möglichkeit, täglich ins Fitnessstudio für Sport, in die Bibliothek zum Lernen und in den Bio-Supermarkt für gesunde Ernährung zu gehen. Menschen, die neben dem Studium nicht arbeiten müssen und zuhause keine Betreuungspflichten haben, schaffen das viel wahrscheinlicher. Doch vor allem der erste Lockdown im März 2020 hat tiefe Gräben in der Gesellschaft gezogen. Die einen verlieren ihren Job, sind auf kleinstem Raum zuhause eingesperrt und müssen sich mit Zukunftsängsten herumschlagen, für die anderen fühlt es sich fast an wie Urlaub: Ein paar Monate zuhause sein, Zeit für Sport, gesunde Ernährung und sich selbst haben, im Studium weiterkommen. Es wird also klar: Selbstoptimierung ist Klassenfrage und wird durch die Pandemie verstärkt.
Doch woher kommt dieser Drang, sich ständig verbessern zu wollen und nicht gut genug zu scheinen? Die Wurzel befindet sich wie so oft in unserer kapitalistischen und neoliberalen Gesellschaft. Für jede_n brave_n Kapitalist_in ist das wahre Ziel im Leben das Streben nach individuellem Erfolg und persönlichem Reichtum. Nicht die Gemeinschaft, sondern das Individuum muss sich profilieren und nach den Sternen greifen. Um in einem solchen Weltbild Erfolge feiern zu können, ist es also notwendig, nicht in der Masse zu verschwinden, sondern herauszustechen, besser zu sein als die Leute um dich herum und keine Schwächen oder Nachteile zu zeigen. Nur so schafft man es an die Spitze. Doch für jede Person an der Spitze dieser neoliberalen Pyramide werden eine ganze Reihe an Personen an den Boden der Pyramide gedrückt, wo sie unter immer prekäreren Lebenssituationen leiden. Damit einhergehend: ein starker Abfall der mentalen Gesundheit.
Wenn man nun dieser neoliberalen Wertehaltung glauben möchte, ist also Selbstoptimierung die einzige Möglichkeit zum Erfolg. Um diese Theorie zu untermauern, wird oft die Erzählung des „American Dreams“ ausgegraben – jede Person kann es an die Spitze schaffen, wenn man sich fest genug anstrengt. Ob nun persönlicher Erfolg wirklich das einzige Ziel im Leben sein sollte, sei mal dahingestellt. Ein solches individualistisches Denken fördert nämlich kapitalistische Strukturen nur weiter.
Ein weiteres, riesiges Problem in dieser Denkweise ist, sind unterschiedliche Lebensrealitäten in unserer Gesellschaft. Denn wie schon angesprochen scheitert Selbstoptimierung für viele nicht an mangelndem Interesse oder Motivation. Notwendige Arbeitstätigkeit, Care Arbeit, Betreuungspflichten oder emotionale Arbeit sind für viele existenziell und nicht ablegbar.
Zusätzlich stellt sich die Frage, nach welchem „Optimalzustand“ überhaupt gestrebt wird. Denkt man an eine stereotypisch makellose Person, entspricht diese meist den folgenden Kriterien: jung, weiß, schlank, cis-hetero, able-bodied, sportlich, klug und gut ausgebildet. Dass diesem Bild der Großteil der Gesellschaft nicht entspricht, nicht entsprechen kann oder will, wird außer Acht gelassen. Außerdem wird damit der Eindruck geweckt, dass alle Personen, die diesen Kategorien nicht entsprechen, minderwertig seien und als Mensch so nicht ausreichend. Schnell wird also klar, dass Selbstoptimierung und das Streben nach Perfektion Hand in Hand mit diskriminierenden Vorurteilen gehen und Rassismus, Sexismus, Ableismus oder Queerfeindlichkeit fördern.
Solche Selbstoptimierungsprozesse sind immer an Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit gekoppelt. Wer nicht mithält, fällt weg. Für alle anderen heißt steigende Selbstoptimierung auch steigender Leistungsdruck und nicht einhaltbare Erwartungshaltungen.
An dieser Stelle wichtig zu erwähnen: Nicht alle, die gerne Sport machen, sich gesund ernähren oder gerne an sich arbeiten, sind schuld an sozialer Ungleichbehandlung. Wichtig ist jedoch, Selbstoptimierung im Zusammenhang mit den obigen Kategorien zu sehen und auf die mentale Last, die Selbstoptimierung mit sich bringt, hinzuweisen. Es ist wichtig, mit großer Entschlossenheit gegen individualistische und neoliberale Strömungen in unserer Gesellschaft vorzugehen.
Das Phänomen der Selbstoptimierung lässt sich jedoch nicht nur in der Freizeit und im privaten Raum wiederfinden, sondern auch an unseren Hochschulen. Auch hier führen Selbstoptimierung und der schnelle Erfolg von einigen wenigen Privilegierten zu massivem Leistungsdruck. Als im ersten Lockdown auch die Hochschulen geschlossen wurden, kam es österreichweit an den Universitäten zu einem deutlichen Anstieg der Prüfungsaktivität unter den Studierenden. Das heißt, dass mehr Studierende in derselben Zeit erfolgreich Prüfungen abgelegt haben. Da die Prüfungsaktivität in direkter Verbindung zum verfügbaren Budget der jeweiligen Hochschule steht, mag diese Zahl auf den ersten Blick erfreulich wirken. Mehr prüfungsaktive Studierende heißt demnach mehr Geld für die Hochschulen.
Leider konnte der Anstieg in der Prüfungsaktivität aber nicht durch einen Anstieg der Qualität der Lehre oder bessere Betreuungsverhältnisse erreicht werden und sich damit langfristig auf ein höheres Level begeben, sondern durch ein kurzzeitiges Ausquetschen der Studierenden durch Leistungsdruck und Zukunftsängste. Die Folgen davon wurden unter anderem durch die Studie von Univ.-Prof. Dr. Christoph Pieh festgehalten: Die Anzahl junger Erwachsener mit depressiven Symptomen stieg von fünf Prozent auf 50. Das ist ein Anstieg um das zehnfache in nur zwei Jahren.
Betroffen sind von diesen alarmierenden Zahlen überdurchschnittlich oft Studierende aus Arbeiter_innenfamilien. Also die, die sich oft nur durch zusätzliche Lohnarbeit das Studium finanzieren können. Dadurch lastet nicht nur der allgemeine Leistungsdruck an den Hochschulen auf ihnen, sondern auch die Zusatzbelastung durch das Arbeiten. Es bleibt weniger Zeit zum Lernen oder um auf die eigene Gesundheit zu achten. Sich mehr Zeit zum Studieren zu nehmen, klappt jedoch auch nicht. Denn wer das Studium nicht schnell genug abschließt, den erwarten teure Studiengebühren, die sich arbeitende Studierende meist nicht leisten können.
Die erhöhte mentale Belastung unter Studierenden wird nicht ganz unkommentiert gelassen. An den Unis gibt es nun schon seit 50 Jahren die Möglichkeit, psychologische Studierendenberatung in Anspruch zu nehmen. Deren Angebote sind für Studierende kostenlos und in diversen Universitätsstädten erhältlich. Der Andrang auf diese Stellen ist seit dem Sommersemester 2020 um ein Vielfaches angestiegen. Die Leiterin der Wiener Stelle für psychologische Studierendenberatung Dr. Katrin Wodraschke spricht von einem Bedarfsanstieg von einem Viertel. Da von der Regierung nur wenig Unterstützung gekommen ist, um diesen Bedarf decken zu können, haben viele Therapeut_innen Plätze aus eigener Tasche finanziert. Das ist zwar eine kurzfristige Hilfe, kann jedoch nicht dauerhaft aufrechterhalten werden. Leider fehlt bis heute noch immer die politische Antwort der Bundesregierung für die Deckung des gestiegenen Bedarfs.
Der einzige Weg, diese besorgniserregend hohen Zahlen zu beseitigen, ist es, geschlossen gegen Leistungsdruck, Selbstoptimierung und Klassismus an unseren Hochschulen, aber auch in unserer Gesellschaft, vorzugehen. Es braucht politische Antworten auf diese Zahlen. Kurzfristig bedeutet das zum Beispiel die Erhöhung von Kassenplätzen für psychologische Betreuung oder den Ausbau der psychologischen Studierendenberatung. Langfristig müssen unsere Hochschulen zugänglich für alle gemacht werden. Solange der Studienerfolg abhängig vom Geldbörserl der eigenen Eltern ist, werden Universitäten ein Ort der Eliten bleiben und alle anderen psychischem Druck aussetzen.
Schlussendlich ist es die Aufgabe der Politik, sich mit der Frage „und jetzt?“ auseinanderzusetzen. Die erschreckenden Zahlen zu mentaler Gesundheit sollten spätestens durch die Pandemie als Weckruf an die Verantwortlichen dienen. Es braucht sozialen Rückhalt, großflächig angelegte Verbesserungen in Studienplan, -alltag und in der Hochschulgesetzgebung. Nur so kann die Krise in der mentalen Gesundheit von Studierenden überwunden werden.