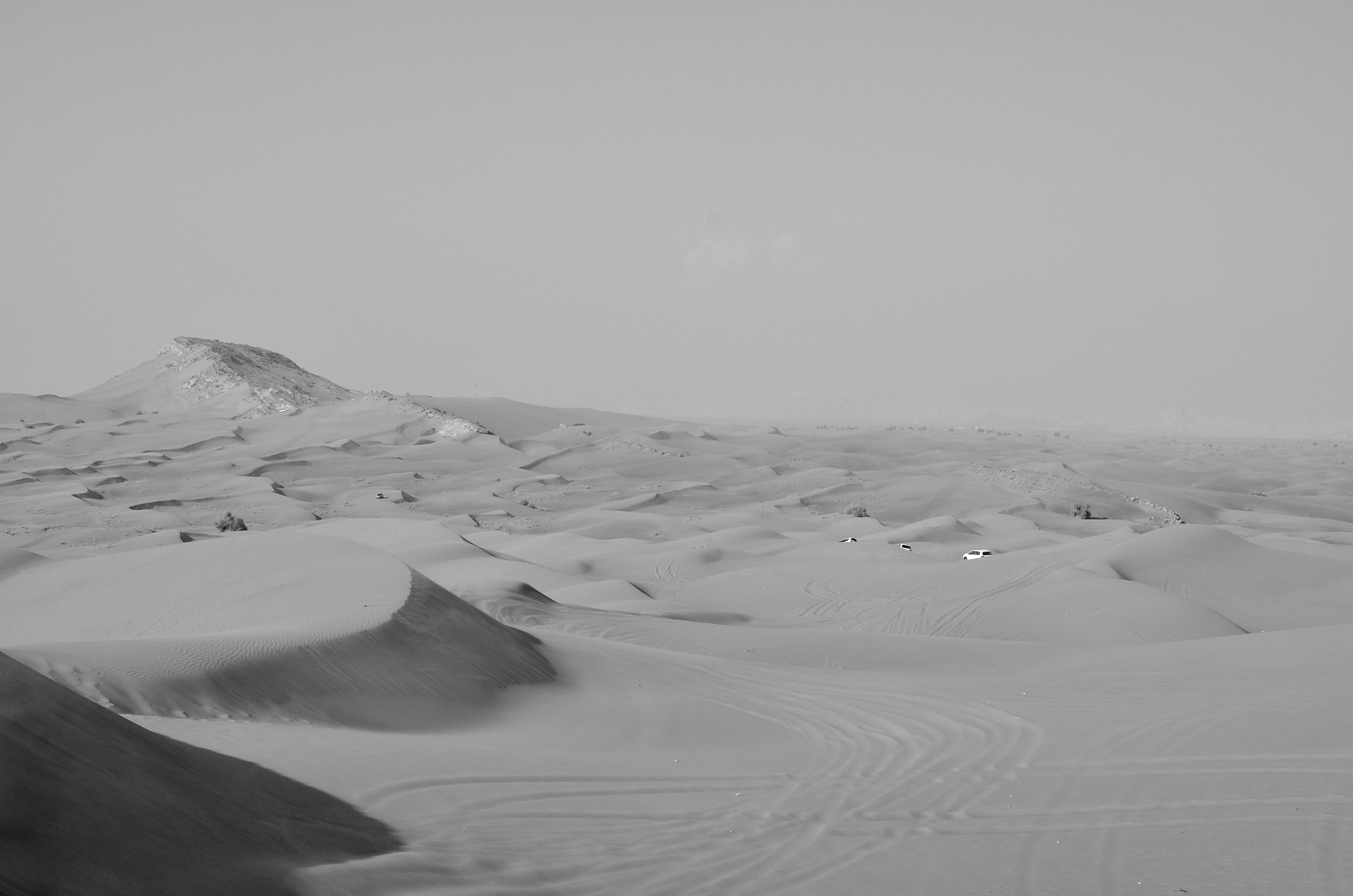CW: Schilderung von Rassismus
"Warum kann ich das nicht einfach alles machen?", habe ich oft mich selbst und meine Therapeutin gefragt. Warum fällt es mir so schwer zu studieren, zu arbeiten, politisch aktiv zu sein, mich um den Haushalt zu kümmern, Menschen auf WhatsApp zurückzuschreiben, auf Emails zu antworten und dann auch noch jeden Abend meine Zähne zu putzen? Warum bin ich die Einzige, die das nicht schafft? Woher weißt du, dass du die Einzige bist?, fragt dann meine Therapeutin. Weil niemand sonst darüber spricht. Sprichst du darüber? Nein. Warum nicht? Weil ich mich schäme. Weil ich denke, dass ich faul bin, dass ich kaputt bin, und mich dafür schäme, nicht einfach leisten zu können.
Produktivität hatte in meiner Welt immer höchstes Gebot: schnell und effektiv arbeiten, Geld verdienen, am besten alles gleichzeitig machen. Die anderen schaffen es ja auch. "Die anderen, die alles schaffen" waren sogenannte Productivity Influencer auf Instagram und YouTube, die ihr Geld damit machen, darüber zu reden, wie unheimlich produktiv sie durch Methode X und Y geworden seien. Dabei beginnt die Geschichte viel früher: Schon als Volksschulkind wusste ich, dass meine Leistung das ist, was schlussendlich zählt. Wer nicht leistet, versagt. Ist ja schließlich auch das Einzige, das benotet wird - nicht der Weg dorthin, oder die Mühe, die ich mir gemacht habe. Das zieht sich durch’s Gymnasium und wurde mir dann auch später im Studium von der Regierung so bestätigt; siehe UG-Novelle. Du schaffst keine Mindestanzahl an ECTS pro Semester? Was für ein_e Versager_in.
Forderungen wie “Leistung muss sich wieder lohnen”[1] tauchen immer wieder im politischen Diskurs auf und wirken wie ein perverses Verlangen, Leute in nützlich und nutzlos, wertvoll und wertlos einzuteilen. Leistung wird durch und durch romantisiert - zum Beispiel als Hustle Culture oder “THAT girl”-Ästhetik. Auch das Studierendenleben wird glorifiziert: möglichst lang in der Bib zu bleiben, um 4:30 Uhr aufstehen, um zu lernen, 12h lange “Study with me”-Livestreams auf YouTube. Die Kehrseite, Überanstrengung bis hin zum Burnout, wird dabei ignoriert.
Wer nicht leistet ist faul? Oft scheint mir, als gäbe es bei diesem Thema nur schwarz oder weiß. Entweder bringt man Leistung, arbeitet 40h oder mehr, erfüllt alles, was gesellschaftlich in diesem Lebensabschnitt erwartet wird - oder man ist faul. Ich unterrichte Deutsch für Menschen, die gerade erst nach Österreich gekommen sind, Menschen, die ausgewandert sind, aber auch Menschen mit Fluchterfahrungen. Manchmal höre ich dann: "Flüchtlinge sind faul. Sie sollen sich anstrengen, Deutsch zu lernen, sind ja schon seit Jahren hier." Ja, ich unterrichte auch Leute, die schon lange hier sind und kaum sprechen. Keine_r davon ist faul. Es sind Männer, die im Unterricht ganz still werden und merklich mit den Gedanken woanders sind; bei ihrer Familie, im Krieg, bei der Angst, nicht in Österreich bleiben zu dürfen. Das sind Stress und Trauma. Die Mutter, die seit elf Jahren in Österreich ist, aber ihre Hausübung nicht macht, weil keine Zeit dafür ist; neben ihrem Job als Putzkraft muss sie täglich zwei Mahlzeiten auf den Tisch bringen, den Haushalt machen und sich um ihre fünf Kinder kümmern. Sie fragt mich oft, wie sie das alles schaffen soll - ich wünschte, ich könnte es ihr sagen. Dann höre ich, wie wieder mal irgendein_e Politiker_in über die "faulen Flüchtlinge" schimpft, als würde die Person wissen, worüber sie spricht.
"Faul" ist ein Adjektiv, das ich eigentlich nur falsch verwendet höre. Meistens dann, wenn die Person nicht die ganze Situation kennt. Es ist so einfach, Leute als faul abzustempeln. Viel einfacher als Mitgefühl zu zeigen und versuchen zu verstehen.
Was ist Faulheit eigentlich? Faulheit ist laut dem Duden die Unlust, sich bei etwas zu betätigen.[2] “Faulheit” zählt auch als eine der sieben christlichen Todsünden, was uns zeigt, wie tief diese Angst vor der Faulheit in der westlichen Kultur verankert ist. Demnach ist in den vorher genannten Fällen nicht von Faulheit zu sprechen. In keinem der Beispiele waren die Personen unwillig, etwas zu tun.
Wirkliche Faulheit wäre also, gewollt weniger zu tun. Ich denke dabei an die Leute, die ich bei meinen unterschiedlichen Erfahrungen in der Arbeitswelt kennenlernen durfte. Leute in der Gastro, die ihre Leistung ihrem Gehalt anpassen. Wenn dieses unterirdisch gering ist, warum sollten sie sich schinden, wenn sie dafür nichts bekommen? Faulheit, die per Definition bewusst ist, kann auch eine aktive Rebellion gegen die Leistungsgesellschaft sein. Vielleicht ist sie gerade deshalb auch eine Todsünde - weil sie das System hinterfragt.
Faulheit ist ein Konstrukt, das versucht, uns ein schlechtes Gewissen zu machen, wann immer wir nichts “Nützliches” machen, nicht als produktiv gelten. Der Begriff “Produktivität” kommt eigentlich aus der Wirtschaft. Er beschreibt die Relation von Input und Output von Wirtschaftssystemen, wie Privathaushalten oder Unternehmen. Was gemeinhin als “Produktivität” bezeichnet wird, ist die “Arbeitsproduktivität” - die durchschnittliche Arbeitsleistung einer_s Mitarbeitenden innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Den Wert eine_rs Arbeitenden an der Produktivität zu messen, erfasst jedoch nie das ganze Bild. Menschen sind komplexe Wesen, und ihr Wert hängt nicht von ihrem Output ab.
Zeitverschwendung ist wichtig. Dinge, die gemeinhin als produktiv eingestuft werden, sind meistens damit verbunden, wie lukrativ sie sind. Side-Hustles sind lukrativ, Fantasybücher zu lesen ist es nicht. Pausen sind es nicht. Dabei ist es genau das, was wir brauchen, um uns zu erholen. Erholung ist keine Zeitverschwendung.
Auf Instagram scrollen, Netflix schauen, malen, mit Freund_innen telefonieren - all diese Dinge fühlen sich für mich wie guilty pleasures an, weil sie mir nichts “bringen”, im wirtschaftlichen Sinne. In einer idealen Welt wäre mir das aber egal - dann würde ich ohne Schuldgefühel tun, was mich glücklich macht. Kann denn etwas Zeitverschwendung sein, wenn es mir Freude bereitet? Menschen können nicht nur leisten. Menschen sind nicht dafür gemacht, durchgehend produktiv zu sein - wir brauchen Pausen und Auszeiten, um am Ende des Tages noch die Kraft zu haben, den Geschirrspüler auszuräumen und Zähne zu putzen. Man muss manchmal den Kopf ausschalten, um später wieder denken zu können.
Eine Art der Zeitverschwendung ist die Prokrastination. Meine Freund_innen höre ich oft über sich selbst schimpfen, weil sie “schon wieder prokrastinieren”, sie sind frustriert, nennen sich faul - Schuld und Scham drehen sich im Kreis. Dabei hat Prokrastination meistens einen Grund.[3] Es gibt Barrieren, warum wir gewisse Dinge nicht einfach so erledigen können. Es ist wichtig, diese Barrieren zu erkennen und zu benennen und sie nicht einfach als Faulheit abzustempeln. Dazu müssen wir mehr Nachsicht und Mitgefühl mit uns selbst haben, weil sie sonst niemand mit uns hat. Diese Barrieren sind ohne Schuldzuweisungen anzugehen, sondern mit Neugierde.
Prokrastination beispielsweise rührt oftmals aus der Angst, nicht gut genug zu sein. Oder sie ist ein Zeichen von Überforderung - nicht zu wissen, wo man anfangen soll. Ablenkung ist dann einfacher: schnelles Dopamin durch Instagram Reels zum Beispiel.
Universitäten sind keine Ausnahme. Der Drang nach Produktivität zieht sich durch jeden Teil unseres Lebens. Um dieses Problem langfristig zu lösen, müssen wir gegen die kaptitalistischen Denkweisen und das System selbst gehen. Wir können mit dem anfangen, was uns am nächsten ist: die Universitäten.
Das akademische Umfeld in Österreich bietet wenig Spielraum für die unterschiedlichen Kontexte, in denen wir uns als Studierende zurecht finden müssen. Seien es Arbeit, Pflegeverpflichtungen, Stress, Anxiety, Traumata - um nur einige zu nennen. Kaum jemand ist nicht betroffen und jede_r Studierende ist vor individuelle Herausforderungen gestellt. All diese Umstände können als Barrieren fungieren, die uns davon abhalten, im Studium aufzublühen. Das sollte aber Platz haben. Das heißt nicht, dass Noten geschenkt werden sollten - bereits einfache Anpassungen wie eine “No questions asked 48h Verlängerung” für Abgaben können bereits viel bewirken.
Ein Appell an Universitäten: Habt Empathie gegenüber euren Studierenden. Ein erfolgreiches Studium sollte nicht davon abhängen, wie frei von Altlasten eure Studierenden sind. Professor_innen sind oft Leute, denen die akademische Arbeit immer leicht gefallen ist. Diese gilt es zu überzeugen: Nur weil ihr in diesem System aufblühen konntet, heißt das nicht, dass eure Studierenden das genauso können. Wer jetzt davon anfängt, dass jene, denen das Studieren schwer fällt, nicht dafür gemacht seien, sollte kurz über dieses Statement nachdenken. Dürfen Leute mit Trauma nicht studieren? Sollte Menschen mit einer mentaler Krankheit der Abschluss verwehrt werden? Ich rede nicht davon, das Studieren inhaltlich “einfacher” zu machen. Ich rede davon, das Studieren so zu strukturieren, dass es für diese Personen machbar wird. "If a student is struggling, they probably aren't choosing to", schreibt Sozialpsycholog_in Devon Price.[4]
Das ist kein individuelles Problem, sondern hat System. Es ist Hustle-Culture und Late Capitalism, aber das hilft nicht viel im Moment. Was ist jetzt zu tun? Wenn wir uns für unsere eigene “Faulheit” verurteilen, dann handelt es sich dabei nicht um Faulheit, sondern um ein Hindernis, bei dem wir Unterstützung brauchen. Das kann sich als Prokrastination äußern und ist nicht zu verurteilen. Es ist wichtig, uns selbst Pausen zu erlauben, unsere Umstände zu erkennen und uns nicht schlecht dafür zu fühlen. Aktiv “Zeit zu verschwenden”, um unserem Gehirn eine Pause zu lassen. Leistungsdruck kritisch zu betrachten und zu hinterfragen, was als produktiv eingestuft wird und was nicht. Aktiv faul zu sein. Forderungen an Universitäten und Institutionen einzubringen.
Es hat lange gebraucht, bis ich aufgehört habe, mich dafür zu schämen, keine Maschine zu sein;meinen Selbstwert nicht von meiner Leistung abhängig zu machen und mir ein Recht auf Menschlichkeit einzugestehen, wie u.a. mal eine Pause zu brauchen oder nicht durchgehend leistungsfähig zu sein. Crazy, ich weiß. Mein Appell an Empathie geht nicht nur an Universitäten: Es gibt noch genug Leute, die an Faulheit glauben und diesen Begriff falsch verwenden. Merksatz: Wenn wir eine Person als "faul" einstufen würden, sehen wir höchstwahrscheinlich nicht das ganze Bild. Und anstatt diese Person dann in die praktischen Schubladen “nützlich” und “nutzlos” einzuteilen, könnten wir diesen Moment nutzen, um Empathie zu zeigen.
Eluisa Kainz ist 22 Jahre alt und studiert Business & Economics an der Wirtschaftsuniversität Wien.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Laura Wiesböck: „Leistung muss sich wieder lohnen“, Momentum Institut 10.09.2019, https://www.momentum-institut.at/news/leistung-muss-sich-wieder-lohnen
https://www.duden.de/rechtschreibung/Faulheit
Olubusayo Asikhia: "Academic Procrastination in Mathematics: Causes, Dangers and Implications of Counselling for Effective Learning", in: International Education Studies 3(3), Juli 2010, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1066019.pdf
Devon Price: “Laziness does not exist”, Medium 23.03.2018,https://humanparts.medium.com/laziness-does-not-exist-3af27e312d01