Mein vergessener Nachbar
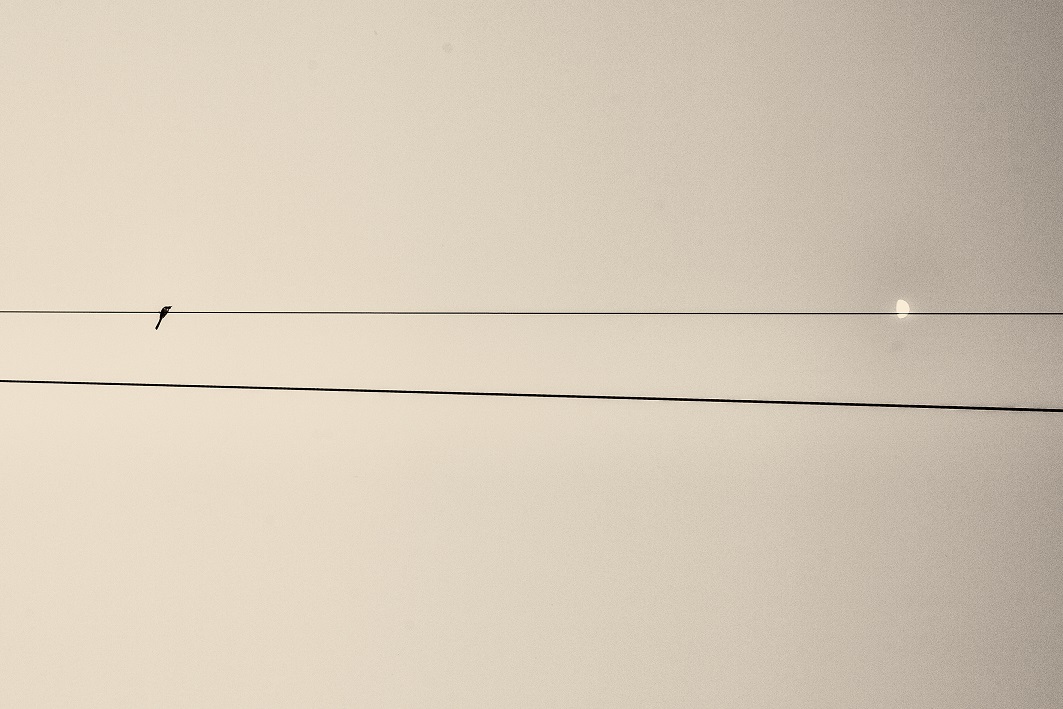
Darf ich persönlich werden?
Ich ertappe mich gerade dabei, wie ich vor dem Anschlussdenkmal in Oberschützen (Südburgenland) davonlaufe. Es ist Gefahr im Verzug – es regnet und blitzt – und dieses Denkmal überragt alles rundum. Auf österreichischem Boden ist es das größte seiner Art, acht Meter hoch. Zum Glück haben die Sowjettruppen beim Einmarsch den gigantischen Reichsadler inmitten des Denkmals mit einer Panzerabwehrrakete vom Sockel geschossen. Jetzt würde das metallene Vieh doch nur die Blitze anziehen. Nach dem Krieg wurde lange über den Abriss des optisch wirklich ansehnlichen Gemäuers debattiert, es wurde 1997 zum Mahnmal umbenannt. Ob es aus Mahnung hier immer so blitzt? Es braucht keinen acht Meter hohen Säulenhof, um nachkommende Generationen vor Unrecht zu warnen – das wird in Jabing klar. Von Oberschützen geradeaus durch Oberwart, bei der Ziegenherde abbiegen und bis kurz vor die Kirche fahren. Auf zwei Holzplanken hat man drei metallene Bretter montiert. Das spartanische Gebilde wird durch ein Holzstück am Boden abgerundet, auf dem eine Kerze brennt – eine zweite tut’s nicht. Das ist das Denkmal an die Roma und Romnija aus Jabing. Mindestens 77 waren es, die verschleppt und ermordet wurden, gerade einmal fünf Überlebende sind dokumentiert. Ihre Namen zieren die erste Gedenktafel. Auf der zweiten findet man überwiegend den Nachnamen Horvath und das Wort Auschwitz. Auf der Dritten stehen die elf Namen jener Jabinger Romnija und Roma, deren Schicksal ungeklärt ist. Kurz ist die Liste nicht. Jene der Gefallenen beim Kriegerdenkmal ist bei weitem kürzer. Obwohl das Roma-Denkmal noch provisorisch ist, merkt man: Jabing gedenkt seiner Bewohner_innen, die fehlen. Die fehlen! So steht’s auf der Tafel. Die optische Aufwertung des Gedenkortes wird mit der Renovierung des Kirchenvorplatzes einhergehen. Am Ende soll das Denkmal so aussehen wie die Gleise, die die Volksgruppenangehörigen in den Tod transportiert haben. Echte Gleise, 150 Kilo das Stück. Meine Heimatgemeinde Großwarasdorf hat ein Geheimnis. Ich wusste es sehr lange nicht. Im Ortsteil Langental befand sich vor dem Zweiten Weltkrieg die größte Roma-Siedlung des Mittelburgenlandes. Die Bezirksbzw. Landeshauptmannschaft und auch die Gendarmerie versuchten die Zahl der Roma schon vor der NS-Zeit zahlenmäßig zu erfassen. Vertreter der Gemeinden, des Landes, der Justiz und der Gendarmerie debattierten 1933 (sic!) über die Lösungen der „Zigeunerplage“ – ihre Ideen reichten von Deportation auf irgendeine Insel, bis zur Ermordung und massenhafter Sterilisation. Die Geschichte der Unterdrückung der Roma und Romnija beginnt nicht mit dem Nationalsozialismus und hört auch nicht mit ihm auf. Wer sich eingehender damit beschäftigen will, dem lege ich die Arbeiten von Gerhard Baumgartner ans Herz. Der Historiker ist wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands und gab dieser Recherche ein ausführliches Hintergrundgespräch. 1936 gab es 187 registrierte Roma und Romnija in Langental und sie stellten in dem Ortsteil die Mehrheitsbevölkerung. Heute ist es dort idyllisch. Kleine Häuser stehen entlang dreier Straßen und ehe man sich versieht, ist man an ihnen und den 89 Einwohner_ innen vorbeigefahren. Der Großteil sind Zugezogene, die hier unwissend ihre Pension verbringen. Vor der Mini- Kirche steht ein Stein. Er besagt, dass der Verschönerungsverein diesen Platz designt hat. Ich hätte mir eine andere Aufschrift erhofft. Ein paar Meter weiter steht das Kriegerdenkmal. Unterhalb der Namen der Gefallenen wurde eine zweisprachige Zusatztafel angebracht: „Wir gedenken an dieser Stelle auch all jener Mitbürger, die in dieser schrecklichen Zeit des Krieges auf andere Weise ihr Leben lassen mussten. Na spominak i za sve, ki su u tom času na drugi način njev žitak zgubili.“ Auf Wikipedia wird man aus diesem kryptischen Satz (natürlich) nicht klüger, auch die Ortschronik von Großwarasdorf „vergisst“ auf die Mitbürger_innen, die auf andere Weise ihr Leben ließen.
Also nicht gefallen? Nicht normal verstorben? Und wer überhaupt? Meine verstorbene Großmutter, einst mit der naiven Frage konfrontiert, warum die Roma und Romnija weggebracht wurden, antwortete meinem Vater, sie seien mit LKWs weggebracht worden, da sie etwas gestohlen hätten. Mehr schien sie nicht gewusst zu haben. Das Roma-Zeitzeug_innen-Projekt Mri Historija (die Aufnahmen sind auf Youtube zu finden) spricht eine deutlichere Sprache. Der Langentaler Rom Adolf Papai schildert darin auf Romanes, wie seine Familie 1941 ins „Zigeuner- Anhaltelager Lackenbach“ – es lag ein paar Kilometer weiter weg – gebracht wurde: „Ich habe einen kleinen Hund gehabt und ich habe den Hund nicht hergegeben. [...] Und wir sind runter vom Auto, und ich habe den Hund nicht ausgelassen. Und dann hat einer den Hund, den armen Hund, bei den Hinterbeinen genommen und mich mit ihm so lange geschlagen, bis ihm die beiden Hinterbeine in den Händen geblieben sind.“ Je tiefer ich in diese Materie eintauche, umso trauriger stimmt sie mich. Wie würde das Leben in der Gemeinde aussehen, wenn es hier noch immer 200 Roma-Angehörige gäbe? Würde ich mich mit ihnen verstehen? Michael Schreiber, ein befreundeter Historiker, meint, der Antiziganismus wäre dann wohl viel stärker als er ist. Für die burgenländische Forschungsgesellschaft beschäftigt Schreiber sich insbesondere mit der jüdischen Geschichte – eine Zeit lang hatte er Alpträume von Vertreibung. Das hätte aber aufgehört. Alptraum hatte ich noch keinen. Im Standesamt wird auf Kroatisch zur Hochzeit eines jungen Paares angestimmt. Ein paar Minuten später ist auch der Bürger_innenmeister der Gemeinde Großwarasdorf/Veliki Borištof im Haus. Eigentlich hat Rudi Berlakovich (ÖVP) einen Gemeinderatsbeschluss, der ein Denkmal für die verschleppten und ermordeten Roma von Langental/Longitolj vorsieht. „Ich habe auch angeboten, dass eine Gedenktafel in Langental aufgestellt wird. Ich wurde aber von den dort wohnenden Roma gebeten, davon Abstand zu nehmen.“ Das ist ein Sonderfall. Zwei Familien gäbe es noch, die Nachfahren der während des Nationalsozialismus verschleppten Roma und Romnija seien. Als Kind habe der Bürger_innenmeister auch mit ihnen in Langental Fußball gespielt, aber viele seien es damals nicht mehr gewesen. Ich verstehe ihn, er will den Angehörigen nichts aufoktroyieren. Ein Telefonat mit einem der Angehörigen bleibt kurz. Er möchte Ruhe. Ein Denkmal interessiere ihn nicht.
Soll man das Kapitel Aufarbeitung so beenden?
Ohne jemandem zu nahezutreten, wünsche ich mir, dass etwas passiert. Der Langentaler Adolf Papai hatte einst – so schildert es der Vorsitzende des Volksgruppenbeirats der Roma und Sinti, Emmerich Gärtner-Horvath – die Idee, Gedenktafeln anzubringen. Papai ist 2012 verstorben und in seiner Heimatortschaft Langental wird, sofern sich die Meinung der Angehörigen selbst nicht ändert, nicht viel passieren. In der Gemeinde gäbe es andere Möglichkeiten. Papais Vater wurde nach Buchenwald deportiert und dort ermordet, doch Adolf Papai selbst hat das Anhaltelager in Lackenbach gemeinsam mit seiner Schwester und seiner Mutter überlebt, da sie 1943 der Graf Niczky in Nebersdorf (ebenfalls ein Ortsteil der Gemeinde Großwarasdorf) aus dem Lager herausgenommen und so ihr Leben gerettet hat. Papai hat bei ihm Kühe gehütet und mit dem Holz geholfen. Niczky habe auch viele Roma und Romnija, die er gar nicht zum Arbeiten gebraucht habe, so aus dem Lager geholt. Hätte der Graf eine
Ehrung verdient? Langental ist bei weitem nicht der einzige Ort des Mittelburgenlandes gewesen, wo Roma und Romnija lebten. Die zweithöchste Zahl an Roma und Romnija gab es 1933 in Liebing (85), dann Oberpullendorf (67) und Kleinmutschen (63). In über zwanzig Ortschaften wurden 1936 Roma und Sinti registriert. Meistenorts gibt es heute keine Volksgruppenangehörigen mehr, auch ihre Siedlungen wurden geplündert und zerstört. Aber das muss kein Hindernis für Engagement sein. Als Gerhard Baumgartner vom DÖW gemeinsam mit anderen Aktivist_innen Anfang der 80er den ermordeten Roma und Romnija des Burgenlandes ein provisorisches Denkmal neben das Oberwarter Kriegerdenkmal stellte, wurde es trotz „Luftlinie zum Polizeikommissariat 50 Meter“ über Nacht zerstört. Der mediale Aufschrei war groß, aber die Gesellschaft vor Ort hatte etwas gegen das Denkmal.
Heute ist das anders.
In Jabing steht ein Roma-Denkmal, da sich der 27-jährige Theologe Jakob Frühmann u.a. in einer Diplomarbeit mit den verschwundenen Mitbürger_innen seiner Gemeinde befasst und fürs Gedenken eingesetzt hat: „Vor allem vor der Enthüllung hat’s einiges an Aufruhr gegeben, aber das ist nicht direkt zu mir durchgedrungen, sondern über mehrere Ecken“. Teile der Bevölkerung hätten eine Aufstellung als Anklage gesehen oder auch eine Schuldverstrickung ihrer Familie befürchtet – vor allem aus Unwissen gegenüber der Vergangenheit. „Oder ganz einfach, da in Bezug auf Roma und Sinti weiterhin starke Rassismen am Werken sind“, so Frühmann. Doch als das Denkmal im Herbst enthüllt wurde und im März auch noch sein Buch in Jabing präsentiert wurde, habe er unheimlich viel Zuspruch bekommen – „ohne, dass die Aufarbeitung damit fertig wäre.“ Abschließend fahre ich zum Mahnmal des Roma-Anhaltelagers in Lackenbach. Ein Stück der Landstraße, auf der ich fahre, haben die Internierten unter härtesten Bedingungen gebaut. Die, die nicht deportiert wurden, hatten Zwangsarbeit zu leisten. Google Maps findet das Mahnmal nicht. Vor Jahren war ich hier, als Bundespräsident Heinz Fischer einen Kranz niederlegte. Letzten Herbst hat es Alexander Van der Bellen auch getan. Ich schaue mit trübem Blick darauf. Hinter mir fährt ein kleiner Bub auf seinem Rad und prahlt mit Wheelies. Ich würde ihm gern etwas sagen, aber es kommt nichts raus. In Gedanken bin ich bei der Aussage Gärtner-Horvaths, dass viele nicht wüssten, wo sie an ihre Angehörigen denken sollen, wenn’s am Friedhof nicht einmal ein ordentliches Grab gibt. Deswegen ist der Friedhof in Langental so ausgesprochen leer!
„Brauchst a Kerze?“, hör' ich wen sagen. Aber der Bub mit dem Rad ist weg.
Konstantin Vlasich studiert Internationale Entwicklung an der Universität Wien.




