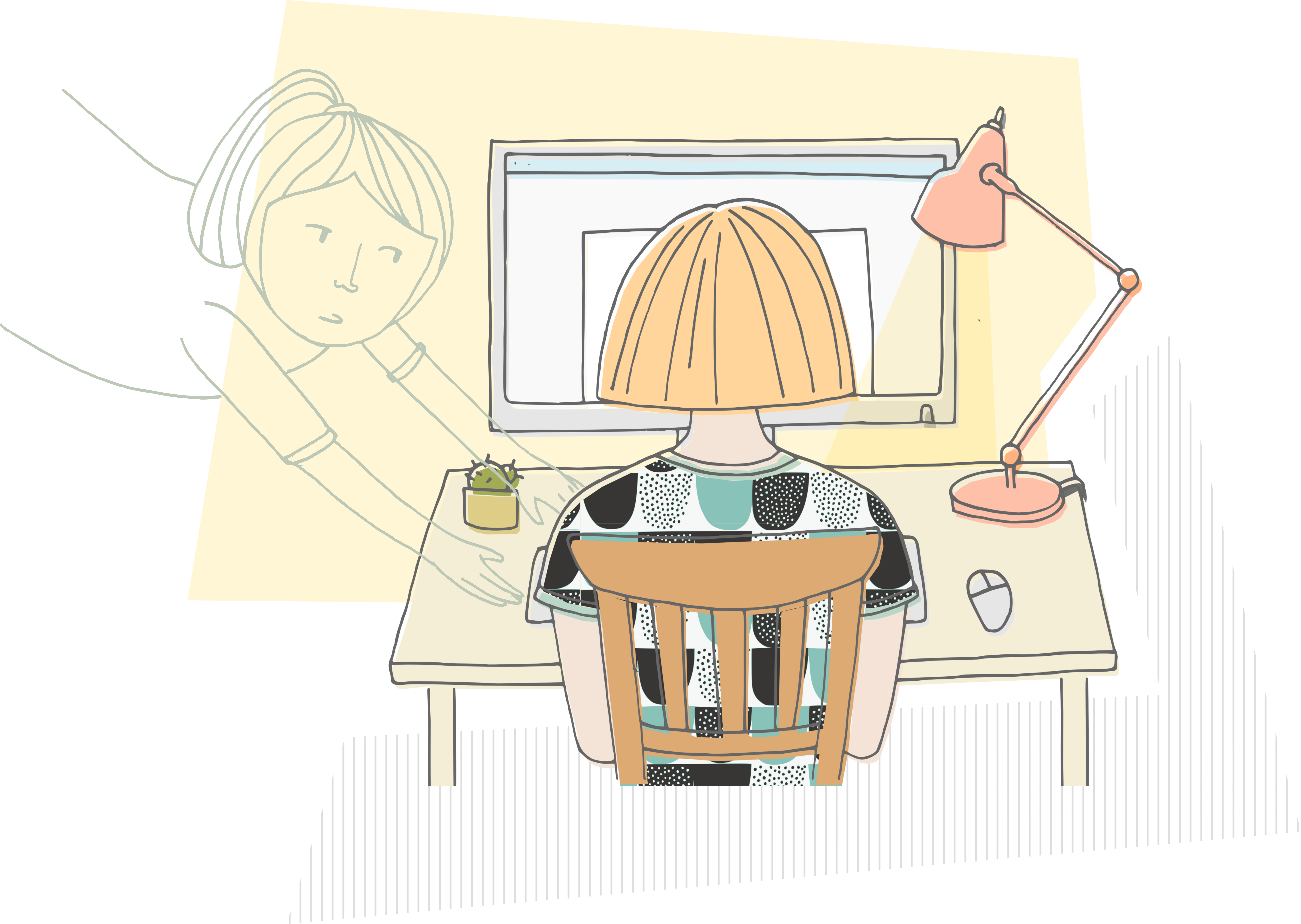Existenzieller Deutschkurs – dreimal so teuer Österreich will internationale Hochschulen, präsentiert sich als offen und zugänglich für alle. Leider liegt zwischen Idee und Realität eine Welt voller Hürden und Beschränkungen.
Die Problematiken, mit denen Drittstaatsangehörige konfrontiert sind, die in Österreich studieren wollen, geraten kaum in den Blick öffentlicher Debatten. Selten werden Betroffene gefragt, welche bürokratischen Hürden sie zu überwinden haben, um hier studieren zu können. Täglich sind wir als Referat für ausländische Studierende der Bundesvertretung der ÖH mit dieser Problematik konfrontiert und versuchen künftige und gegenwärtige Studierende dabei zu unterstützen, ein Studium in Österreich zu beginnen, oder ein bereits begonnenes Studium abzuschließen.
BÜROKRATIE. Der Weg durch die Bürokratie ist lang und entsprechend aufwändig. Zunächst erfolgt die Anmeldung auf einer österreichischen Universität mit Reifeprüfungszeugnis und Studienplatznachweis. Im Falle eines positiven Zulassungsbescheids (die zuständigen Stellen benötigen etwa 12 Wochen für die Bearbeitung) müssen die angehenden Studierenden einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel stellen. Den Antrag für Studierende stellt man, sofern man visumfrei nach Österreich anreisen darf, in der MA 35, wenn nicht, muss der erste Antrag in einer österreichischen Botschaft gestellt werden. Zu erwähnen ist, dass es in manchen Ländern keine österreichische Botschaft gibt und Betroffene daher in benachbarte Länder einreisen müssen, um einen Antrag auf ein Visum für Österreich zu stellen. Auch in den Behörden der Herkunftsländer beträgt die Wartezeit einige Wochen. Erst wenn von der Botschaft ein sogenanntes „Visum D“ ausgestellt wird, ist die Einreise nach Österreich und die persönliche Inskription an der Universität möglich. Man kann sich vorstellen, dass das alles enorm viel Geld und Zeit kostet, zumal dieser steile bürokratische Weg nicht mit der Ankunft in Österreich endet. Nachdem man bereits im Herkunftsland von einem Magistrat ins andere gegangen ist, die erforderlichen Dokumente besorgt hat, übersetzen, abstempeln und beglaubigen ließ, setzen sich diese Strapazen in Österreich in ähnlicher Weise fort. Anträge für die Verlängerung von Visa und ständige Besuche in der MA 35 stehen auf der Tagesordnung. Unsicherheiten entstehen häufig durch die vielen unterschiedlichen Nachweise, die Drittstaatsangehörige erbringen müssen, um an einer österreichischen Hochschule studieren zu dürfen. Auf Unverständnis trifft beispielsweise der sogenannte Studienplatznachweis; eine Bestätigung dafür, dass die betreffende Person, die ein Studium in Österreich anstrebt, das gewünschte Studienfach auch auf einer anerkannten Hochschule in ihrem Herkunftsland studieren könnte.
[[{"fid":"2279","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Foto: Christopher Glanzl"},"type":"media","attributes":{"title":"Foto: Christopher Glanzl","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
Ausländische Studierende, besonders jene aus Drittstaaten, haben einen langen Weg hinter sich und kommen meist aus Ländern, in denen das durchschnittliche Monatseinkommen unter 500 Euro liegt. Im Vergleich zu Studierenden aus EU Ländern müssen sie Studiengebühren in der Höhe von 380-740 Euro pro Semester zahlen, dürfen aber gleichzeitig nicht mehr als zehn Stunden pro Woche arbeiten. Vom Bezug von Studienbeihilfe sind sie ausgeschlossen. Ausländische Studierende müssen jährliche Leistungsnachweise bei der MA 35 in der Höhe von 16 ECTS Punkten erbringen, sonst dürfen sie nicht in Österreich bleiben. Der finanzielle Aufwand ist also um ein vielfaches Höher, als für österreichische Studierende und hier sprechen wir noch nicht einmal von Lebensunterhaltskosten, die wir ja alle zahlen müssen. Im Endeffekt läuft dies darauf hinaus, dass nur Personen für ein Studium nach Österreich kommen können, deren Eltern die hohen Kosten dafür decken können.
SPRACHE MACHT INTEGRATION AUS. Das Bundesministerium für Äußeres betont im Bereich Integration die Notwendigkeit der Beherrschung der deutschen Sprache, ohne die eine Teilhabe an der Gesellschaft beinahe unmöglich scheint: „Das Erlernen der deutschen Sprache und die Akzeptanz unserer demokratischen Werte und Rechtsordnung sind zentrale Eckpunkte einer erfolgreichen Integration. Diese Grundpfeiler der Integration sind unabdingbare Voraussetzungen für die aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft – ohne dabei die eigenen Wurzeln leugnen zu müssen“. Kurz gesagt sind wir ohne Sprache, mit der wir uns in einem bestimmten Raum, Land, in einer bestimmten Gruppe verständigen können, VERLOREN, NICHT ZUGEHÖRIG, NICHT FÄHIG. Sprache macht uns zu Menschen, bietet uns die Möglichkeit unser Denken zu erweitern, Fragen zu stellen und diese analytisch zu beantworten, die Möglichkeit weiter zu lernen und uns weiter zu entwickeln. Wenn ihr es so wollt, bietet uns auch die Möglichkeit, uns in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Da die Sprache enorm wichtig ist, sollten nicht-deutschsprachige Studierende die Möglichkeit haben, finanziell tragbare Deutschkurse zu besuchen, um sich damit auf ihr Studium vorbereiten zu können.
Der Vorstudienlehrgang der Wiener Hochschulen (VWU), welcher mit der Vorbereitung ausländischer Studierender auf ein Studium in Österreich beauftragt ist, existiert schon sehr lange, genau gesagt seit 1962. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen den sechs größten Hochschulen in Wien (Uni Wien, TU, WU, BOKU, MedUni, VetMedUni) und dem ÖAD (Österreichischer Austausch Dienst). Ziel ist es, für die Studierenden, die aus nicht deutschsprachigen Ländern kommen, unter anderem auch Deutschkurse anzubieten. An sich ist das Projekt sehr gut und hilfreich.
Wien ist eine Stadt, die durch Migration wächst. Diese Tatsache ist schon seit vielen Jahren bekannt. Auch an Wiener Hochschulen steigt die Zahl ausländischer Studierender von Jahr zu Jahr. Aus diesem Grund hat sich der VWU mit den Wiener Hochschulen zusammengesetzt und beschlossen, die bisherige Arbeitsweise zu reformieren.
[[{"fid":"2280","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Foto: Christopher Glanzl"},"type":"media","attributes":{"title":"Foto: Christopher Glanzl","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
VWU NEU. Die Überlegungen, den VWU neu zu gestalten, gehen auf das Jahr 2013 zurück, in dem eine Diskussion zwischen dem VWU-Komitee und den Wiener Hochschulen stattfand. Es ging darum, die Vorstudienlehrgänge vor allem im Hinblick auf die Qualität zu verbessern, wie zum Beispiel einheitliche Inskriptionsfristen für alle DeutschkursanbieterInnen festzulegen, die Qualität der Unterrichtseinheiten zu verbessern, oder die Übungseinheiten aller KursanbieterInnen zu vereinheitlichen. Der VWU benötigte außerdem neue KooperationspartnerInnen, da zusammen mit der Österreichischen Orientgesellschaft (ÖOG) nicht genügend Kursplätze für alle Studierenden zu Verfügung gestellt werden konnten. Ende 2015 kamen zwei DeutschkursanbieterInnen hinzu: das Sprachzentrum der Uni Wien und „die Berater“.
Theoretisch klingt das Projekt VWU Neu gut und hilfreich für alle, die zum Studieren nach Österreich kommen wollen. Es stellt sich bei diesen Umstrukturierungen jedoch auch die Frage, wie die Qualitätsverbesserung finanziert werden soll und ob die für Drittstaatsangehörige existenziellen Deutschkurse erschwinglich bleiben.
Finanziert wird der VWU zum einen vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, zum anderen durch die Kursgebühren der TeilnehmerInnen, die sich bis jetzt auf 460 Euro pro Person und Semester beliefen. Im Zuge der geplanten Umstrukturierung des VWU, werden die Preise nun auf 1.150 Euro pro Semester erhöht, also fast das Dreifache. Das ist natürlich ein Schock für diejenigen, die jetzt schon am Existenzlimit leben.
WAS BETROFFENE DARÜBER DENKEN. Um auch die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen, haben wir Statements von jenen Drittstaatsangehörigen gesammelt, die den VWU besuchen. Über die künftige Verteuerung herrscht Unmut. „Viele Leute könnten es sich dann nicht leisten, in Österreich zu studieren“ bringt Muhamed aus dem Iran die Problematik auf den Punkt. Asaf aus Aserbaidschan meint “Wir haben keine Alternative, wir müssen jetzt zahlen, wir können nirgendwo anders hingehen“. Auch über die Gründe der steigenden Preise stellen unsere GesprächspartnerInnen Vermutungen an. Mirela aus Bosnien und Herzegowina sagt: “Die wollen uns hier nicht haben, ich fühle mich nicht willkommen. Sie wollen damit die Einwanderung stoppen”. Ein türkischer Student in Wien kommentiert: “Wenn die FPÖ in der Regierung ist, werden sie dieses Problem sowieso von den Wurzeln an lösen. Dann wird es weit und breit keine Kurse geben”. Ein anderer Gesprächspartner meint: „Das ist eine traurige Nachricht. Ich hoffe der Grund dafür ist nicht, dass sie eine höhere Bildung für ausländische Studierende in Österreich unmöglich machen wollen”.
[[{"fid":"2281","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Foto: Christopher Glanzl"},"type":"media","attributes":{"title":"Foto: Christopher Glanzl","class":"media-element file-default"}}]]
Personen, die zum Studieren nach Österreich kommen und den VWU besuchen, befinden sich bereits in einer prekären Situation, was das Arbeitsrecht und das Studienbeihilferecht betrifft. Eva aus Österreich, die eine amerikanische Matura hat und noch einige Ergänzungsprüfungen absolvieren muss, findet die Situation „ziemlich frustrierend“ und weiter: „Auch jetzt sind VWU-Kurse teuer. Die Leute bekommen wenig Geld von den Eltern, müssen arbeiten. Ich arbeite auch, um mir den VWU zu leisten.“ Firas aus dem Iran erinnert sich: “Ich kenne Leute aus dem Iran, die nach ein oder zwei Jahren zurück mussten, weil sie kein Geld von ihren Eltern bekommen. Es gibt viele Personen, die sich in den Unterrichtsstunden nicht konzentrieren können, weil sie sich um andere Sachen kümmern müssen und andere Probleme haben, Probleme mit Geld zum Beispiel“.
UNLEISTBAR: VIELE KONSEQUENZEN. Aufklärung und die Bereitschaft die Studierenden genauer darüber zu informieren, warum die Deutschkurspreise dermaßen erhöht werden, ist kaum bis gar nicht vorhanden. Die betroffenen Studierenden an die VWUWebseite zu verweisen, führt vor allem zu Verwirrung und Unsicherheit.
Die VWU-Kommission beteuert natürlich, dass sich das Geld auszahlen wird und behauptet, dass man die Deutschkurse von nun an in zwei Semestern schaffen kann. Daran zweifeln Studierende wie Aman aus Ägypten, den wir bei der Vorbereitung auf die VWUPrüfungen mit unseren Fragen gestört haben: “Man kann es nicht in zwei Semestern schaffen, es ist zu wenig Zeit”. Noch schlimmer wird es wohl werden, wenn Studierende das Gefühl haben, dass sie nicht erwünscht sind.
Sprache ist eine wichtige, existenzielle Ressource für jeden Menschen. Diese Ressource ist notwendig für ausländische Studierende, die nach Österreich kommen, weil sie die Türen zu einer höheren Bildung öffnet. Schließen wir die Türen, machen wir die Deutschkurse unerschwinglich, dann schließen wir gleichzeitig den Zugang zu den Hochschulen und damit den Zugang zur freien Bildung.
Aylin Bademsoy studiert Germanistik und Philosophie, Kanita Halkic studiert Soziologie an der Universität Wien. Beide sind im Referat für ausländische Studierende auf der ÖH-Bundesvertretung tätig.
Kontakt:
auref@oeh.ac.at
oeh.ac.at/referate/referat-fuer-auslaendische-studierende