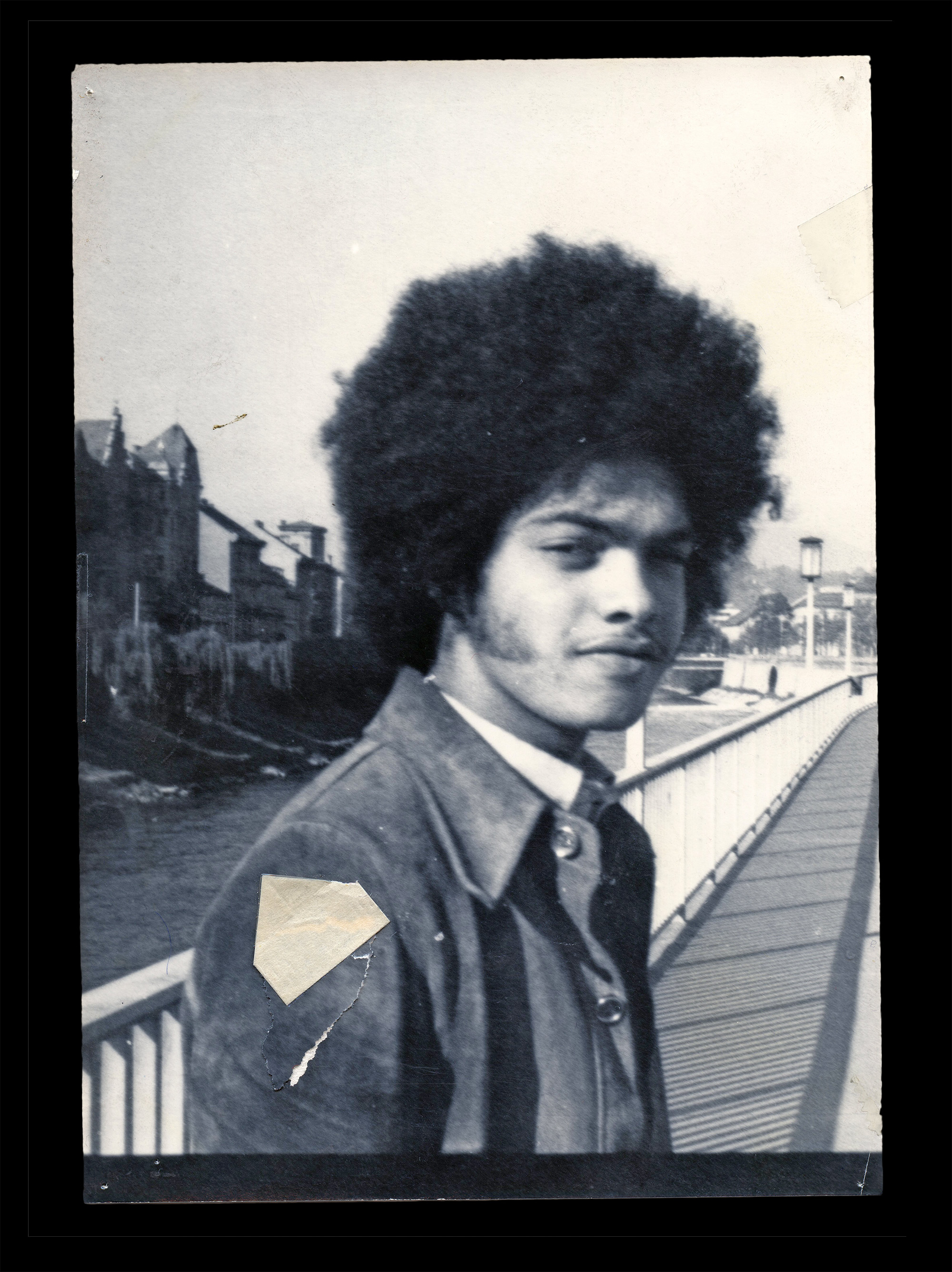Gesprochen, Gehört, Gezeichnet

Es ist schon merkwürdig. Hier wird Literatur gesprochen, gezeichnet, gehört und angeschaut. Trotzdem bleibt nach dem Besuch der Ausstellung „Bleistift, Heft & Laptop“ vor allem eines: das starke Verlangen zu lesen, lesen, lesen.
Die erste Sonderausstellung im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek, das 2015 eröffnet wurde, versammelt „10 Positionen aktuellen Schreibens“ (österreichischer Schriftsteller_innen) in den dunklen Holzregalen des ehemaligen k.u.k. Finanzarchivs. Folgt man der von den Kurator_innen Angelika Reitzer und Wolfgang Straub vorgegebenen Nummerierung, beginnt der Ausstellungsrundgang mit Teresa Präauer und ihrer Frage „Was hat Schreiben mit Zeichnen zu tun?“. Weiße Papierobjekte in der Form überdimensionierten Schreibmaterials bilden die passende Kulisse zu ihrer gewitzt formulierten Antwort auf die Frage, die der Linzer Autorin wohl schon allzu oft gestellt wurde.
So divers die Beiträge der fünf Frauen und fünf Männer sind, es zieht sich ein mehr oder weniger starker Bezug zur bildenden Kunst durch – sei es in Form von Kooperationen oder inhärent in der eigenen künstlerischen Praxis. Brigitte Falkners Comics und Storyboards, Hanno Millesis Collagen aus Texten und Bildern alter National-Geographic-Magazine, oder die mit Schrift überzogenen (Kitsch-)Objekte von Theaterautorin Gerhild Steinbuch und Bühnenbildnerin Philine Rinnert befreien den Text von seiner klassischen Erscheinungsform in horizontalen Linien auf Papier. Nur die Ölbilder, die Katharina Weiß zu Clemens J. Setz’ sprachlichen Bildern gemalt hat, wirken allzu plakativ. Ihnen fehlt der Bruch – das Gesicht, „das wie ein Goldfischglas für den darin lebenden Schnurrbart wirkte“, ist auf dem Gemälde nichts anderes. Und bei manchen Beiträgen, etwa Thomas Stangls oder Anna Weidenholzers, wäre eine vorausgehende Lektüre der Romane interessant gewesen – aber dafür sind alle Besucher_innen wohl selbst verantwortlich. Dass beim Besuch das Verlangen nach schwarzem Text auf weißem Papier und den imaginären Welten, die darin lauern, aufkommt, ist doch eigentlich der größte Erfolg einer Ausstellung im Literaturmuseum. Und eben diesen Wunsch haben die Kurator_innen wohl antizipiert – in der mittig im Ausstellungsraum platzierten Autor_innenbibliothek können ihm die Unaufhaltbaren sofort nachgehen.
„Bleistift, Heft & Laptop. 10 Positionen aktuellen Schreibens“.
KuratorInnen: Angelika Reitzer und Wolfgang Straub.
Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien.
Bis 12. Februar 2017
Flora Schausberger studiert Critical Studies an der Akademie der bildenden Künste Wien.