Eigentumswohnungen
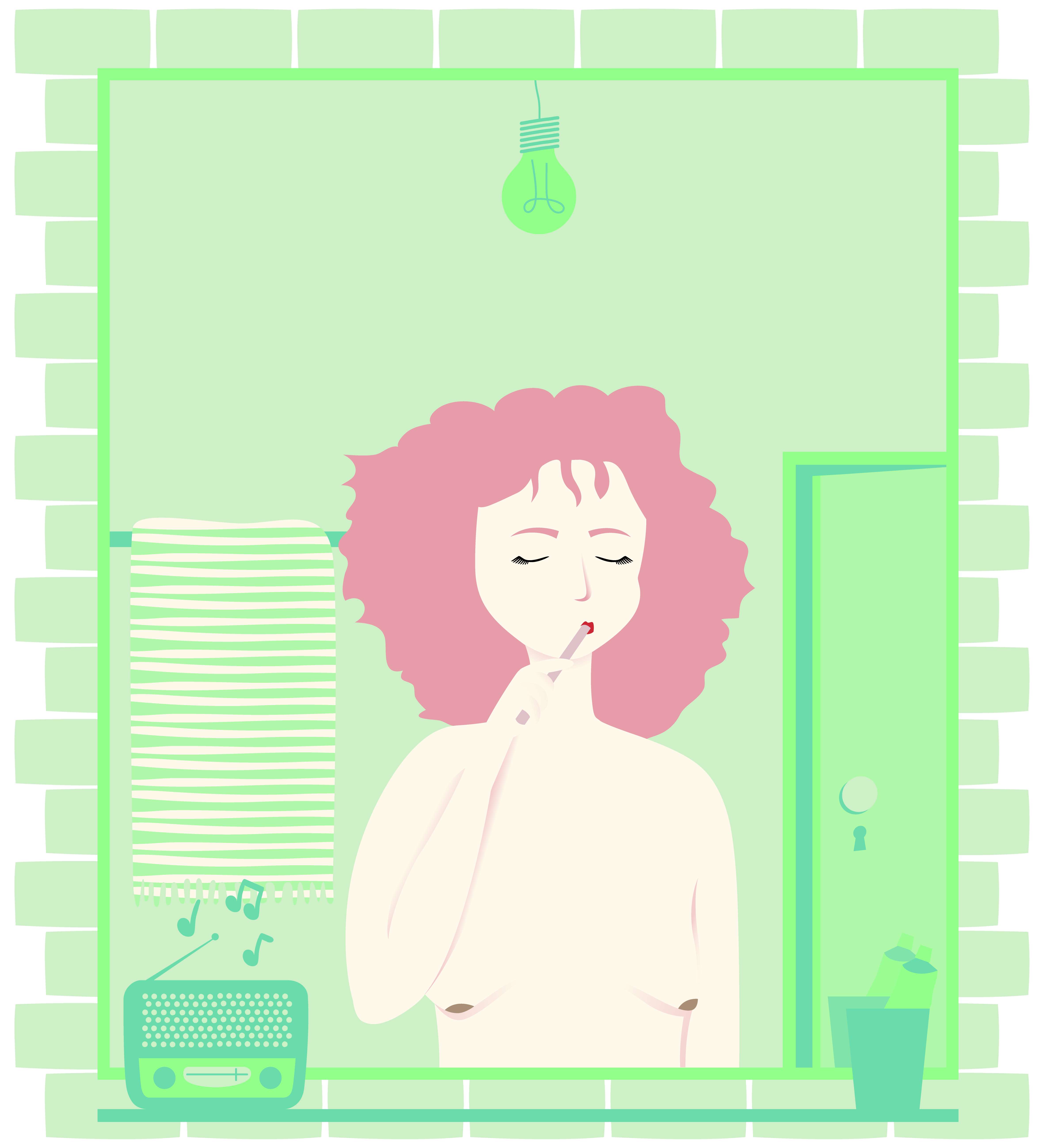
Während manche Studierende über 50 Prozent ihres Budgets für die Miete aufbringen, leben Studierende aus „gutem Hause“ in Eigentumswohnungen. Das wirkt sich nicht nur auf den Geldbeutel aus.
Räumen wir gleich einmal zu Beginn mit einem Mythos auf: Student*innen sind nicht arm! Sie tun so, die meisten inszenieren sich so, aber sie sind es nicht! Die größte Gruppe der Studierenden (52 Prozent) sind laut Studierendensozialerhebung 2015 Teil der gehobenen oder hohen Schicht! Ihre Eltern haben großteils Universitätsabschlüsse und höhere Einkommen als der Durchschnitt.
Der Mythos, dass Studierende am Hungertuch nagen und kaum über finanzielle Mittel verfügen, mag mit halblustigen Sprüchen wie „Warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig?“ zusammenhängen. Aber was Pulp in den 90er Jahren sangen, „if you called your dady he could stop it all, yeah“, trifft heute noch auf die meisten Student*innen zu. Ihre Armut ist eine eingebildete, oder zumindest eine vorübergehende. Kann die Miete nicht gezahlt werden, kommt es im Studifall wohl in den seltensten Fällen zur Delogierung, sondern in den meisten Fällen hilft ein Anruf bei den Eltern, dass das für die Miete überwiesene Geld für den neuen Herschel-Rucksack und Fusion-Tickets draufgegangen sei, und man nun ein bisschen „Vorschuss“ brauche. Gleichzeitig gefällt man sich in der Rolle des armen „Bettelstudenten“ und fraternisiert mit den tatsächlich ärmeren Student*innen, die das System trotz sozial gestaffeltem Bildungssystem und Zugangsbeschränkungen nicht davon abhalten konnte, zu studieren. Alle studieren, alle haben irgendwie die gleichen Probleme und man nimmt nur zu leicht an, dass auch alle irgendwie arm sind. Schließlich meint Benjamin-Alexander* auch, dass er kein Geld mehr habe diesen Monat. Und während die ärmsten zehn Prozent der Studierenden laut Studierendensozialerhebung nur 500 Euro im Monat für ihre Grundbedürfnisse haben, und nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen, weiß Benni nicht, ob es diesen Monat noch reicht für den Segeltrip in der Ägäis. Benni hat auch nicht das Problem, 36 Prozent seines Gesamtbudgets für Miete auszugeben. Noch drastischer wird die Situation für Studierende, die unter 700 Euro im Monat zur Verfügung haben. Dort beträgt der Anteil der Miete am Gesamtbudget laut Studierendensozialerhebung über 50 Prozent.
Die Mieten steigen und der Anteil des Einkommens, der dafür draufgeht, wird immer größer. Jene, die es sich leisten können, neigen deshalb eher dazu, die monatliche Kreditrate zu bedienen und sich eine Wohnung zu kaufen. Dann ist man in ein paar Jahren Eigentümer*in und muss nur mehr für die Betriebskosten aufkommen.
In Österreich wohnen 39 Prozent im Eigenheim und 11 Prozent in Eigentumswohnungen, also über die Hälfte der Bevölkerung, wie aus dem Endbericht 2014 der Forschungsgesellschaft für Wohnen, Bauen und Planen hervorgeht. In der Hauptstadt wohnen 13 Prozent in Eigentumswohnungen. Eigentumswohnungen sind kostspielig. In der kleinsten Kategorie (Wohnungen unter 59 m²) schwanken die Preise an den meisten österreichischen Hochschulstandorten zwischen 95.000 und 200.000 Euro. Man braucht also schon einiges an Eigenkapital, um sich auch nur eine kleine Wohnung leisten zu können. Oder man erbt sie. Denn in Österreich werden nicht nur Bildungsabschlüsse vererbt, die Immobilien bekommt man auch noch mit dazu.
Über eine Eigentumswohnung zu verfügen, wirkt sich nicht nur auf den Geldbeutel im Studium aus: Viele Studierende klagen über psychische Probleme und haben Existenzängste. Falls man in einer anderen Stadt studiert und sich nicht auf die monatlichen Geldzuwendungen aus dem Elternhaus verlassen kann, bleibt einem gegebenenfalls nichts anderes übrig, als das Studium abzubrechen, um die Miete zahlen zu können. Der elementare Stress, die Miete nicht zahlen zu können, beherrscht schließlich jeden Aspekt des Lebens. Das Studium leidet unter dem „Nebenjob“, der im Ernstfall zum Haupterwerb wird.
Der Sommer naht und auf Facebook und auf den Wohnungsportalen sprießen die Untermietanzeigen aus dem Boden. „WG-Zimmer für 3 Monate zur Untermiete“. Während kurzfristige Untervermietung für manche bittere Notwendigkeit ist, stellt es für Studierende mit Eigentum kein Problem dar, eine Wohnung für mehrere Monate leerstehen zu lassen. Oder besser: sie trotzdem zu vermieten und so von der Eigentümer*in zur Vermieter*in zu werden. Schließlich lässt sich der Segeltrip in der Ägäis viel leichter finanzieren, wenn man noch ein paar hundert Euro mehr zur Verfügung hat. Vermietet wird dann bisweilen weit über dem Richtwert, man soll ja sein Eigentum auch nicht zu billig zu Markte tragen. Miethöchstzins und reale Mieten liegen ja auch bei anderen Wohnungen weit auseinander, meint Benni. Und so wird man als Student*in schnell zur Marktkenner*in, die nur das Beste aus dem Möglichen macht.
*Bei Menschen mit einem Einkommen unter 1.000 Euro, die Benjamin-Alexander heißen, entschuldige ich mich hiermit für den Klassismus, ihren Namen mit der Oberschicht gleichzusetzen – ich bezweifle allerdings, dass es sie gibt.
Anne-Marie Faisst studiert Internationale Entwicklung an der Universität Wien.




