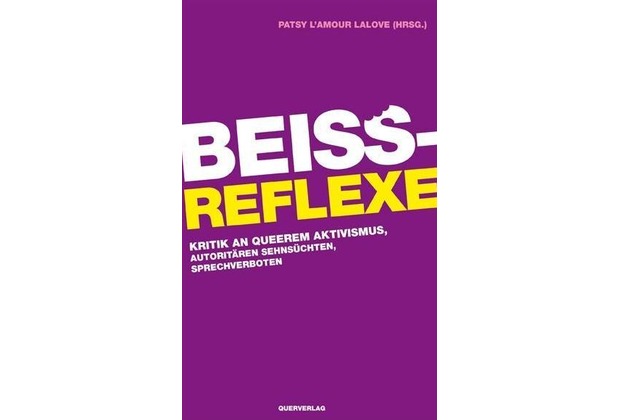Trümmer zusammenfügen – Zeitreisen und Emanzipation

Die von der öffentlich-rechtlichen BBC produzierte Serie umfasst mittlerweile 839 Folgen, von denen jedoch 97 nach wie vor verschollen sind. Die Prämisse ist leicht erklärt und hat sich 54 Jahren kaum verändert: Der Doctor, ein mysteriöser Außerirdischer, reist mit seiner TARDIS – einem Raumschiff, das innen größer ist als außen – durch Raum und Zeit und wird dabei von wechselnden Companions begleitet. Stirbt der Doctor, regeneriert er in einem neuen Körper. Seit der Darsteller des ersten Doctors aus gesundheitlichen Gründen aus der Serie ausschied, waren 13 Schauspieler in der Rolle zu sehen.
Fortschritt
Diesen Sommer wurde mit Jodie Whittaker erstmals eine Frau als die Rolle des mittlerweile fast 2000 Jahre alten Time Lords gecastet. Sie wird im kommenden Christmas Special erstmals zu sehen sein. Frauen war bisher primär die Funktion des Companions vorbehalten, die den Doctor auf seinen Reisen begleiten. An ihnen sind auch die jeweils herrschenden Frauenbilder ihrer Zeit gut ablesbar. Waren Sie in den Anfangsjahren der Serie oftmals kreischende, vor diesem oder jenem Monster weglaufende Damsels in Distress, schlug sich mit dem Casting von Elisabeth Sladen als Sarah Jane Smith der Second Wave Feminismus in der Serie nieder. Sie begleitete als investigative Journalistin den dritten und vierten Doctor. 30 Jahre später trat sie ein weiters Mal an der Seite des zehnten Doctors in Erscheinung und bekam schließlich mit The Sarah Jane Adventures eine eigene, an Kinder gerichtete, Spin-off Serie, die es auf 5 Staffeln brachte und erst eingestellt wurde, als Sladen 2011 starb. Über ihren Tod wurde nicht nur in den BBC Nachrichten, sondern auf den Titelseiten vieler britischen Tageszeitungen berichtet.
Im Unterschied zu anderen Science-Fiction Formaten kam es bei Doctor Who nie zu einem Reboot. Zwar machte die Serie von 1989 bis 2005 Zwangspause, „New Who“ bildet aber eine Kontinuität zur alten Serie und erzählt die Geschichte mit höheren Produktionsbudgets und den ungleich größeren technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts weiter. Die Queer as Folk Produzent_innen Russell T Davies und Julie Gardner waren für die ersten vier Staffeln der neuen Serie verantwortlich. Doctor Who hatte auch in der Neuauflage viel Mut zu Trash- und Camp-Ästhetik. Zugleich war die Serie gesellschaftspolitisch in vielerlei Hinsicht progressiv aufgeladen. Rose Tyler (Billie Piper), der Companion des neunten und zehnten Doctors, lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter in einer Londoner Sozialwohnung. Mit Martha Jones (Freema Agyeman) und Mickey Smith (Noel Clarke) wurden die ersten Schwarzen Companions gecastet und mit Captain Jack Harkness (John Borrowman) ein bisexueller, unsterblicher Held etabliert, der zudem Hauptfigur der Spin-off Serie Torchwood ist. Der neunte Doctor kämpft in der Zukunft gegen einen omnipotenten Medienkonzern und in der Gegenwart gegen Aliens, die sich als dicke Politiker_innen getarnt der Regierungsgewalt bemächtigen wollen. Der zehnte Doctor wird zeitweise zum Ökologie-Aktivisten und unterstützt einen Sklav_innenaufstand. Die jüngste Staffel, die an einer englischen Universität spielt, wurde über weite Strecken aus Sicht einer jungen, schwarzen, lesbischen Frau erzählt, die dort als Pommes-Verkäuferin arbeitet, und thematisiert u.a. Whitewashing als rassistische Praxis von Geschichtswissenschaften und Medien.
Fankultur
Der zu erwartende und insbesondere von männlichen Fans getragene antifeministische Shitstorm blieb nach dem Casting Whittakers nicht aus. Er bekam es aber mit der ungewöhnlich entschlossenen Gegenwehr vieler Doctor Who Fans zu tun, die die abstrusen Sorgen der sexistischen Trolle systematisch ins Lächerliche zogen. Auch eher apolitische Doctor Who Vlogger_innen sprachen sich mit großer Mehrheit für die weibliche Besetzung aus.
Doctor Who hatte bereits in den 1980ern eine nicht zu vernachlässigende queere Fanbase. Dass eine der Hauptfiguren von Queer as Folk großer Doctor Who Fan ist, kann als Reminiszenz darauf gedeutet werden. Mit der Fortsetzung der Serie ab 2005 intensivierte sich auch die Wechselwirkung von LGBTIQ-Fans und Serie.
Anne Marie studiert Internationale Entwicklung an der Universität Wien und sah bereits in ihrer Kindheit vereinzelt Doctor Who Folgen, als die Serie auszugsweise im deutschen Fernsehen zu sehen war. „Doctor Who kam glaub ich immer Sonntag morgens auf VOX“, erinnert sich Anne Marie. „Ich bin aufgestanden, wenn meine Eltern spazieren waren und hab mich verbotenerweise vor den Fernseher gesetzt – damals habe ich mir oft gewünscht, dass mein Vater wie der Doctor wäre“, so Anne Marie weiter. Die meisten Fans im deutschsprachigen Raum kamen nach 2005 via Internet mit dem Phänomen in Berührung. „Ich bin erst durch die neue Serie auf Doctor Who gestoßen und da auch erst, als David Tennant der Doctor wurde“, erzählt Sarah, die an der Akademie der bildenden Künste studiert. Anne Marie hingegen hat erst 2010 begonnen, die neue Serie zu schauen – beim wöchentlichen Ritual ist es geblieben, allerdings unter anderen Vorzeichen: „Ich habe mit der Tradition weitergemacht, sie sonntags zu sehen – jetzt allerdings mittags und restfett“. Doctor Who bespielt viele Genres und ist nicht selten Romanze, Melodram, Satire und Slapstickkomödie zugleich. „Interessanterweise ist es für mich mehr eine Abenteuer-Detektiv Geschichte mit guter Dramaturgie und interessanten Charakteren“, meint Sarah.
Christliche Motive
Obwohl Doctor Who auf einer inhaltlichen Ebene oft – aber keineswegs immer – gesellschaftspolitisch progressiv ist, wird die emotionale Wirkung auf die Rezipient_innen nicht zuletzt durch die formale Inkorporierung zentraler christlicher Motive entfaltet, die in der Serie beständig wiederholt und variiert werden. Der Figur des Doctors ist etwas Messias-artiges eingeschrieben. Sie opfert sich, um die Welt zu retten und muss dabei teils extremes Leid über sich ergehen lassen. Findet sie dabei den Tod, kommt es zur Wiederauferstehung. Nicht zufällig spielte Christopher Ecclestone bevor er als neunter Doctor gecasted wurde in der Miniserie The Second Coming den zurückkehrenden Christus. Auch nicht zufällig stammt das Drehbuch dazu ebenfalls von Russell T Davies. Die Figur des 9. Doctors ist dem in Manchester predigenden Working Class Jesus in vielerlei Hinsicht ähnlich.
Nun sind Motive der Erlösung oder der Überwindung des Todes nicht per se problematisch. Gerade der jüdische Messianismus inspirierte auch viele Kommunist_innen, da er die Chance bietet auf gesellschaftlicher Ebene großes emanzipatorisches Potential zu entfalten. Im Christ_innentum kommt allerdings das Motiv des Selbstopfers, des für ein höheres Ziel Sterbens, hinzu. Dieses Motiv zieht sich in säkularisierten Varianten wie kaum ein anderes durch die Kulturindustrie.
Die Tragik der Menschheit besteht nicht zuletzt darin, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse Individuen tatsächlich in Situationen bringen, in denen sie sich opfern müssen, um andere zu retten – ein Motiv das etwa im letzten Harry Potter Band zentral ist und auch bei Doctor Who wiederholt in Erscheinung tritt. Die Ästhetisierung dieses Selbstopfers tendiert jedoch meist dazu, selbigem einen tieferen Sinn zuzusprechen, anstatt seine Notwendigkeit zu beklagen. Faschismus und Nationalsozialismus betrieben einen regelrechten Opferkult, der sich in Denkmalinschriften wie „Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen“ niederschlug. Zwar opfern sich Menschen in Doctor Who nicht für verurteilenswerte Zwecke wie die deutsche Nation (und auch nicht für die britische), in der 8. Staffel entwickelt sich jedoch eine Dynamik, in der das Selbstopfer militärisch gedacht und in Verbindung mit viel soldatischem Habitus dargestellt wird. Diese Staffel fällt auch dadurch negativ auf, dass Schmerz und Angst mehrfach als gut und wichtig statt als abschaffungswürdig benannt werden.
Viel geschrieben wurde über die Musik zu Doctor Who, die von Murray Gold komponiert und vom BBC National Orchestra of Wales vertont wird. Ähnlich wie das wiederkehrende Motiv des Selbstopfers ist die Musik opulent und hochgradig emotionalisierend, bei genauerer Betrachtung aber auch recht holzschnittartig. Sowohl einzelne Personen als auch Planeten und spezifische Ereignisse sind mit jeweils eigenen musikalischen Motiven verbunden. Kenner_innen der Musik wird durch den Einsatz oder der Variation eines bestimmten Motivs oft schon frühzeitig verraten, worauf man sich gegen Ende der Folge gefasst machen kann.
Engel der Geschichte
In starkem Kontrast zum beschriebenen Opferkult steht zum Beispiel die Doppelfolge „The Empty Child“/“The Doctor Dances“, in der sich Rose Tyler und der neunte Doctor im London der 1940er Jahre während des Bombardements durch die Nazis befinden. Selbstironisch auf die Handlung der Folge und wohl auch auf Doctor Who insgesamt verweisend, meint der Doctor schon zu Beginn, dass er sich nicht sicher sei, ob man es hier mit „marxism in action“ oder einem „West End Musical“ zu tun habe. Im weiteren Verlauf hören wir einen mitreißenden antifaschistischen Monolog Rose Tylers und am Ende der Folge sehen wir den freudestrahlenden Doctor „Everybody lives Rose, just this once!“ ausrufen.
Den größten inhaltlichen Unterschied zwischen alter und neuer Serie bildet die Zerstörung des Planeten Gallifrey, auf dem der Doctor seine Kindheit verbrachte und der die an eine antike Hochkultur erinnernde Gesellschaft der Time Lords beherbergte. Diese Ereignisse fanden im Rahmen des „Time War“ statt, der in der Serie nicht zu sehen ist und sich dem Publikum nur fragmentarisch erschließt. Die Vernichtung Gallifreys und der Time Lords lassen den Doctor als letzten seiner Art zurück. Insbesondere bei Doctor 9 und 10 resultiert daraus eine massive Überlebensschuld. „Ecclestones Doctor hatte klar PTSD und war ein gebrochener Mann, der versucht, klar zu kommen, sich in Rose verliebt und mit ihr sein Trauma überwindet“, meint Anne Marie.
Der Philosoph Walter Benjamin beschrieb in seinen Thesen „Über den Begriff der Geschichte“ ein Bild von Paul Klee, in dem er meinte, den Engel der Geschichte zu erkennen. Für den Angelus Novus ist die Vergangenheit ein einziger großer Trümmerhaufen. Er möchte die Trümmer zusammenfügen, wird jedoch von einem beständigen Sturm, der für den Fortschritt steht, von den sich immer weiter auftürmenden Trümmern fortgeblasen. Der Wind weht den Engel in eine Zukunft, die er nicht sehen kann, weil er ihr den Rücken zuwendet. Einige dieser Motive lassen sich in der 2013 anlässlich des 50. Geburtstags von Doctor Who aufwendig produzierten, spielfilmlangen Folge „The Day of the Doctor“ wiederfinden. Dem Doctor gelingt darin etwas, woran der Engel der Geschichte gescheitert war. Was genau, wäre aber zu viel verraten...
Florian Wagner studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien