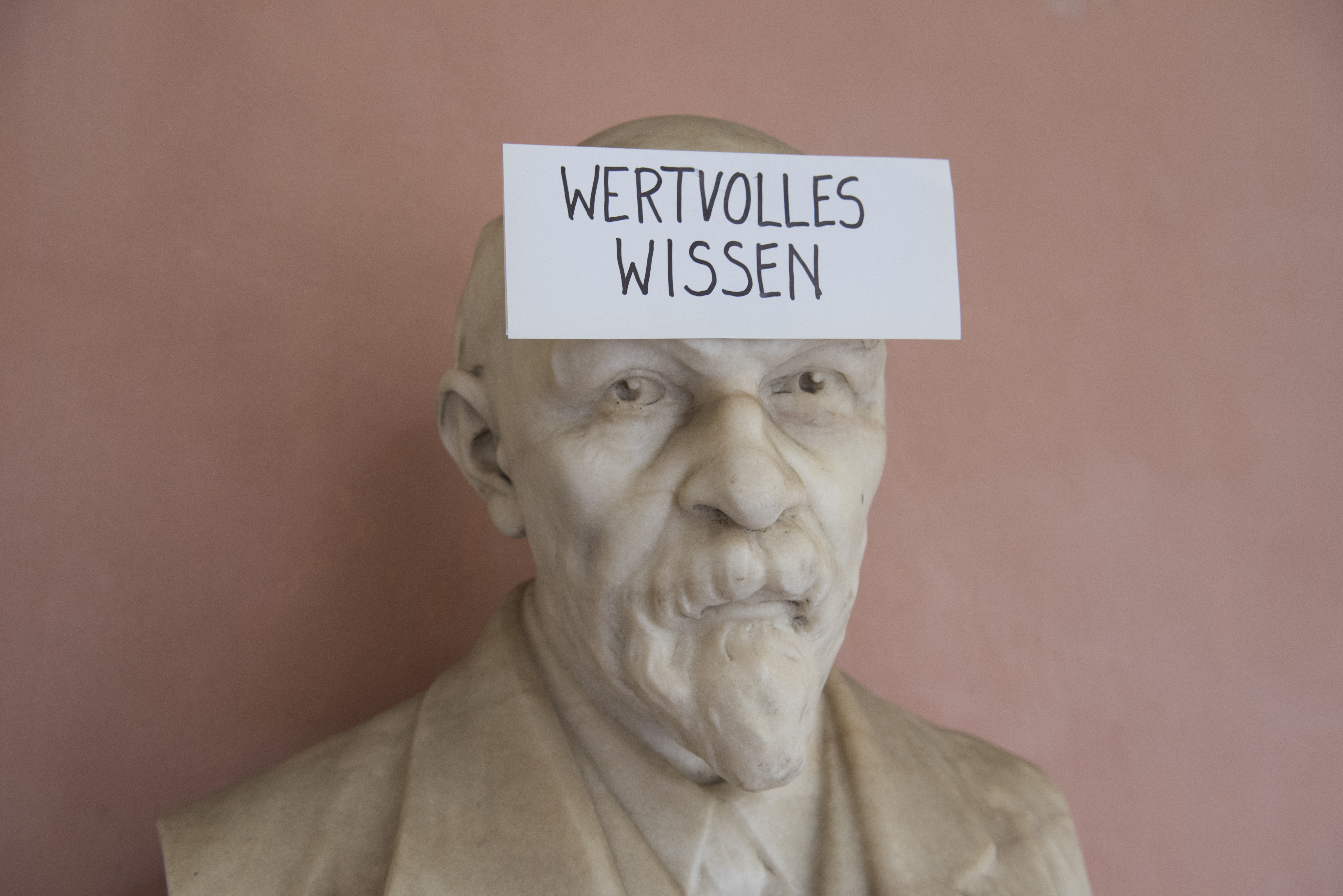Wer Leute dazu animieren will, über den eigenen Tellerrand zu blicken, ist gut beraten, das selbst auch zu tun.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich finde mich relativ häufig in politischen Diskussionen wieder, in denen sich alles in mir zusammenkrampft, wenn ich meinem Gegenüber so zuhöre. Und da ist es egal, ob es um Grenzzäune, Frauenquoten oder Mindestsicherung geht. Ärgerlich finde ich eigentlich immer dasselbe: Die verkürzte Art, wie über soziale Probleme nachgedacht wird, wo sie uns doch eigentlich alle betreffen und genug Anstoß zum kritischen Denken existiert.
Die akademische und politische Linke generiert seit jeher kritisches Wissen, um ungerechte Gesellschaftsverhältnisse zu bekämpfen, nicht zuletzt, indem sie Bewusstsein darüber schafft. Nun lässt sich natürlich einwenden, dass es seit jeher auch gesellschaftliche Kräfte gibt, die sich tatkräftig gegen eine entsprechende Modernisierung wehren. Verständlicherweise – von sozialer Ungleichheit profitieren ja auch die einen oder anderen. Aber diese Profiteur_innen sitzen mir in meinem Alltag eigentlich kaum gegenüber. Zumindest strukturiert sich die Argumentation meiner Gesprächspartner_innen meist nicht danach, ob sie profitieren oder nicht. Viel eher scheint es egal zu sein, wie relevant ein politisches Thema ist. Dass alle Menschen ein differenziertes Wissen dazu haben, ist ganz offensichtlich zu viel verlangt. Irgendwie eh klar. Alltagswissen entsteht eben unter bestimmten Voraussetzungen, die das zunächst kaum anders ermöglichen.
[[{"fid":"2439","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Foto: Johanna Rauch"},"type":"media","attributes":{"title":"Foto: Johanna Rauch","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
WISSEN UND HANDELN. Eine der wohl bemerkenswertesten Einsichten aus der Wissenssoziologie ist, dass Wissen immer in Zusammenhang mit Handeln gefasst werden muss, das heißt, dass jedes Wissen auf den Handlungsrahmen bezogen ist, in dem es nützlich sein soll und in dem es bestehen muss. In der akademischen Auseinandersetzung mit Geschlecht können theoretische Überlegungen und empirische Befunde zu einer umfassenden Analyse des Geschlechterverhältnisses zusammengetragen werden, die Aufschluss über die hierarchische Positionierung von Männern und Frauen in der Gesellschaft gibt. Für den Alltag dieser Männer und Frauen ist es zunächst aber völlig ausreichend zu wissen, wie man sich dem eigenen Geschlecht entsprechend kleidet und verhält (und auch für die Genderforscherin ist diese Kompetenz abseits ihrer akademischen Metaposition unverzichtbar). Alltagswissen beschränkt sich also zunächst auf das, was im Handlungsrahmen des eigenen Alltags so auftaucht und relevant wird. Dazu gehören auch Inhalte des öffentlichen Diskurses über politische Themen, die mehr oder weniger bewusst aufgenommen werden.
Nun sind Inhalte des öffentlichen Diskurses, zum Beispiel die Berichterstattung in Mainstreammedien, nicht immer darauf ausgelegt, Sachverhalte adäquat darzustellen, egal wie wichtig das Thema sein mag. Nebst der Tatsache, dass Medien einem starken Verwertungszwang unterliegen und daher zunehmend auf Unterhaltung und Skandalisierung setzen, sind sie freilich auch Schauplätze politischer Kämpfe, in denen unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen, die Ausdruck politischer Kräfteverhältnisse sind. Und diese Stimmen tauchen auch in Alltagsdiskussionen wieder auf.
Das macht Alltagsdiskussionen zu Räumen der politischen Auseinandersetzung. Und zwar zu welchen, auf die wir direkten Einfluss haben. Wir sind also gut beraten, uns Kommunikationsstrategien zu überlegen, bei denen wir am Ende nicht selbst völlig verzweifeln. Weil nervenaufreibend ist das schon, immer wieder erklären zu müssen, dass an der Prekarisierung der Arbeitswelt nicht wirklich „die Ausländer“ schuld sind und die Feministinnen nicht an der „Verweichlichung des Mannes“.
[[{"fid":"2440","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Foto: Johanna Rauch"},"type":"media","attributes":{"title":"Foto: Johanna Rauch","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
RAUM DER REFLEXION. Aber wie lässt sich eine Diskussion so gestalten, dass Reflexion möglich ist und sie nicht in Ärger und Frustration endet? Raphaela Weiss vom Verein „Sapere Aude“ zur Förderung politischer Bildung beschreibt für ihre Arbeit in Workshops, dass es zunächst wichtig sei, sich einer belehrenden Haltung à la „Ich sag euch jetzt wie’s funktioniert!“ zu entledigen. Ähnlich argumentiert der Geschlechterforscher Paul Scheibelhofer von der Uni Innsbruck, dass es in der Vermittlung von kritischem Wissen nicht darum gehen soll, Leute zu erleuchten. Anstatt also krampfhaft zu versuchen, das eigene Wissen in die Köpfe anderer zu füllen, ist es viel sinnvoller sich anzusehen, was sie selbst aus kritischen Überlegungen an Wissen generieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist laut Scheibelhofer, einen Bezug zu eigenen Erfahrungen herstellen zu können. Gerade bei gesellschaftspolitischen Themen ist das oft gut möglich. So können ganz im Sinne guter alter Soziologie persönliche Probleme als soziale Themen erkannt werden. Dieser Zugang bietet auch die Chance, selbst etwas aus einem Gespräch mitzunehmen und Wissenskoalitionen zu bilden.
Ganz in diesem Sinne ist es weiters hilfreich, sich nicht über Aussagen zu empören, auch wenn das mitunter eine der schwersten Aufgaben in Diskussionen ist. Ein genialer Trick, um auch die eigenen Emotionen hier abzufangen, ist es, wie Weiss vorschlägt, Fragen zu stellen, wenn einem eine Aussage nicht einleuchtet: „Es bringt tausendmal mehr, Leute selbst auf Zusammenhänge bzw. auf die Komplexität mancher Dinge draufkommen zu lassen, als ihnen eine fremde Meinung aufzuzwingen.“ Fragenstellen zeigt Interesse an der Sichtweise der anderen, ist respektvoll, schafft Vertrauen und kann damit zu einer guten Gesprächsbasis beitragen, auf der es dann, wie Weiss argumentiert, viel leichter wird, Aussagen zu überdenken. Durch Fragenstellen lässt sich weiters, wie die Sozialwissenschaftlerin Katharina Debus betont, die „Beweislast“ umkehren, so dass nicht nur meine Perspektive „erklärungsbedürftig“ ist, sondern auch die andere. Fragen kommen weniger aufdringlich daher als Gegenreden und eignen sich dadurch gut als Input zum Weiterdenken. Durch Zuhören erfährt man aber auch selbst mehr, bekommt einen tieferen Einblick in Gedankengänge und Argumentationslinien des Gegenübers und kann damit Verständnis für dessen Positionierung erzeugen. Verständnis, das nicht nur das Gegenüber beruhigen kann, sondern auch einen selbst. Es ermöglicht, die eigene Einstellung gegenüber anderen zu verändern. Zu verstehen, warum sich eine Person so positioniert, wie sie es tut, kann es deutlich leichter machen, mit dieser Positionierung zurechtzukommen und bietet vielleicht sogar Anlass, sich mit eigenen Erwartungen auseinanderzusetzen, die an andere Personen gestellt werden. Und nicht zuletzt ist Verständnis aufzubringen ebenfalls ein wertvoller Beitrag auf der Beziehungsebene, weil es der anderen Person vermittelt, ernstgenommen zu werden. Die Beziehungsebene beschreibt Debus als ganz zentral für einen Raum der Reflexion, denn Vertrauen macht in der Vermittlung von Problematiken vieles leichter. Dazu, meint sie, ist es auch förderlich, Missverständnisse von vornherein aus dem Weg zu räumen. Böse Absichten, die einem unterstellt werden könnten, sind ja relativ schnell verneint: „Ich bin keine Männerhasserin, aber ich bin dafür, dass Frauen und Männer die gleichen Möglichkeiten im Leben haben. Und du?“ Denn das funktioniert auch in die andere Richtung. Auch einem selbst kann es ein beruhigendes Gefühl geben, zu wissen, dass das Gegenüber nicht prinzipiell ein sexistisches oder rassistisches Arschloch ist. Hier lässt sich an einen weiteren Punkt anknüpfen, auf den die Sozialwissenschaftlerin aufmerksam macht: Hinter einer diskriminierenden Aussage steht nicht unbedingt die Absicht, zu diskriminieren. Es ist daher sinnvoll, zwischen Absichten und Effekten zu unterscheiden.
[[{"fid":"2441","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Foto: Johanna Rauch"},"type":"media","attributes":{"title":"Foto: Johanna Rauch","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
Letztendlich, so meint auch Debus, können wir nicht den Anspruch haben, von unserem Gegenüber ein sofortiges „Ach ja, stimmt!“ zu bekommen. Sie sieht Widerstand als zentralen Teil des Lern- und Reflexionsprozesses, in den wir viel emotionale Energie hineinstecken.
AUSZUCKEN? Welche Rolle Emotionen in Räumen der Reflexion spielen können, ist wohl relativ offen. Das Spektrum an Diskussionsgefühlen ist riesig: Aggression, Empathie, Angst, Dankbarkeit und so weiter. Auch die Arten der Gefühlsäußerungen sind vielfältig und wirken situationsabhängig unterschiedlich. Das macht viele Wege des Umgangs mit eigenen und fremden Emotionen in Diskussionen plausibel. So ist Weiss in Workshop-Situationen darum bemüht, Diskussionen um politische Themen auf einer sachlichen Ebene zu halten. Wobei sie meint, dass es auch hier manchmal legitim ist, Emotionen einzubringen, gerade bei sozialpolitischen Themen, wo ein emotionaler Bezug zum eigenen Leben besteht. Ihr geht es darum, Wege zu vermitteln, konstruktiv über Politik zu sprechen. Einen anderen Aspekt hat mir unlängst ein Fundraiser auf der Straße in Bezug auf seine Arbeit beschrieben. Beim Spendeneintreiben für Amnesty International ist es eine wesentliche Aufgabe, Bewusstsein über politische Missstände zu schaffen. Sympathie aufzubauen und eine emotionale Verbindung zu Problemen herzustellen ist dabei das Um und Auf. Und warum auch nicht? Emotionale Energie ist ein zentraler Antrieb, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Oder auch für etwas Anderes. Gerade für rechte Politiken werden Emotionen gekonnt instrumentalisiert. Nicht umsonst setzt der Rechtspopulismus darauf, Wut oder Ängste in den Menschen zu schüren. Und auch wenn rechte Erzählungen von sozialen Problemen und Lösungen die Realität nicht adäquat abbilden, sind die entstandenen Emotionen dennoch real und verlangen politisch danach, ernstgenommen zu werden. Insofern ist die klassische Forderung „Man muss die Leute halt auch verstehen“ nicht ganz abwegig. Das muss allerdings mit Bedacht erledigt werden und darf, wie Debus betont, nicht dazu führen, dass diskriminierende Diskurse Raum bekommen und legitimiert werden: „Vielmehr kann es hilfreich sein, einerseits diskriminierenden Aussagen klare Grenzen zu setzen und andererseits gemeinsame nicht-diskriminierende Anliegen zu finden, die ernst genommen werden, wie zum Beispiel die Sorge vor ökonomischer Prekarisierung, das Gefühl mangelnder Mitbestimmung oder der Wunsch nach Orientierung und Handlungsfähigkeit“. Es geht freilich nicht darum, in jeder Situation für jede Person Verständnis und Mitgefühl aufzubringen, oder immer ruhig zu bleiben. Sondern diese Möglichkeiten neben vielen anderen wahrzunehmen und zu nutzen.
PÄDAGOGISCHER AUFTRAG? Vermittlung von kritischem Wissen kann keineswegs nur auf individueller Ebene passieren. Freilich muss es immer darum gehen, Strukturen mitzudenken. Die individuelle Ebene ist aber nicht unwesentlich, weil sie unseren unmittelbaren Einflussbereich darstellt. Unsere Nerven sind es, die es uns danken, wenn politisch relevante Inhalte in geeigneter Weise diskutiert werden. Es geht nicht zuletzt auch darum, Wege zu finden, solche Diskussionen für sich selbst erträglich oder sogar fruchtbar zu machen.
Carina Brestian studiert Soziologie an der Universität Wien.