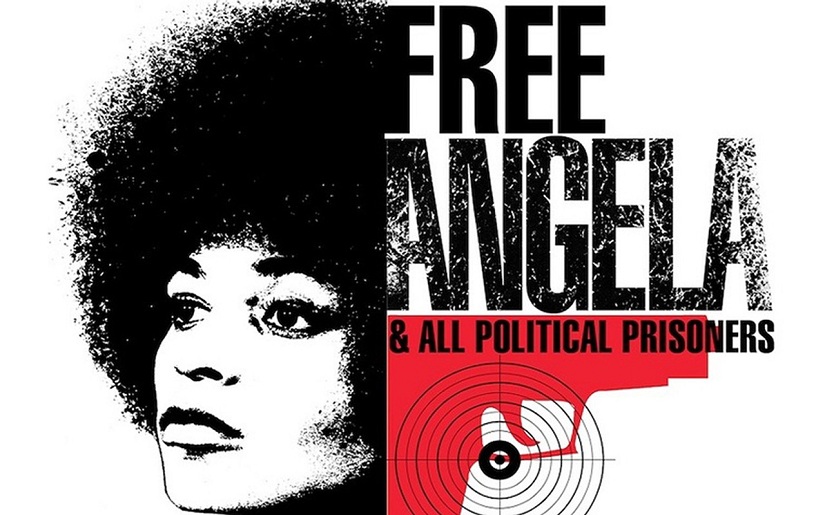„Vögeln musst du, aber Geld hast du keines“
Ein Interview mit Brigitte Hornyik, Verfassungsrechtlerin, Vorstandsmitglied im Österreichischen Frauenring und Mitbegründerin der Facebook-Gruppe Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafrecht, über den Schwangerschaftsabbruch und die immer noch vorhandenen Hürden.

Ein Interview mit Brigitte Hornyik, Verfassungsrechtlerin, Vorstandsmitglied im Österreichischen Frauenring und Mitbegründerin der Facebook-Gruppe Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafrecht, über den Schwangerschaftsabbruch und die immer noch vorhandenen Hürden.
Über vierzig Jahre ist es nun her, dass Frauengruppen mit Slogans wie „Mein Bauch gehört mir“ das Recht auf Schwangerschaftsabbruch verstärkt zum Thema gemacht haben und gegen Abtreibungsverbote auf die Straße gegangen sind. Damals waren Abtreibungen gemäß Paragraph 144 des Strafgesetzbuchs mit schwerem Kerker zu bestrafen (übrigens ein Relikt aus der Zeit Maria Theresias). Erst 1974 hat sich die Fristenlösung trotz heftigen Widerstands der ÖVP, der FPÖ, der Katholischen Kirche sowie der „Aktion Leben“, durchgesetzt. Die „Aktion Leben“ initiierte mit Unterstützung konservativer und katholischer Kreise sogar ein Volksbegehren zum „Schutz des menschlichen Lebens“, welches mit fast 900.000 Stimmen das vierterfolgreichste Volksbegehren der Republik Österreich war.
Seit dem 1. Jänner 1975 ist eine Abtreibung innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate straffrei, sofern diese von einem Arzt bzw. einer Ärztin durchgeführt wird und vorher eine ärztliche Beratung stattgefunden hat. Ab dem vierten Monat ist ein Schwangerschaftsabbruch nur bei medizinischer Indikation erlaubt. Diese Kompromissregelung aus den 1970er Jahren besteht auch heute unverändert weiter. Der Schwangerschaftsabbruch ist also nach wie vor strafgesetzlich verboten, unter bestimmten Bedingungen wird jedoch von einer Strafe abgesehen.
progress online: Seit 100 Jahren ist der Kampf um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch bereits Teil der Frauenbewegungen. Wofür müssen wir heute noch kämpfen? Welche Forderungen müssen an die Politik gestellt werden?
Ich finde es problematisch, dass der Abbruch an sich verboten ist, aber der Vater Staat gnädig ein Äuglein zudrückt, wenn die Frau sich vorher beraten lässt und ihn innerhalb der ersten drei Monate von einem Arzt vornehmen lässt. Eine ungewollte Schwangerschaft ist nicht lustig, da ist frau bereits in einer Konfliktsituation und muss sich dann auch noch sagen lassen: „Das ist eigentlich verboten und rechtswidrig und du wirst nur gnadenhalber nicht eingesperrt, wenn du dich für einen Abbruch entscheidest“. Was uns auch noch wichtig ist: Man könnte es den Frauen ganz pragmatisch leichter machen, man könnte Schwangerschaftsabbrüche vermehrt in öffentlichen Spitälern durchführen, man könnte Preisregelungen einführen, man könnte das entweder über die Krankenkasse finanzieren oder einen Fonds einrichten. Auch Empfängnisverhütungsmittel sind teuer, auch das gehört finanziell unterstützt. Wenn wir alle diese pragmatischen Forderungen stellen, dann kommt die Gegenseite mit dem Argument: „Der Staat kann nicht etwas finanzieren oder unterstützen, das doch eigentlich strafrechtlich verboten ist“. Da beißt sich die Katze leider wieder in den Schwanz. Auch deshalb gibt es unsere Forderung „Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafrecht!“.
Wir wollen die Verankerung eines Selbstbestimmungsrechts der Frauen in der Verfassung und wir wollen auch einen Satz drinnen haben, dass Familienplanung bzw. Empfängnisverhütung, aber auch andere Maßnahmen, nach Maßgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Frauen staatlich unterstützt werden sollten.
Welchen Stellenwert hat dieses Thema für die Politik?
Wir hatten von der Plattform 20000 Frauen aus im vergangenen Frühling einen Termin beim Gesundheitsminister Stöger und haben mit ihm über das Thema Schwangerschaftsabbruch geredet. Es war ein sehr freundliches Gespräch in sehr angenehmer Atmosphäre und der Herr Minister hat uns in allem Recht gegeben. Aber im Endeffekt hat er uns nur erklärt, warum das alles nicht geht: „Mit dem Koalitionspartner…“ und „Österreich ist ein katholisches Land“ und „Das geht einfach nicht“. Da denke ich mir: Wir haben seit vierzig Jahren die Fristenlösung, vor vierzig Jahren war es der einzig mögliche politische Kompromiss, aber vielleicht könnte man im Jahr 2014 auch politisch darüber hinaus denken.
Man könnte um einiges mutiger sein und ehrlich gesagt finde ich die Haltung der SPÖ sehr enttäuschend. Wien ist Jahrzehnte lang von der SPÖ allein regiert worden. Da wäre eine Wiener Lösung möglich gewesen, den Abbruch entweder ganz billig anzubieten oder über einen Fonds Zuschüsse zu zahlen. Vielleicht wäre das ein bisschen eine Vorreiterrolle für andere Bundesländer gewesen.
Aber das ist ein politisches Spiel. Die einen preschen vor, wie kürzlich wieder Ewald Stadler und Rudolf Gehring, und sagen „Die Fristenlösung gehört rückgängig gemacht und verboten“. Wir wollen nicht mit dem Herrn Stadler diskutieren, aber wir gehen mit unseren eigenen Forderungen hinaus. Wir fordern „Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafrecht!“ nicht unmittelbar deswegen, weil wir glauben, dass es nächstes Monat oder im nächsten Jahr tatsächlich beschlossen werden wird, aber wir wollen das Thema wieder in die öffentliche Diskussion einbringen, wir wollen thematisieren, dass Frauen im Grunde nach wie vor kriminalisiert werden.
Warum eigentlich muss dieser Schwangerschaftsabbruch, der so eine intime Entscheidung von Menschen ist, überhaupt rechtlich geregelt und gar mit Strafe bedroht werden? Vertrauen wir doch den Frauen, vertrauen wir der Gewissensentscheidung der Frauen, denn keine Frau geht leichtfertig abtreiben. Ich halte Frauen für verantwortungsbewusste Menschen, die in der Lage sind, ihre eigenen Gewissensentscheidungen zu treffen.
Wie ist der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in Österreich?
Das ist in Österreich leider bundesländerweit ziemlich verschieden. In Wien ist für Frauen tatsächlich ein relativ guter Zugang zum Schwangerschaftsabbruch gewährleistet. Es gibt in Wien einige Ambulatorien, die Abbrüche durchführen, das bekannteste und älteste ist der Fleischmarkt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Abbruch auch in einem öffentlichen Spital vornehmen zu lassen, das ist für die Frauen vielleicht vom Zugang her angenehmer, weil leider vor den bekannteren Ambulatorien wie Gynmed oder Fleischmarkt die selbsternannten „Lebensschützer“ stehen. Das kann manchmal ein Spießrutenlauf sein, zwischen den Rosenkranzmurmelnden oder denen, die grausliche gefakte Bilder verteilen, von zerstückelten Babyleichen, die sie irgendwo in einem Kriegsgebiet aufgenommen haben und die mit dem in der elften, zwölften Woche durchgeführten Schwangerschaftsabbruch absolut gar nichts zu tun haben. Das ist in den großen Wiener Spitälern natürlich nicht der Fall, dort stehen sie nicht.
Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es uns in Wien noch relativ gut geht. Was schon da ist, ist die finanzielle Hürde, in den Ambulatorien zahlt man jetzt schon fast 500 Euro. Eine Abtreibung ist nicht billig und finanzielle Unterstützung gibt es nicht. Für die künstliche Befruchtung gibt es eine finanzielle Unterstützung, da gibt es diesen In-Vitro-Fertilisations-Fonds. Für den Schwangerschaftsabbruch gibt es das nicht. Allenfalls über das Sozialamt. Aber da musst du nachweisen, dass du wirklich nichts hast. Und wenn du Pech hast, hast du irgendeine nette Beamtin oder einen netten Beamten, der dich von oben herab behandelt und dir das Gefühl gibt: „Vögeln musst du, aber Geld hast du keines“. Das ist keine angenehme Erfahrung.
Im Westen Österreichs ist die Situation eher dramatisch, in Tirol oder Vorarlberg gibt es weder ein Ambulatorium noch ein öffentliches Spital, das bereit ist, Abbrüche durchzuführen. Da bist du auf die Privatordinationen und die dementsprechende Preisgestaltung angewiesen. Im Süden von Österreich schaut es auch nicht wahnsinnig gut aus. Dieses Schlagwort, das mir eigentlich nicht so wahnsinnig gut gefällt, aber von dem alle wissen, was man darunter zu verstehen hat, also dieser „Abtreibungstourismus“ ist nach wie vor aufrecht. Aus den westlichen Bundesländern eher in die Schweiz und aus den übrigen Bundesländern herrscht ein gewisser Zug nach Wien.
Glauben Sie, dass die österreichische Bevölkerung eine Krankenkassenfinanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen befürworten würde?
In der Schweiz ist über die Frage der Krankenkassenfinanzierung kürzlich abgestimmt worden und es haben fast 70% zugestimmt, dass die Krankenkassenfinanzierung von Abbrüchen beibehalten wird. Ich glaube, für die österreichische Bevölkerung wäre das kein großes Problem, aber die Sozialversicherungsträger, die Krankenkassen, die schreien angeblich furchtbar, wenn man mit diesen Ideen kommt, Verhütungsmittel auf Krankenschein oder Abtreibung auf Krankenschein. Das hat uns auch Alois Stöger gesagt: „Nein, das können wir uns nicht leisten, wir wollen keine zusätzlichen Kosten übernehmen“. Wie gesagt, in der Bevölkerung wären die Widerstände wahrscheinlich nicht besonders groß.
Die Fristenlösung als solche ist in Österreich breitest akzeptiert. Es werden immer wieder Umfragen gemacht: sowohl in der Bevölkerung als auch unter Politikerinnen und Politikern ist die Fristenlösung unumstritten. Für mich stellt sich dann eher die Frage: Nehme ich das so hin? Lassen wir die Dinge wie sie sind oder gehen wir vielleicht einmal einen Schritt weiter?
Wie sieht es in Österreich mit Schutzzonen aus?
Die Schutzzonen, so wie wir uns das gedacht hätten, nämlich dass man einen bestimmten Bereich im Umkreis des Ambulatoriums schützt, sind nicht umgesetzt worden. Im Innenausschuss im Parlament haben sie gemeint: „Naja, das können doch die Länder regeln“. Die Länder haben wiederum gesagt „Das soll doch der Bund regeln“. Und dann haben wir die beliebte österreichische Pattsituation, einer redet sich auf den anderen aus und es geschieht gar nichts. Das war's mit den Schutzzonen. Aber die Forderung ist an sich da. Wir stellen diese Forderung immer wieder und sie wird auch von Betreibern der Ambulatorien immer wieder gestellt. Das ist schon eine Frage des politischen Willens und deswegen haben wir immer in all unseren Pressemeldungen dazugesagt, dass es Dinge gibt, die nicht eine Frage des rechtlichen Könnens, sondern des politischen Wollens sind.
Manu Banu und Dieter Diskovic studieren Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien.
Einen Artikel über die Aktivistinnen von Marea Granate und deren Kampf gegen das spanische Abtreibungsgesetz könnt ihr hier lesen: Marea Granate: Raus aus meinen Eierstöcken!