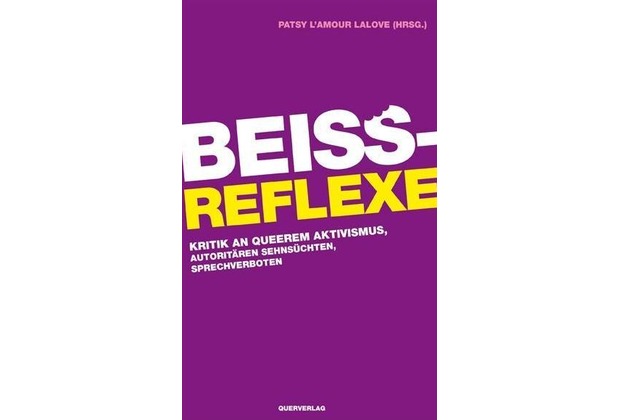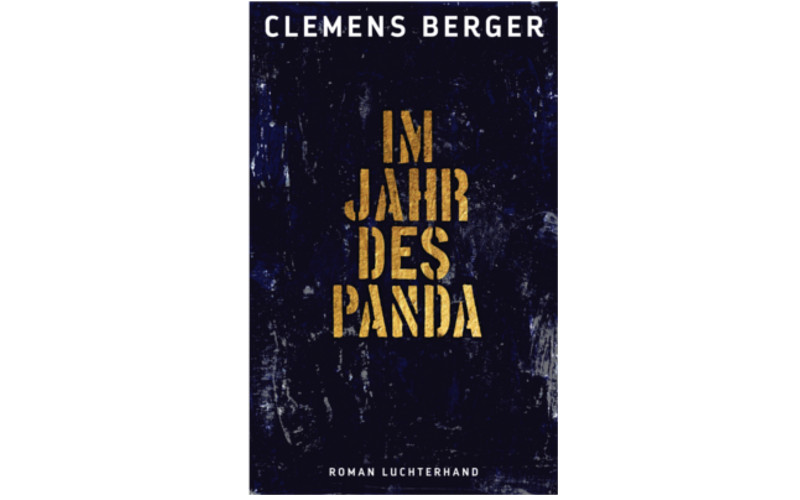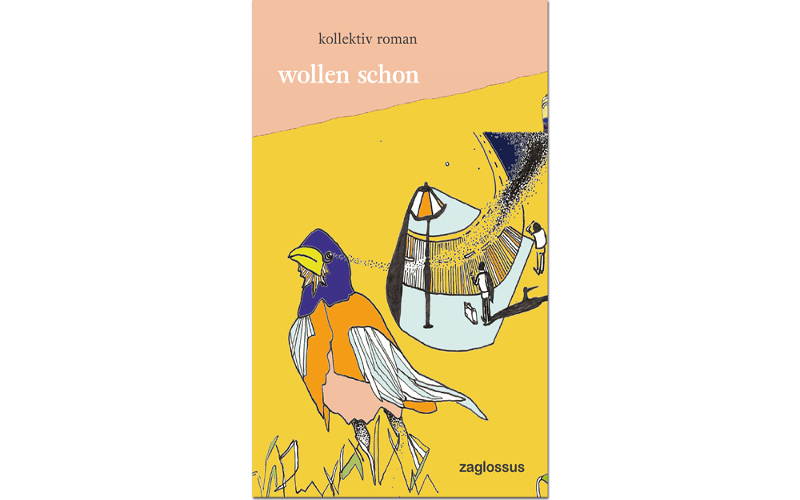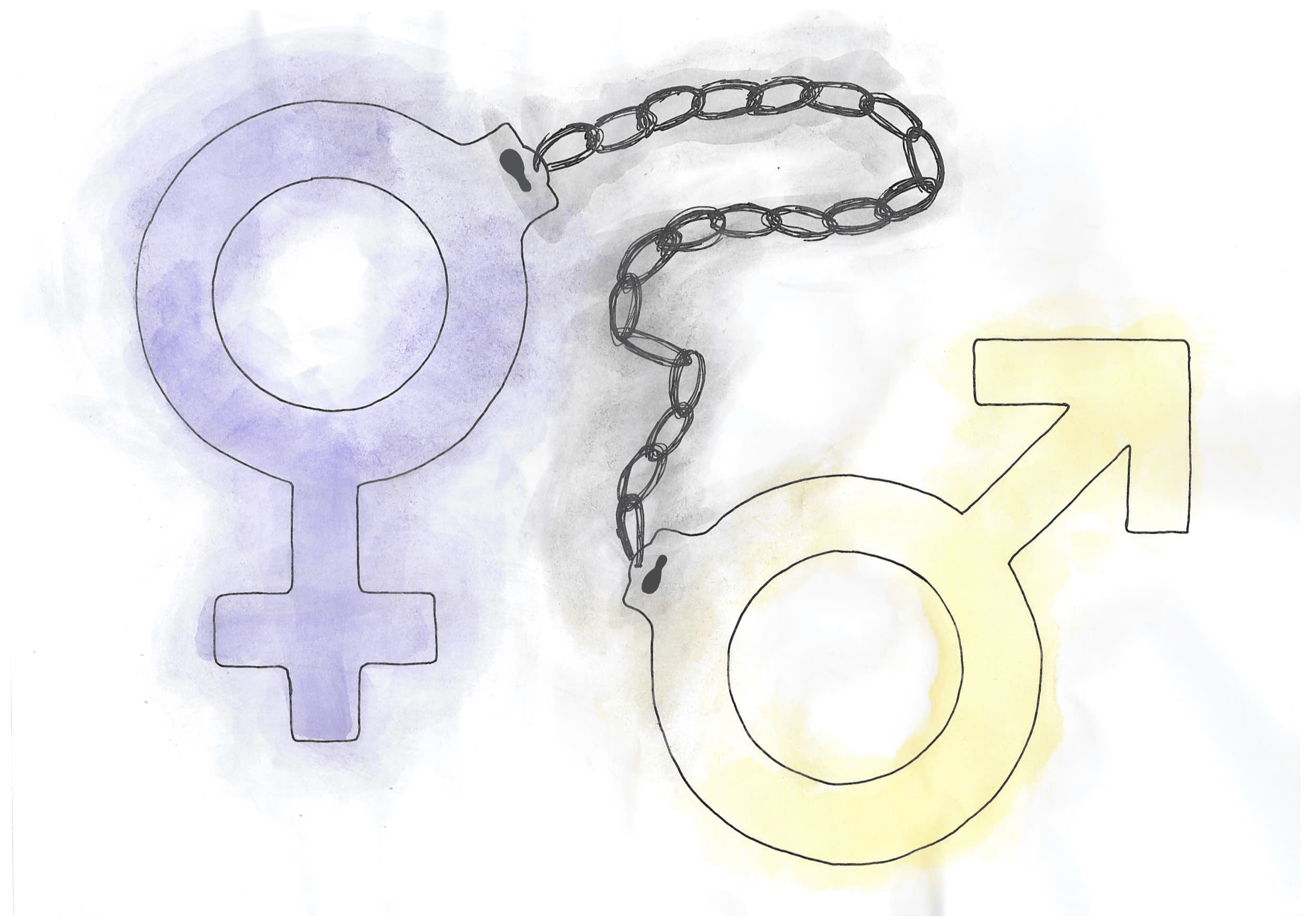Die Jungautorin Anna Weidenholzer über den Entstehungsprozess ihres jüngst im Residenzverlag erschienenen Romans Der Winter tut den Fischen gut, ihren Zugang zum Schreiben und Sprachminimalismus.
progress: Dein erster Roman Der Winter tut den Fischen gut ist gerade im Residenzverlag erschienen. Wann hast du zu schreiben begonnen?
Anna Weidholzer: Ich hab immer geschrieben. Schon als Kind, später mal mehr, mal weniger. Während und nach dem Studium hab ich im Journalismus gearbeitet. Ich habe dann in Leonding die Leondinger Akademie für Literatur besucht. Dort habe ich den Literaturbetrieb kennengelernt, welche Zeitschriften, Stipendien und Preise es gibt und begonnen, die ersten Sachen einzureichen. So ist dann alles ins Laufen gekommen.
Wie hast du es geschafft, bei einem so großen Verlag wie dem Residenzverlag unterzukommen?
Über das erste Buch Der Platz des Hundes, das beim Welser Mitter Verlag erschien. Mein jetziger Lektor bekam es empfohlen, hat es gelesen und war begeistert. Irgendwann war dann ein Mail von ihm in meinem Posteingang.
Wie hast du dich dem Thema deines Romans genähert?
Es geht um Maria, eine arbeitslose Frau. Sie ist eine Textilfachverkäuferin, verliert mit Ende vierzig ihren Arbeitsplatz und ist dann in dieser schwierigen Situation, dass sie als für den Arbeitsmarkt zu alt und als schwer vermittelbar gilt. Sie verliert damit auch ihr soziales Umfeld und kommt immer mehr in die Isolation. Für das Buch hab ich beim AMS recherchiert, mit einem Arbeitslosenverein zusammengearbeitet und mit arbeitslosen Frauen gesprochen, alle so um die vierzig. Aus den Gesprächen hat sich dann auch die Struktur des Buches ergeben. Marias Leben wird rückwärts erzählt. In längeren und kürzeren Kapiteln wird ihre Geschichte aufgerollt. Der Ausgangspunkt war der, dass ich jedes Mal einer Frau begegnet bin, von der ich außer ihrem Namen nur wusste, dass sie langzeitarbeitslos ist. Dann sprachen wir miteinander und es ergaben sich kleine Mosaike aus ihrem Leben. Man sieht nach ein paar Stunden Gespräch die Person ganz anders. Das wollte ich in dem Buch nachbilden, dass man die arbeitslose Maria nicht nur als Arbeitslose sieht, sondern in ihrer ganzen Geschichte, weil sie denGroßteil ihres Lebens ja auch anders verbracht hat.
In der Protagonistin Maria stecken also verschiedene Geschichten über Arbeitslosigkeit?
Ja, es geht aber nicht nur um Arbeitslosigkeit, sondern auch ganz stark um Identität. Es sind mehrere kleine Geschichten, die immer mehr aus ihrem Leben ergeben.
War es für dich wichtig, eine Frau als Hauptcharakter zu wählen?
Bei dem Thema schon. Weil es für Frauen einfach noch einmal schwieriger ist, in dem Alter eine Arbeit zu finden. Mir war es deswegen wichtig, dass Maria eine Frau ist, und ich habe auch die Interviews nur mit Frauen geführt.
Warum das Thema Arbeitslosigkeit?
Es sind da mehrere Faktoren zusammengekommen. Das Thema hat mich schon länger beschäftigt. Der ausschlaggebende Moment zur Figur Marias war wohl beim Theater Hausruck in Attnang-Puchheim in Oberösterreich. Dort wurde ein Stück in einer ehemaligen Fabrik aufgeführt, eine Polstermöbelfabrik, die in Konkurs gegangen ist. Am Schluss des Stücks gab es eine Szene, wo in einem Lagerregal statt Waren Menschen in den Fächern waren. Die SchauspielerInnen haben einfach die Geschichten von Arbeitslosen in der Region erzählt. Also ganz normale Geschichten, Biographien, wo dann der Bruch dadurch kommt, dass man den Arbeitsplatz und das Umfeld verliert. Das war der zündende Moment zu den Interviews. Ich glaube, dass Arbeitslosigkeit immer ein Thema ist, solange es Arbeit gibt. Und dass die Tatsache, als was, wo und ob man arbeitet, sehr viel im Leben bestimmt.
In deinem Roman verstecken sich viele Zitate. In den Quellen ist auch die bekannte Studie Die Arbeitslosen von Marienthal von Paul Lazarsfeld und Marie Jahoda angeführt. Inwiefern spielte diese eine Rolle für dein Werk?
Die Studie war eine Basis für mein Buch. Ich habe es in den Interviews und der Recherche spannend gefunden, was sich in den 80 Jahren seit ihrem Erscheinen geändert hat – und das eigentlich relativ viel gleich geblieben ist. Die Art etwa, wie man mit Arbeitslosigkeit umgeht. Es gibt verschiedene Typen: die, die zuhause bleiben, nichts mehr machen und ihre Kinder nicht mehr versorgen, oder die, die noch ein bisschen aktiver sind und mit der Situation besser umgehen. Es war natürlich ganz ein anderes Umfeld in Marienthal 1933 als in Oberösterreich 2010, aber es gibt Parallelen. Ich denke, Arbeitslosigkeit wird immer ein großes Thema für die Betroffenen, aber auch für Nichtbetroffene bleiben. Es ist ein ziemliches Tabuthema. Es war zum Beispiel irrsinnig schwierig, Interviewpartnerinnen zu finden, die über ihre Situation sprechen wollten. Die wenigsten stehen zu ihrer Arbeitslosigkeit. Die meisten sagen: „Ich orientiere mich neu.“ oder: „Ich schau jetzt einmal.“
Es kommt auch ein Zitat aus Hildegard Knefs Rote Rosen vor …
Im Buch sind viele Zitate aus Schlagern und Ratgebern. Ganz am Anfang zum Beispiel: „Machen sie konsequent systematisch parallel schnell und viel.“ Das ist so ein Ratgeber-Satz. Die vielen Schlager kommen vor, einfach weil Maria gerne Schlager hört und davon träumt, Sängerin zu sein. Auch Elvis kommt oft vor, weil ihr verstorbener Mann Elvis-Imitator war. Ich habe für das Buch viel Elvis und Schlager gehört. Was gut zur Figur passt, hab ich dann hineingenommen. Oder auch, was ich in Cafés gehört habe.
Hast du dich zum Schreiben bewusst an Orte begeben, an denen du dich sonst nicht aufhältst, die aber zu Maria passen?
Eigentlich bin ich mehr durch Zufall dort hingekommen und hab mir dann gedacht, das passt gut zu Maria. Einmal zum Beispiel war ich in so einem Beisl beim Franz-Josefs-Bahnhof in Wien. Weil alles schon zugehabt hat, sind wir dort hineingegangen. Das war einfach super dort. Es gab nur zwei Sorten Wein, Rot oder Weiß, auf dem Tisch war ein Foto von einem Hund. Meine Freundin hat gefragt, wo dieser Hund ist und die Kellnerin deutete zum Fenster, wo eine Urne stand, mit dem Hund drinnen. Daraus ist das Bistro Brigitte im Buch entstanden.
Ist es nicht sehr schwierig, über ein Milieu zu schreiben, aus dem man selbst nicht stammt? Die Grenze zum Voyeurismus ist doch oft sehr schmal.
Wenn man mit dem Finger auf Leute zeigt, sich über sie lustig macht, um sich selbst weiter oben zu sehen, wird es problematisch. Dann wird das Ganze zum Sozialporno, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Sicher, ich habe einen anderen Hintergrund als meine Protagonistin Maria, ich habe studiert, sie hat eine Lehre gemacht. Aber das ist ja das Spannende am Schreiben, den eigenen Horizont zu erweitern und sich mit anderen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. Mich interessieren die Ecken, wo der Scheinwerfer nicht hingelangt, das Alltägliche, das Absurde im Alltäglichen, ohne zu erklären oder zu belehren. Beschreiben, ohne bloßzustellen, den Figuren ihre Würde lassen.
Die Sprache in deinem Buch ist eher langsam und stark im Detail. Ist das dein üblicher Schreibstil oder eher ein Resultat der Handlung?
Es ist generell schon eher meine Schreibweise. Am Anfang des Buches sind vielleicht noch mehr Details, weil die Protagonistin alleine ist, und wenn man alleine ist ja auch nicht wirklich viel passiert.
Du verwendest außerdem eine sehr reduzierte Sprache, keine Fragezeichen, keine Ausrufezeichen …
Genau. Ich verwende auch keine Anführungszeichen. Mir kommt das oft zu stark vor. Ich mag es, wenn ein Text fließend ist und offen bleibt. Mir sind manche Wörter einfach zu viel. Ich habe eher einen minimalistischen Zugang zur Sprache. Die Protagonistin wirkt im Laufe der Arbeitslosigkeit immer neurotischer und esoterischer, nicht nur durch die Sprache. Sie hört auf, zum AMS zu gehen und versucht es mit Ratgeber und Selbstoptimierungsliteratur. Sie beginnt etwa, Zettel mit Sätzen von in ihren Augen erfolgreichen Menschen auf den Spiegel zu kleben. Das ist diese Universumsgeschichte: Wenn man stark genug ans Universum glaubt, wird es alles richten. Das findet man in einem Bestseller-Ratgeber namens The Secret. Da steht etwa, dass man Rechnungen immer zerreißen soll, denn mit ihnen kommt Schlechtes ins Leben. Je mehr Rechnungen man bekommt, desto mehr glaubt man, dass man welche bekommt und man kriegt so nur noch Rechnungen. In solchen Ratgebern fällt die Schuld immer auf das Individuum zurück: Wenn ich mich an das halten würde, was in dem Ratgeber steht, würde ich auch aus der Situation rauskommen. Indem ich das aber nicht ganz schaffe, scheitere ich weiter. Es fällt alles auf das Individuum zurück – so als ob es keine gesellschaftliche oder soziale Verantwortung gäbe.
Lesungen und Termine:
http://annaweidenholzer.at/http://annaweidenholzer.at/termine
Zur Person
Anna Weidenholzer wurde 1984 in Linz geboren und hat Vergleichende Literaturwissenschaft in Wien und Wrocław studiert. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, unter anderen den Alfred-Gesswein-Preis 2009. Mit ihrem Erzählband Der Platz des Hundes war sie für das Europäische Festival des Debütromans in Kiel nominiert. 2011 erhielt sie das Österreichische Staatsstipendium für Literatur.
Die Jungautorin Anna Weidenholzer über den Entstehungsprozess ihres jüngst im Residenzverlag erschienenen Romans Der Winter tut den Fischen gut, ihren Zugang zum Schreiben und Sprachminimalismus.
progress: Dein erster Roman Der Winter tut den Fischen gut ist gerade im Residenzverlag erschienen. Wann hast du zu schreiben begonnen?
Anna Weidholzer: Ich hab immer geschrieben. Schon als Kind, später mal mehr, mal weniger. Während und nach dem Studium hab ich im Journalismus gearbeitet. Ich habe dann in Leonding die Leondinger Akademie für Literatur besucht. Dort habe ich den Literaturbetrieb kennengelernt, welche Zeitschriften, Stipendien und Preise es gibt und begonnen, die ersten Sachen einzureichen. So ist dann alles ins Laufen gekommen.
Wie hast du es geschafft, bei einem so großen Verlag wie dem Residenzverlag unterzukommen?
Über das erste Buch Der Platz des Hundes, das beim Welser Mitter Verlag erschien. Mein jetziger Lektor bekam es empfohlen, hat es gelesen und war begeistert. Irgendwann war dann ein Mail von ihm in meinem Posteingang.
Wie hast du dich dem Thema deines Romans genähert?
Es geht um Maria, eine arbeitslose Frau. Sie ist eine Textilfachverkäuferin, verliert mit Ende vierzig ihren Arbeitsplatz und ist dann in dieser schwierigen Situation, dass sie als für den Arbeitsmarkt zu alt und als schwer vermittelbar gilt. Sie verliert damit auch ihr soziales Umfeld und kommt immer mehr in die Isolation. Für das Buch hab ich beim AMS recherchiert, mit einem Arbeitslosenverein zusammengearbeitet und mit arbeitslosen Frauen gesprochen, alle so um die vierzig. Aus den Gesprächen hat sich dann auch die Struktur des Buches ergeben. Marias Leben wird rückwärts erzählt. In längeren und kürzeren Kapiteln wird ihre Geschichte aufgerollt. Der Ausgangspunkt war der, dass ich jedes Mal einer Frau begegnet bin, von der ich außer ihrem Namen nur wusste, dass sie langzeitarbeitslos ist. Dann sprachen wir miteinander und es ergaben sich kleine Mosaike aus ihrem Leben. Man sieht nach ein paar Stunden Gespräch die Person ganz anders. Das wollte ich in dem Buch nachbilden, dass man die arbeitslose Maria nicht nur als Arbeitslose sieht, sondern in ihrer ganzen Geschichte, weil sie denGroßteil ihres Lebens ja auch anders verbracht hat.
In der Protagonistin Maria stecken also verschiedene Geschichten über Arbeitslosigkeit?
Ja, es geht aber nicht nur um Arbeitslosigkeit, sondern auch ganz stark um Identität. Es sind mehrere kleine Geschichten, die immer mehr aus ihrem Leben ergeben.
War es für dich wichtig, eine Frau als Hauptcharakter zu wählen?
Bei dem Thema schon. Weil es für Frauen einfach noch einmal schwieriger ist, in dem Alter eine Arbeit zu finden. Mir war es deswegen wichtig, dass Maria eine Frau ist, und ich habe auch die Interviews nur mit Frauen geführt.
Warum das Thema Arbeitslosigkeit?
Es sind da mehrere Faktoren zusammengekommen. Das Thema hat mich schon länger beschäftigt. Der ausschlaggebende Moment zur Figur Marias war wohl beim Theater Hausruck in Attnang-Puchheim in Oberösterreich. Dort wurde ein Stück in einer ehemaligen Fabrik aufgeführt, eine Polstermöbelfabrik, die in Konkurs gegangen ist. Am Schluss des Stücks gab es eine Szene, wo in einem Lagerregal statt Waren Menschen in den Fächern waren. Die SchauspielerInnen haben einfach die Geschichten von Arbeitslosen in der Region erzählt. Also ganz normale Geschichten, Biographien, wo dann der Bruch dadurch kommt, dass man den Arbeitsplatz und das Umfeld verliert. Das war der zündende Moment zu den Interviews. Ich glaube, dass Arbeitslosigkeit immer ein Thema ist, solange es Arbeit gibt. Und dass die Tatsache, als was, wo und ob man arbeitet, sehr viel im Leben bestimmt.
In deinem Roman verstecken sich viele Zitate. In den Quellen ist auch die bekannte Studie Die Arbeitslosen von Marienthal von Paul Lazarsfeld und Marie Jahoda angeführt. Inwiefern spielte diese eine Rolle für dein Werk?
Die Studie war eine Basis für mein Buch. Ich habe es in den Interviews und der Recherche spannend gefunden, was sich in den 80 Jahren seit ihrem Erscheinen geändert hat – und das eigentlich relativ viel gleich geblieben ist. Die Art etwa, wie man mit Arbeitslosigkeit umgeht. Es gibt verschiedene Typen: die, die zuhause bleiben, nichts mehr machen und ihre Kinder nicht mehr versorgen, oder die, die noch ein bisschen aktiver sind und mit der Situation besser umgehen. Es war natürlich ganz ein anderes Umfeld in Marienthal 1933 als in Oberösterreich 2010, aber es gibt Parallelen. Ich denke, Arbeitslosigkeit wird immer ein großes Thema für die Betroffenen, aber auch für Nichtbetroffene bleiben. Es ist ein ziemliches Tabuthema. Es war zum Beispiel irrsinnig schwierig, Interviewpartnerinnen zu finden, die über ihre Situation sprechen wollten. Die wenigsten stehen zu ihrer Arbeitslosigkeit. Die meisten sagen: „Ich orientiere mich neu.“ oder: „Ich schau jetzt einmal.“
Es kommt auch ein Zitat aus Hildegard Knefs Rote Rosen vor …
Im Buch sind viele Zitate aus Schlagern und Ratgebern. Ganz am Anfang zum Beispiel: „Machen sie konsequent systematisch parallel schnell und viel.“ Das ist so ein Ratgeber-Satz. Die vielen Schlager kommen vor, einfach weil Maria gerne Schlager hört und davon träumt, Sängerin zu sein. Auch Elvis kommt oft vor, weil ihr verstorbener Mann Elvis-Imitator war. Ich habe für das Buch viel Elvis und Schlager gehört. Was gut zur Figur passt, hab ich dann hineingenommen. Oder auch, was ich in Cafés gehört habe.
Hast du dich zum Schreiben bewusst an Orte begeben, an denen du dich sonst nicht aufhältst, die aber zu Maria passen?
Eigentlich bin ich mehr durch Zufall dort hingekommen und hab mir dann gedacht, das passt gut zu Maria. Einmal zum Beispiel war ich in so einem Beisl beim Franz-Josefs-Bahnhof in Wien. Weil alles schon zugehabt hat, sind wir dort hineingegangen. Das war einfach super dort. Es gab nur zwei Sorten Wein, Rot oder Weiß, auf dem Tisch war ein Foto von einem Hund. Meine Freundin hat gefragt, wo dieser Hund ist und die Kellnerin deutete zum Fenster, wo eine Urne stand, mit dem Hund drinnen. Daraus ist das Bistro Brigitte im Buch entstanden.
Ist es nicht sehr schwierig, über ein Milieu zu schreiben, aus dem man selbst nicht stammt? Die Grenze zum Voyeurismus ist doch oft sehr schmal.
Wenn man mit dem Finger auf Leute zeigt, sich über sie lustig macht, um sich selbst weiter oben zu sehen, wird es problematisch. Dann wird das Ganze zum Sozialporno, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Sicher, ich habe einen anderen Hintergrund als meine Protagonistin Maria, ich habe studiert, sie hat eine Lehre gemacht. Aber das ist ja das Spannende am Schreiben, den eigenen Horizont zu erweitern und sich mit anderen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. Mich interessieren die Ecken, wo der Scheinwerfer nicht hingelangt, das Alltägliche, das Absurde im Alltäglichen, ohne zu erklären oder zu belehren. Beschreiben, ohne bloßzustellen, den Figuren ihre Würde lassen.
Die Sprache in deinem Buch ist eher langsam und stark im Detail. Ist das dein üblicher Schreibstil oder eher ein Resultat der Handlung?
Es ist generell schon eher meine Schreibweise. Am Anfang des Buches sind vielleicht noch mehr Details, weil die Protagonistin alleine ist, und wenn man alleine ist ja auch nicht wirklich viel passiert.
Du verwendest außerdem eine sehr reduzierte Sprache, keine Fragezeichen, keine Ausrufezeichen …
Genau. Ich verwende auch keine Anführungszeichen. Mir kommt das oft zu stark vor. Ich mag es, wenn ein Text fließend ist und offen bleibt. Mir sind manche Wörter einfach zu viel. Ich habe eher einen minimalistischen Zugang zur Sprache. Die Protagonistin wirkt im Laufe der Arbeitslosigkeit immer neurotischer und esoterischer, nicht nur durch die Sprache. Sie hört auf, zum AMS zu gehen und versucht es mit Ratgeber und Selbstoptimierungsliteratur. Sie beginnt etwa, Zettel mit Sätzen von in ihren Augen erfolgreichen Menschen auf den Spiegel zu kleben. Das ist diese Universumsgeschichte: Wenn man stark genug ans Universum glaubt, wird es alles richten. Das findet man in einem Bestseller-Ratgeber namens The Secret. Da steht etwa, dass man Rechnungen immer zerreißen soll, denn mit ihnen kommt Schlechtes ins Leben. Je mehr Rechnungen man bekommt, desto mehr glaubt man, dass man welche bekommt und man kriegt so nur noch Rechnungen. In solchen Ratgebern fällt die Schuld immer auf das Individuum zurück: Wenn ich mich an das halten würde, was in dem Ratgeber steht, würde ich auch aus der Situation rauskommen. Indem ich das aber nicht ganz schaffe, scheitere ich weiter. Es fällt alles auf das Individuum zurück – so als ob es keine gesellschaftliche oder soziale Verantwortung gäbe.
Lesungen und Termine:
http://annaweidenholzer.at/http://annaweidenholzer.at/termine
Zur Person
Anna Weidenholzer wurde 1984 in Linz geboren und hat Vergleichende Literaturwissenschaft in Wien und Wrocław studiert. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, unter anderen den Alfred-Gesswein-Preis 2009. Mit ihrem Erzählband Der Platz des Hundes war sie für das Europäische Festival des Debütromans in Kiel nominiert. 2011 erhielt sie das Österreichische Staatsstipendium für Literatur.