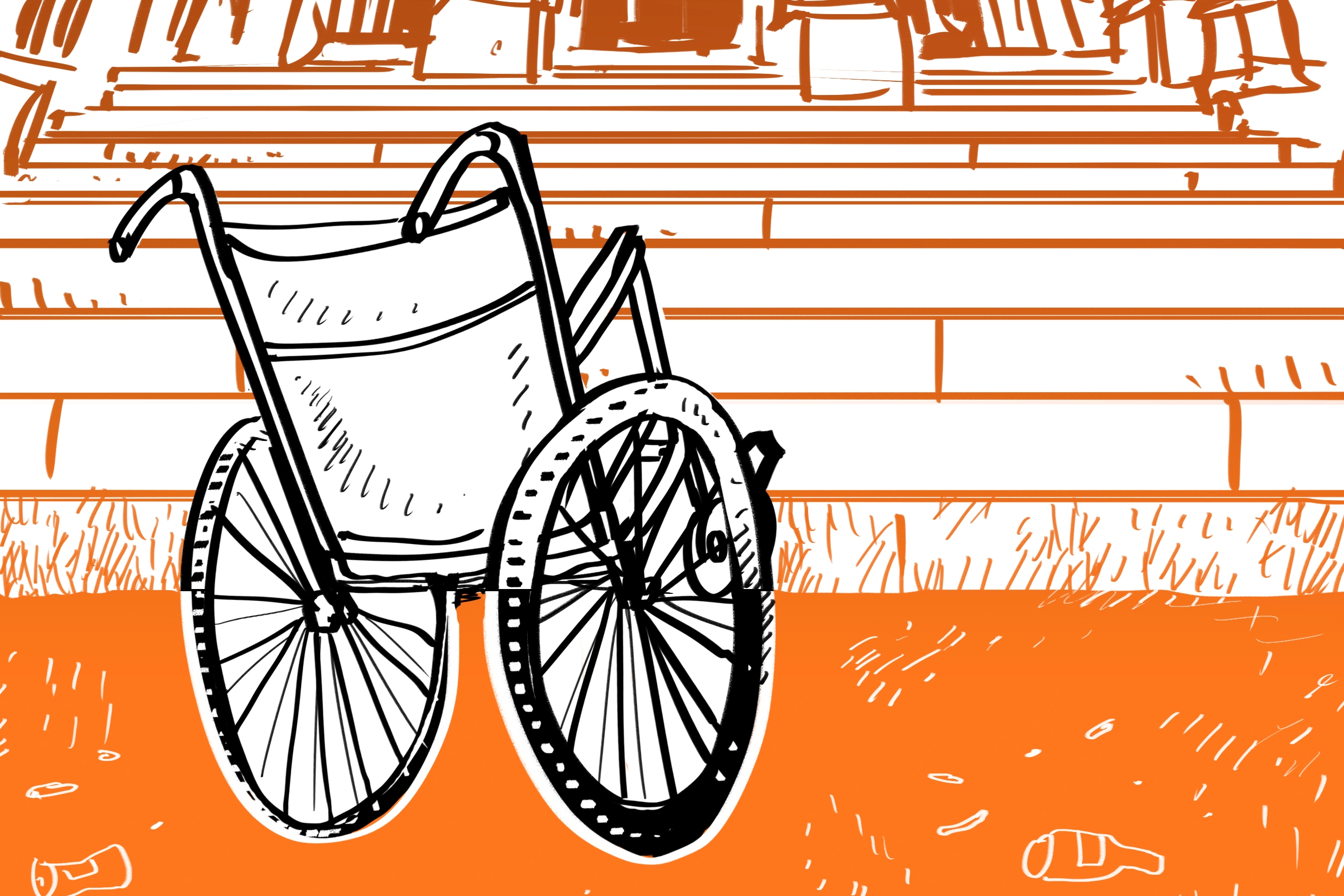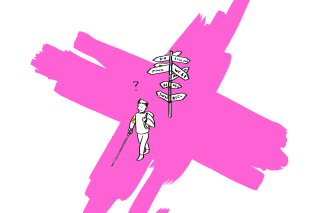Das Ende der EUphorie?
Die Jugend fühlt sich von der EU im Stich gelassen. Arbeitslosigkeit und ein Mangel an Perspektiven nehmen ihnen zusehends das Vertrauen in Europa. Immer mehr junge Menschen sehen sich nach politischen Alternativen um.

Wer als junger Mensch in der EU mitreden möchte, muss viel Zeit und Geduld investieren, weiß Emma Hovi aus eigener Erfahrung. Die 24-jährige Wahl-Berlinerin war nach ihrer Schulzeit ein Jahr im Vorstand der Europäischen SchülerInnenvertretung OBESSU aktiv. Freundschaften konnte Hovi während dieser Zeit viele knüpfen. Aber die Arbeit in der Interessenvertretung hat sie zynisch werden lassen. „Wie wichtig die Jugend sei, wird in den Institutionen der EU überall betont. Wenn junge Menschen aber tatsächlich mitreden möchten, stehen sie schnell vor verschlossenen Türen“, meint Hovi. Ein ranghoher Kommissionsbeamter als Gast bei einer der vielen Veranstaltungen der Jugendorganisation sei eine Ehre gewesen, aber keine Selbstverständlichkeit.
Seit Ausbruch der Finanzkrise sinkt der Zuspruch, den die Europäische Union bei ihren BürgerInnen findet, stetig, das zeigen viele Statistiken. Laut Eurobarometer gab im Herbst 2013 nur noch ein Drittel der EU-BürgerInnen an, Vertrauen in die Europäische Union und ihre Politik zu haben. Dass sie damit noch besser abschnitt als die nationalen Regierungen, ist ein schwacher Trost. Den höchsten Zuspruch bekam die EU von den unter 24-Jährigen. Befürchtet wird aber, dass selbst diese Zahlen kippen könnten. Die Sparpolitik in Griechenland hat nicht nur drastische Folgen für das Land, sie hat auch Ratlosigkeit bei der Bevölkerung der anderen EU-Länder hinterlassen. Die Bilder aus Griechenland liegen vielen jungen EuropäerInnen schwer im Magen. Viele suchen bei nationalistischen Parteien einfache politische Antworten auf die Krise. Das sinkende Interesse der Jugend für die EU zeigte sich aber schon an der niedrigen Beteiligung bei der letzten EU-Wahl: 2009 nahmen weniger als ein Drittel der Jugendlichen ihr Wahlrecht in Anspruch, so eine Studie des Europäischen Jugendforums. Ein Ergebnis, dem die EU mit mehr jugendpolitischen Maßnahmen entgegenwirken möchte. Mit dem sogenannten „Strukturierten Dialog“ sollen Jugendorganisationen bei der Ausarbeitung politischer Zielsetzungen schrittweise eingebunden werden. Auch im Entwicklungsplan „Europa 2020“, der den Rahmen für die Politik der nächsten Jahre vorgibt, hat die Jugend einen hohen Stellenwert und in der gegenwärtigen Krise entstanden gleich drei Programme gegen Jugendarbeitslosigkeit. Gleichzeitig ist die europäische Jugendpolitik mit dem Problem konfrontiert, dass die Kompetenzen in dieser Hinsicht meist auf nationaler Ebene liegen. Was auf europäischer Ebene diskutiert wird, findet daher oft keine direkte Umsetzung. Jugendorganisationen können sich auf europäischer Ebene noch so engagieren, Resultate ihrer Bemühungen sind in den meisten Fällen nicht mehr als Empfehlungen und vage Absichtserklärungen.



Krisenerscheinungen. So klein die politische Macht der EU in manchen Bereichen auch scheint, umso stärker spürbar sind die Auswirkungen ihrer Krisenpolitik. Unter dem Banner der Austeritätspolitik erklärte die EU die Konsolidierung desgriechischen Staatshaushaltes durch rigide Sparmaßnahmen zum primären Ziel und entschied damit, Kapitalinteressen absoluten Vorrang zu geben. Die Aufzählung der Einsparungen in Griechenland liest sich wie eine Checkliste zur Demontage des sozialen Wohlfahrtstaats: Kürzungen wurden vor allem im öffentlichen Dienst, bei Gehältern und Pensionen sowie bei sozialen Subventionen und im Gesundheitswesen vorgenommen, das Arbeitsrecht wurde flexibilisiert und Schutzbestimmungen abgebaut. Mit buchhalterischem Erfolg: 2013 bilanzierte Griechenland zum ersten Mal in seiner Geschichte positiv. Der Preis dafür war jedoch immens hoch. So zeigten sich selbst der Internationale Währungsfond und die EU-Kommission im Vorjahr erstaunt angesichts der gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Sparziele. Zu diesem Zeitpunkt lehnten in einer Gallup-Umfrage 94 Prozent der Menschen in Griechenland und 51 Prozent innerhalb der anderen EU-Länder die Maßnahmen ab und verlangten nach Alternativen. Eine Jugendarbeitslosenquote jenseits der 60 Prozent, prekäre Arbeitsbedingungen und unterfinanzierte Universitäten haben der jungen Generation die Zukunft verbaut. Selbst AbsolventInnen von etablierten Studienfächern wie Medizin, Architektur oder Rechtswissenschaften müssen heute um jedes unterbezahlte Praktikum kämpfen. Während sich die Miete für eine kleine Bleibe in Athen auf 300 Euro beläuft, liegt der Mindestlohn für junge ArbeitnehmerInnen knapp über 500 Euro. Viele junge Erwachsene mussten wieder zurück ins Elternhaus ziehen. Nicht wenige flüchten sich vor den deprimierenden Zukunftsaussichten in Rauschwelten oder Suizid. In Griechenland wurde in den letzten Jahren das Gegenteil der zuvor geplanten europäischen Jugendmaßnahmen umgesetzt, was für eine Hochkonjunktur der Kritik sorgte.
Katerina Anastasiou will über die Zustände in Griechenland informieren. Die 30-jährige Griechin lebt seit zehn Jahren in Wien und engagiert sich bei der Organisation solidarity4all. Sie sei oft erschrocken, wie wenig und wie einseitig hierzulande die Medien von ihrer Heimat berichten, erzählt die junge Linke, die an der jetzigen EU nur wenig Gutes sieht. Die Krise habe die negative Seite vieler politischer Maßnahmen der letzten Zeit deutlicher in Erscheinung treten lassen. Mit Hilfe der Reise- und Niederlassungsfreiheit haben viele GriechInnen versucht der Misere zu entkommen, nur um andernorts feststellen zu müssen, dass aus ihrer Notlage erneut Profit geschlagen wird. Einiger ihrer Bekannten seien hochqualifiziert nach Wien gekommen und sahen sich hier damit konfrontiert, dass ihnen zwar adäquate Jobs angeboten wurden, aber mit einer unüblich niedrigen Bezahlung, schildert Anastasiou. Für sie fehlt es hier an einem solidarischen europäischen Bewusstsein: „Damit wird die Chance vergeben, gemeinsam gegen etwas aufzutreten!“
Mit vielen anderen ist Anastasiou auf der Suche nach Alternativen zum gegenwärtigen System. Vereinzelt und mancherorts seien solche durchaus greifbar: „Als 2011 die Proteste vom Syntagma-Platz in Athen verschwanden, lag das nicht nur an der repressiven Polizeigewalt“, erzählt Katerina Anastasiou, „nach dem ersten Schock begannen die Menschen ihr Schicksal schlichtweg selbst in die Hand zu nehmen.“ Mittlerweile finden sich vielerorts kommunale Strukturen, die medizinische Versorgung bieten, Lebensmittel und Dienstleistungen zur Verfügung stellen und Bildungsangebote geschaffen haben, ohne viel Gegenleistung zu erwarten. Diese kommunalen Solidaritätsbewegungen setzen dort an, wo staatliche Strukturen fehlen. Deshalb beabsichtigt Anastasiou auch in naher Zukunft wieder zurück nach Griechenland zu gehen. Um „dabei sein zu können, wenn etwas Neues entsteht“. Das Vorgehen der EU im Fall Griechenland und der Vorrang von finanziellen vor sozialen Interessen bestätigt all jene, die die EU seit jeher als neoliberales Konstrukt sahen. In der Krise offenbart sie nun auch dem Rest von Europa ihre politischen Prioritäten.
Davon profitieren aber auch rechte EU-KritikerInnen. Im April gründete die FPÖ-Jugend zusammen mit den Jugendorganisationen vom Front National, von Vlaams Belang und den Schwedendemokraten die Initiative Young Europeans Alliance for Hope (YEAH). In ihrem Manifest befürworten sie die Nation als „überlegene Form der Gemeinschaft“. Wenn es darum geht, die europäische Integration zu kritisieren, können selbst rechtspopulistische Parteien transnational kooperieren. Mit absehbarem Erfolg: In Österreich liegt die FPÖ bei den Jungen wie gewohnt auch in den Umfragen zur Europawahl weit vorne. Europaweit wird ein starker Zuwachs für jene Parteien, die regelmäßig gegen die EU wettern, erwartet.
Reine Rhetorik? Sind die Bemühungen der EU um verstärkte jugendpolitische Maßnahmen, BürgerInnenrechte, soziale Inklusion, europäische Integration und die Genese einer europäischen Identität nur Rhetorik? Will die EU weg vom neoliberalen Status Quo, muss sie diese Ziele ernsthaft verfolgen. Der Politikwissenschafter Stefan Seidendorf beschäftigt sich mit der Frage, was es braucht, damit die EU zu einer solidarischen Gemeinschaft wird. Er nennt drei wesentliche Faktoren: Erstens, die Ausformung europäischer Institutionen, durch die eine legitime rechtliche Grundlage für ihre Politik entsteht. Zweitens, ein klar abgegrenztes Gruppenbewusstsein, das zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern unterscheiden lässt. Und drittens, einen gemeinsamen Sinnhorizont, der sich aus einer geteilten Vergangenheit und Symboliken der Gemeinschaft eröffnet. Gibt es dieses Gruppenbewusstsein und diesen Sinnhorizont bei jungen EuropäerInnen bereits?



Die Studierenden von heute sind die erste Generation, die in die Europäische Union hineingeboren wurde. Der Vertrag von Maastricht wurde Ende 1993 ratifiziert. Jene, die damals gerade erst zur Welt gekommen sind, sind heute Anfang zwanzig. Sie sind mit der EU groß geworden und haben ihre Entwicklung miterlebt. Sie haben die Einführung des Euros miterlebt, Krieg und Gewalt kennen sie zum Großteil nur aus der Zeitung. Von der Reisefreiheit des Schengener Abkommens profitieren sie seit ihrem ersten Urlaub und seit 25 Jahren lernen sie über Programme wie Erasmus andere europäische Länder kennen. 250.000 Studierende nehmen mittlerweile jährlich am Austauschprogramm teil. Es zählt zu den erfolgreichsten Projekten der EU. Heuer wurde es erneuert: ERASMUS+ vereint nun weitere Austauschprogramme in den Bereichen Bildung, Jugend und Sport unter einen Namen. In den nächsten sieben Jahren stehen dafür knapp 15 Milliarden Euro zur Verfügung. Vier Millionen Jugendliche sollen davon profitieren. Dieses Engagement seitens der EU hat seine Effekte: Der Eurobarometer vom Herbst 2013 wies SchülerInnen und Studierende als einzige demografische Gruppe aus, die der EU mehrheitlich vertraute. Das liegt vermutlich auch daran, dass Jugendliche im Bildungsbereich am Ehesten noch mit ihren Programmen in Kontakt kommen. Immerhin fünf Prozent der Jugendlichen nahmen laut der Youth on the Move-Studie von 2011 schon an einem Austauschprogramm teil. Die restlichen 95 Prozent kommen mit EU-Projekten, wenn überhaupt, nur selten in Kontakt.
Sie begeben sich entweder selbst auf Recherche, oder müssen sich mit den wenigen Medienberichten begnügen. Die geringe Rolle, die die EU zuweilen in den Nachrichten hat, haben die Medien der einzelnen Mitgliedsstaaten zu verantworten, die der EU oft nur wenig Beachtung schenken: Dazu gesellt sich auch oft eine antieuropäische Rhetorik. Wenn Zeitungen über „PleitegriechInnen“ oder „RumänInnenbanden“ schreiben und PolitikerInnen Blame-Shifting in Richtung EU betreiben, hindern sie damit die EU daran, eine Gemeinschaft zu werden. Derzeit sieht sich eine knappe Mehrheit der EU-BürgerInnen noch als EuropäLeague of Young VoterserInnen, aber gleichzeitig zeigen Studien, dass die Heimatverbundenheit wieder am Steigen ist, zwei Drittel der EuropäerInnen glauben außerdem nicht mehr, dass ihre Stimme in Europa Einfluss hat.
Diese Einstellung versuchen viele Initiativen im Vorfeld der EU-Wahl zu ändern. Johanna Nyman betreut eine davon. Die Biologie-Studentin sitzt im Vorstand des Europäischen Jugendforums und koordiniert das Projekt League of Young Voters, das Jugendlichen und Jugendorganisationen als Austausch-Plattform dienen soll. Die Initiative sei eine Reaktion auf die erschreckend niedrige Wahlbeteiligung unter den Jugendlichen bei der Europawahl 2009, so Nyman. Die Erfahrung, dass Anliegen vielerorts gleich sind und die JungwählerInnen in der EU eine größere Gruppe sind als erwartet, soll diese zurück an die Wahlurnen bringen. Die Plattform selbst findet noch geringen Anklang, aber aus der Idee entstanden weitere Projekte: Auf MyVote2014.eu können UserInnen mittels 15 Fragen herausfinden, welche Partei am besten zu ihren eigenen Vorstellungen passt.
Dazu bekommen sie Informationen über die Abgeordneten und ihre Parteien. Das Prinzip kommt dem Nutzungsverhalten von Jugendlichen in Bezug auf Online-Medien: Schnell, interaktiv und optisch ansprechend wird der Einstieg in die Meinungsbildung erleichtert.
Welche Krise? Ist es ein Irrglaube, wenn wir als Studierende in Zentraleuropa, die mitunter auch von der EU profitieren, annehmen, ohne EU ginge es nicht? Einige Sozialwissenschafter wie etwa Alex Demirović weisen immer wieder darauf hin, dass nicht die Demokratie selbst, sondern ihre alten Institutionen in der Krise stecken. Systeme wie Staaten oder die EU befinden sich in einer Situation, in der die Parlamente nur noch reine Mitbestimmungsgremien sind. Wichtige Entscheidungen werden intransparent anderswo getroffen. Solange der Staat aber seinen Aufgaben nachkommt, dominiert ein Verständnis von Demokratie, das ohne Staat nicht denkbar ist. Die Soziologin Donnatella della Porta vom European University Institute sieht in der Vertrauenskrise durchaus auch positive Seiten. Durch sie öffnen sich Räume für neue Formen des demokratischen Zusammenlebens. Selbst wenn kommunale Bewegungen wie in Griechenland noch keinen alternativen Modellcharakter für die EU haben, zeigen sie doch auf, was politische Partizipation jenseits des Wahlgangs heißen kann.
In welche Richtung sich Europa bewegen wird, werden die nächsten Jahre entscheiden. Das hängt nicht allein davon ab, ob die Europäische Union die Folgen ihrer Krisenpolitik eindämmen kann. Um aus der Identifikationskrise herauskommen, braucht es passende demokratische Rahmenbedingungen und eine gemeinsame Öffentlichkeit. Erste zaghafte Schritte wurden dahingehend schon unternommen. Beispielsweise wurde die österreichische „Ausbildungsgarantie“ für Jugendliche 2014 von der Mehrheit der Mitgliedstaaten übernommen und in den nächsten beiden Jahren stehen sechs Milliarden Euro zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zur Verfügung. Bei den Europawahlen im Mai besteht erstmals die Möglichkeit direkt mitzuentscheiden, wie die Kommission zukünftig aussehen soll. Die größte Parlamentsfraktion wird auch den/die KommissionspräsidentIn stellen, so die Abmachung unter den Mitgliedsstaaten. Unabhängig davon, wie stark die Wahlbeteiligung ausfallen und wie das EU-Parlament nach den Wahlen zusammengesetzt sein wird, die Union wird uns auf jeden Fall noch eine Weile erhalten bleiben, auch wenn neue Formen der politischen Organisation entstehen. „Solange das so ist, kann man auch gleich wählen gehen – Veränderung ist ja schließlich keine Entweder-Oder-Frage“, meint Johanna Nyman vom Europäischen Jugendforum. Oder man macht es wie Alina Böling: Da auch sie findet, dass die EU etwas stagniert, entschloss sich die 24-jährige Finnin kurzerhand selbst für das Europäische Parlament zu kandidieren, um so neuen Input geben zu können. Jeder wisse schließlich, so Böling, dass eine demokratische und funktionierende Union mehr als nur den Euro und Wirtschaftspolitik braucht.
Lukas Kaindlstorfer studiert Soziologie in Wien.