Denn sie wissen nicht, was sie tun?
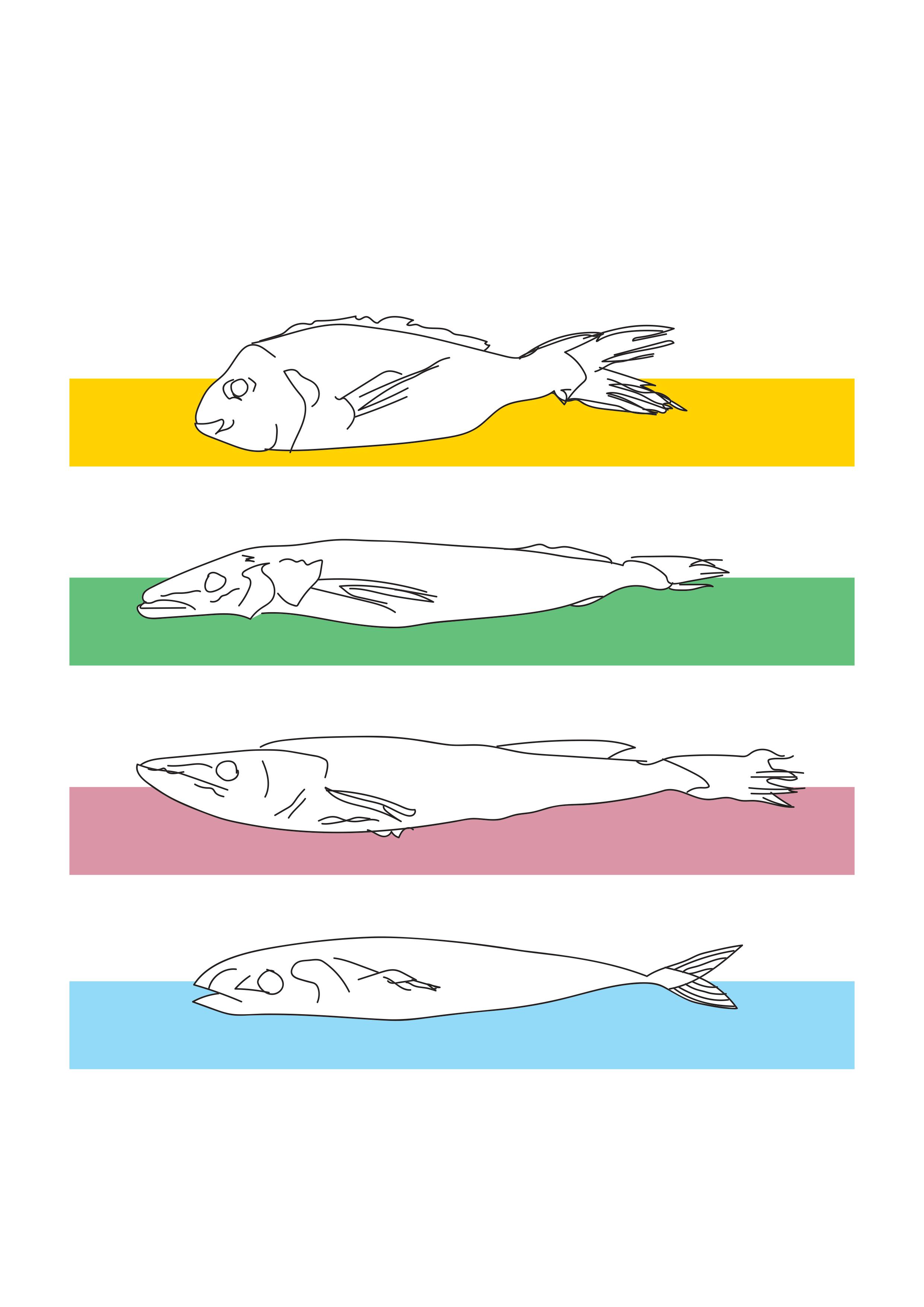
Stimmen, demokratische Rechte zu Gunsten des Klimas zu beschränken, häufen sich im Verlauf der letzten Jahre – auch in der Wissenschaft. Schließlich gehe es ums Überleben einer ganzen Spezies. Und schließlich müsse genau das ja im Interesse der Mehrheit liegen und um die gehe es ja in der Demokratie. Da könne man – salopp formuliert – Demokratie auch mal kurz beiseiteschieben. Aber: Gibt es Gründe, Ausnahmesituationen vielleicht, in denen es legitim erscheint, die Herrschaft statt dem Volk lieber ausgewählten Expert_innen zu überlassen? Rechtfertigen die Dringlichkeit und der existenzielle Charakter der Klimakrise autoritäre Eingriffe in eine demokratische Gesellschaft?
„Unite behind the Science!”, ermahnt die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg die Herrschenden dieser Welt immer wieder. Macht einfach das, was die Wissenschaft euch sagt! Darin steckt die Botschaft: Niemand kann ernsthaft wollen, dass die Erde sich um mehr als 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erhitzt – also hört einfach auf die Wissenschaftler_innen und auf das, was da in ihren dicken Berichten geschrieben steht. Denn dann – und nur dann – können wir die katastrophalsten Auswirkungen der Klimakrise noch abwenden.
In der Tat, niemand kann das wollen können: Eine Menschheit, die sich sukzessive ihrer eigenen Lebensgrundlage beraubt. Und doch scheinen es einige, gar nicht wenige, zu tun. Die Klimakrise ist keine Krise des Klimas, sondern allen voran eine des Menschen, eine existenzielle noch dazu. Wenn wir – das heißt eine privilegierte Mittel- und Oberschicht im Westen – innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht radikale Änderungen in unserer Produktions- und Lebensweise vollziehen, wird unser Fortbestehen – gelinde gesagt – sehr ungemütlich werden.
Dennoch: Kein einziger G20-Staat erfüllt derzeit die im Pariser Klimavertrag von 2015 festgehaltenen Vereinbarungen. Donald Trump hat unlängst bekannt gegeben, gleich ganz aus dem Abkommen aussteigen zu wollen. Dabei ist die wissenschaftliche Beweislage eigentlich erdrückend und die Mehrheit der Staatschef_innen der G20 sind demokratisch gewählt. Wenn man davon ausgeht, dass ein intakter Planet eigentlich im Sinne aller sein sollte, stellt sich die Frage: Werden die Klimaziele nicht eingehalten, obwohl oder gerade weil die Regierungen demokratisch gewählt sind? Einen „Defekt“ des demokratischen Systems zu diagnostizieren, den es mittels eines autoritären „Eingriffs“ zu beheben gelte, liegt da nicht allzu fern. Derlei Überlegungen schwirren seit Jahren durch die Debatte. Bereits 2007 forderten beispielsweise die Australier David Shearman und Joseph Wayne Smith in ihrem Buch „The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy“, es brauche „eine autoritäre Regierungsform, um den Konsens der Wissenschaft zu Treibhausgasemissionen zu implementieren“.
Der Ruf nach weniger Demokratie zum Wohle der Menschheit beruft sich auf Argumente, die auf den ersten Blick sehr sinnvoll erscheinen mögen. Eines davon lautet: Demokratische Institutionen sind notorisch langsam. Ein bürokratischer Apparat aus Gremien, Untergremien, Ausschüssen und Unterausschüssen agiert zu statisch, um der Dringlichkeit der Klimafrage herr zu werden. Außerdem seien Parteien und Politiker_innen in erster Linie am eigenen Machterhalt interessiert – konkrete Politik orientieret sich daher eher an der Dauer der Legislaturperiode als an der eigenen Ideologie (falls es so eine überhaupt noch gibt). Und schließlich sei die Klimakrise zu komplex, um von der Mehrheit durchdrungen zu werden. Lieber überlasse man das Wissenschaftler_innen, die wissen schließlich was sie tun (und werden ja auch dafür bezahlt).
Diese Argumente mögen für sich betrachtet alle etwas für sich haben – aber sie verkennen den Kern der Problematik. Sie reduzieren die Klimakrise auf die rein technische Dimension. Wer nur in technischen Kategorien denkt – und diese Betrachtungsweise dominiert derzeit die Debatte – kommt nicht umhin, nach Expert_innen, effizienten und ideologiefreien Lösungen zu fragen. Der Schritt ins Autoritäre ist da nicht weit – Technik ist geradezu der Inbegriff des Antidemokratischen.
Indem vermeintliche Lösungsansätze für die Klimakrise nur in technischen Kennzahlen diskutiert werden, wird suggeriert, alles könne so bleiben wie bisher – wir haben nur noch nicht die richtigen Technologien dafür gefunden. Solange Expert_innen demnächst die richtigen Erfindungen zusammentüfteln, sei auch der Erhalt der SUV-Billigflug-Mentalität garantiert. Aber diese Krise ist keine Technische, sie ist keine Frage von Zahlen und Daten, sondern eine, die eng in Verbindung mit unserer Produktions- und Lebensweise sowie unserer Vorstellung vom guten Leben steht – kurz: Diese Krise ist eine gesellschaftliche und damit auch eine, die gesamtgesellschaftlich, also demokratisch, bearbeitet werden muss. Gleichzeitig resultiert die Klimakrise ironischerweise nicht aus einem Zuviel, sondern – ganz im Gegenteil – aus einem Zuwenig an Demokratie.
Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. Jene, die an der Macht sind, müssen jederzeit damit rechnen, morgen nicht mehr an der Macht zu sein. Jahrhundertelang haben angeblich von Gott gesandte König_innen diesen Machtort auf Lebenszeit für sich reklamiert. Seit den bürgerlichen Revolutionen in Europa im 18. und 19. Jahrhundert sollte dieser Ort einzig dem Volk bzw. dessen Vertreter_innen vorbehalten sein. Doch die demokratische Logik – die Herrschaft des Volkes – wird beständig bedroht von Versuchen, den Ort der Macht an einen quasi-metaphysischen Grund zu koppeln. Einen Grund, der der Herrschaft des Volkes entzogen ist, der sich angeblich außerhalb der demokratischen Arena befindet, der unhinterfragbar bleiben soll: Religion, Natur, Vernunft, Technik oder Sicherheit, um nur einige zu nennen. Oder eben: Die Ökonomie.
Der Verweis auf die vermeintlichen „Gesetze des Marktes“ vermag noch jede (demokratische) Debatte im Keim zu ersticken. Nur permanentes wirtschaftliches Wachstum kann gemäß dieser „Marktlogik“ die Aufrechterhaltung des Wohlstands garantieren. Mehr ist mehr – und was heute mehr ist, ist morgen schon zu wenig. Der Marktradikalismus erhebt die permanente Selbstentgrenzung zur obersten Norm, zur conditio sine qua non zivilisatorischen Bestehens. Das gilt selbst, wenn es im scheinbar größtmöglichen Widerspruch zur eigentlichen Thematik steht: Wer dem Wachstum „des Marktes“ Grenzen setzen will, um unsere Lebensgrundlage zu bewahren (vulgo: Umweltschutz), riskiert gemäß dieser Logik einen Wohlstandsverlust. Nicht der Verlust der Artenvielfalt, sauberer Luft, fruchtbarer Böden oder unserer Wälder, sondern das Minus vor der BIP-Wachstumsrate stellt den eigentlichen Wohlstandsverlust dar.
Dieser Marktradikalismus ist eingebettet in eine libertäre Freiheits-Ideologie, die Freiheit vor allem als Konsumfreiheit kennen will. Freiheit ist Konsum ist Wachstum istWohlstand ist Freiheit. Um nur ein Beispiel zu nennen, wie tief dieses Freiheitsverständnis in uns verwurzelt ist: Als vor gut zehn Jahren die Verordnung EG Nr. 244/2009 der EU-Ökodesign-Richtlinie, besser bekannt als Glühbirnenverbot, erlassen wurde, rauschte eine Hysterie durch die Presse, als sei gerade das Folterverbot aufgehoben worden. Das Schreckgespenst der „Öko-Diktatur“ war geboren. Das sei eine „Zumutung“ und ein „unzulässiger Eingriff ins Privatleben“ noch dazu! Es ging um Glühbirnen.
„Die eigentliche Zumutung“, sagte der Nachhaltigkeitsforscher Ingolfur Blühdorn unlängst in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, „ist die Selbstverständlichkeit, Rücksichtslosigkeit und die Entschiedenheit, mit der der Anspruch auf solche exklusiven Freiheitsansprüche verteidigt wird“. Denn der Versuch, die Freiheit beständig auszuweiten, geht auch auf Kosten der Gleichheit – dem anderen Pol der Demokratie, in dessen Spannungsfeld die Frage der Gerechtigkeit diskutiert wird. Etwa 80 Prozent der Weltbevölkerung haben in ihrem Leben noch nie ein Flugzeug bestiegen. Dass die Antwort auf die Frage, ob man zukünftig zum Wohle des Klimas auf Kurzstrecken- und Billigflüge verzichten sollte, meist – in einer Art reflexartigen Schnapphysterie – mit „freiheitsfeindlich“ abgetan wird, erscheint in diesem Lichte wie eine Farce. Vor allem, da es jene 80 Prozent Nicht-Flieger_innen sind, die die Folgen der Erderhitzung am meisten zu spüren bekommen werden bzw. bereits zu spüren bekommen.
Dass „Klima- und Umweltschutz nicht als Frage globaler Gerechtigkeit und unabdingbar für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen diskutiert werden – sondern als Zumutung, Verzicht, ja sogar als antidemokratische Gewaltherrschaft“, schreibt die Journalistin und Autorin Kathrin Hartmann in einem Beitrag in der Wochenzeitung derFreitag, ist „eine erstaunliche Täter_innen-Opfer-Umkehr“. Die landläufige Definition der Freiheit besagt, dass sie gerade dort endet, wo jene der anderen Person beginnt. Wo die Freiheit diese Grenze überschreitet, tut sie das auf Kosten der Gleichheit – und der Gerechtigkeit. Es erklärt sich von selbst, dass dies mit der Freiheits-Ideologie eines Marktradikalismus nicht kompatibel ist.
Womit wir zur Frage der Demokratie zurückkehren können. In einer demokratisch organisierten Gesellschaft werden die Regeln des Zusammenlebens gemeinsam verhandelt. Dabei kommt es zu Interessenskonflikten, sollte es sogar. Verfechter_innen des marktradikalen Freiheitsdenkens empfinden jede Regel, die ihrem Tun Grenzen setzt, als Hindernis, als Zumutung. Alles, was über die „Gesetze des Marktes“ hinausgeht, steht tendenziell im Verdacht, die Freiheit und damit den Wohlstand zu gefährden. Natürlich haben gerade sie ein großes Interesse daran, Regeln auf ein Minimum zu reduzieren.
Doch derzeit deutet vieles darauf hin, dass gerade dieses Freiheits-Verständnis unseren Wohlstand gefährdet. Nicht Wohlstand im ökonomischen Sinne, sondern in Form von guter Luft, sauberen Meeren oder gesundem Essen. Doch indem die Frage nach dem guten Leben den Kapitalinteressen einiger weniger geopfert wird, steht plötzlich der Wohlstand aller auf dem Spiel. Die permanente Selbstentgrenzung der Freiheit schlägt sukzessive in ihr Gegenteil um: Unfreiheit, Zwang. Wir sind gerne dazu verleitet, vermeintliche „Defekte“ der Demokratie mit einer Beschränkung dieser beantworten zu wollen. Oftmals ist das Gegenteil der Fall: Die Beschränkung der Demokratie ist nicht die Lösung des „Defekts“, sondern dessen Ursache. So auch hier. Es braucht kein Weniger, sondern ein Mehr an Demokratie, um die Klimakrise zu bekämpfen. In einer Demokratie ist nicht „der Markt“, sondern einzig die Demokratie selbst zur permanenten Selbstentgrenzung legitimiert. Es braucht einen demokratischen Aushandlungsprozess, der jenseits marktfundamentalistischer Annahmen funktioniert, der Wohlstand nicht mit Wachstum und Konsum gleichsetzt – der es ermöglicht, auf Basis von Gleichheit und Freiheit ein neues Verständnis vom guten Leben zu entwickeln. Hierzu benötigt es alle Teile der Gesellschaft. Nicht zuletzt die Wissenschaft, die – obschon sie keine moralische oder politische Legitimation genießt – ihren entscheidenden Beitrag dazu wird leisten müssen.





