Babysteps zur elitären Hochschule
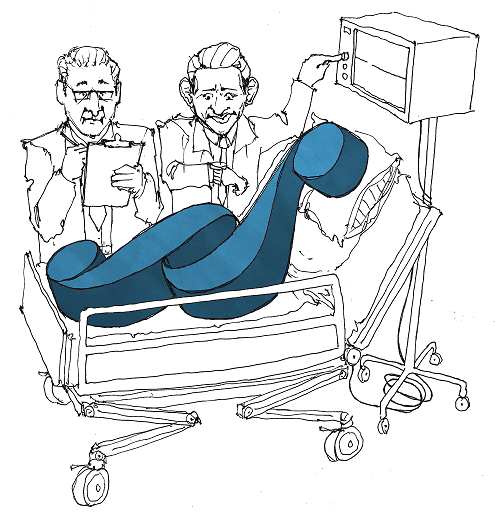
Arbeiten und Studieren.
Trotz immer stärkerer Verschulung, höheren Anwesenheitsquoten und dem Druck, ein Studium schnell abzuschließen, ist die Quote der Studierenden, die neben ihrem Studium einer Lohnarbeit nachgehen, konstant sehr hoch. Das war nicht immer so: Bevor 1998 erstmals Studiengebühren eingeführt wurden ging knapp die Hälfte der Studierenden arbeiten. Nach Einführung der Gebühren im Jahr 2000 stieg diese Quote um 20 Prozent, seitdem blieb sie mehr oder weniger unverändert, obwohl es nun ja keine Gebühren mehr gibt. Wie das ist, wenn man als Studierende_r einer Erwerbstätigkeit nachgehen muss, erzählt Melanie: „Studium und Arbeit sind schon vereinbar miteinander, aber das ist nicht ganz leicht. Es kommt teilweise auf die Flexibilität des_der Arbeitgeber_in an. Bei meinem derzeitigen Job muss ich mir für Prüfungen oder Blockseminare Urlaub nehmen. Es fällt auch viel Auswahl vom Studienangebot weg, einfach weil es zeitlich nicht möglich ist, und das ist schon manchmal sehr schade, wenn mich eine LV total interessieren würde, aber es sich einfach nicht ausgeht.“ Melanie arbeitet neben ihren beiden Bachelor-Studien Politikwissenschaft und Publizistik zwischen 15 und 25 Stunden und ist als Praktikantin angestellt, was natürlich arbeitsrechtliche und finanzielle Einbußen mit sich bringt. Während der Durchschnitt der Studierenden laut Studierendensozialerhebung 2015 knapp 20 Stunden in der Woche arbeitet, geht ein Fünftel sogar einer Vollzeitbeschäftigung nach. Nur zur Erinnerung: ein normales Bachelor-Studium sieht 1.500 Arbeitsstunden, aufgeteilt auf 180 ECTS, also 30 pro Semester, vor. Das bedeutet umgerechnet ein Arbeitspensum von sechs Stunden pro Werktag (auch in der vorlesungsfreien Zeit), oder 30 Stunden in der Woche. Arbeiten und in Mindeststudienzeit studieren geht sich also wohl nur für die Allerwenigsten aus. Das Gesetz sieht für uns (österreichische und EU-) Studierende zwei Toleranzsemester vor, dann stehen wir plötzlich vor dem Problem Studiengebühren. Bis vor kurzem konnten erwerbstätige Studierende sich das noch ersparen, doch mittlerweile hat sich hier einiges getan. Wie konnte es dazu kommen und warum? Ein kleiner Rück- und Ausblick:
Back to the roots?
Es war in jener Nacht, die vor allem für die rechtsliberale Medienelite (von Krone über Kurier bis Presse sind sich die Kolumnen hier einig) als „Nacht der Wahlzuckerl“ in die österreichische Geschichte eingegangen ist: eine ungewöhnliche Koalition aus SPÖ, Grünen und FPÖ schaffte die Studiengebühren am 24. September 2008 ab. Eine Rückkehr zum gänzlich freien Zugang, der von der Regierung Kreisky 1975 angedacht war, gab es aber nicht: So blieben die Gebühren zum Beispiel für Drittstaatsangehörige (die sogar den doppelten Betrag bezahlen müssen) und für alle Studierenden, die die Mindeststudiendauer um mehr als zwei Semester überschreiten. Dieses Überschreiten – so dachten die handelnden Personen damals – würde wohl vor allem jene Studierende betreffen, die entweder mehr als ein Studium belegen oder einer zeitintensiven Erwerbstätigkeit nachgehen. Für Erstere wurde eine Rückerstattungsregelung getroffen. Wenn man zum Beispiel zwei Studien belegt und im neunten Semester 363,33 Euro zahlen müsste, werden diese Gebühren vom zuständigen Ministerium bei entsprechender Prüfungsleistung rückerstattet. Dieser Teil wäre also geklärt. Doch wie wurde das Problem der erwerbstätigen Studierenden gelöst? Alle, die das 14-fache der gesetzlich vorgeschriebenen monatlichen Geringfügigkeitsgrenze pro Jahr verdienen, können sich von den Gebühren befreien lassen. Das Einkommen, das hierfür herangezogen wird, kann logischerweise nicht nur aus der klassischen unselbstständigen Lohnarbeit stammen, sondern auch aus einer selbstständigen Einnahmequelle. Wer also zum Beispiel im Jahr 2017 Illustrationen verkauft und damit mehr als 5.959,8 Euro im Jahr verdient hat, kann sich auch befreien lassen. Das Ganze wird jetzt aber ein bisschen komplizierter: wenn du dir für deine Tätigkeit als Illustrator_in ein Pinselset kaufst, kannst du das von deinem Einkommen abziehen, und zahlst so natürlich weniger Steuern. Du kannst also weniger Einkommen vorweisen, fällst vielleicht unter die Einkommensgrenze und musst Studiengebühren zahlen. So etwas ist einer Wiener Studentin passiert, die dann beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) gegen ihre Gebühren geklagt und auch recht bekommen hat: der VfGH urteilte, dass das Gesetz ungültig sei, da es nicht sinnvoll ist, dass nicht das richtige Einkommen, sondern das steuerliche Einkommen herangezogen wird. So weit, so logisch. Doch was dann geschah, klingt eher nach Kafka. Der VfGH weist in seinem Urteil deutlich darauf hin, dass die Gesetzesreglung nur repariert werden müsse, um eine sinnvolle Handhabung zu gewährleisten. Die neue Regierung hat dieser Empfehlung aber eine endgültige Absage erteilt. Und stellt somit bis zu 30.000 Studierende vor das Problem ‚Studiengebühren’. Dabei hat der neue Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sogar einen Initiativantrag zur Reparatur des Gesetzes vorliegen. Die Bundesvertretung der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) hat bereits Anfang Dezember gemeinsam mit einer Kanzlei einen verfassungskonformen Gesetzesentwurf vorgelegt, der im Wissenschaftsausschuss im Nationalrat behandelt, allerdings von der Regierung abgelehnt wurde. Der mittlerweile berüchtigte §92 (genauer §92 Abs. 1 Z 5) des Universitätsgesetzes sollte so abgeändert werden, dass durch eine Präzisierung des Einkommensbegriffs und der heranzuziehenden Einkommen und Zahlungen bei selbständiger Beschäftigung das verhindert wird, was der oben erwähnten Studentin passiert ist. Also wenn man zum Beispiel ein Nachhilfeinstitut gründet und sich dafür einen Drucker kauft, dann drücken die Ausgaben für diesen Drucker nicht das Einkommen unter die Geringfügigkeitsgrenze. Der konkrete Gesetzesentwurf war zwar vorrangig als verfassungskonforme Reparatur für §92 konzipiert, jedoch kann dieser auch als Vorlage für eine lokale Lösung, also eine Lösung durch die Hochschule selbst, dienen. Da die Regierung den Reparaturvorschlag, welcher durch die SPÖ in den Nationalrat eingebracht wurde, abgelehnt hat sind nun die Hochschule am Zug. Eine einfache und verfassungskonforme Lösung des Problems läge also auf dem Tisch, eine Umsetzung könnte rasch durchgeführt werden und eine Rückkehr zum Status quo wäre ohne neue Kosten oder anderen Aufwänden erreicht.
Warum also weigern sich die beiden Regierungsparteien, den Paragraph zu reparieren?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, muss man einen Blick ins Regierungsprogramm von Schwarz-Blau wagen. Dort findet sich neben anderen klassisch neoliberalen Maßnahmen, wie der Entpolitisierung der Studierendenvertretungen, nämlich auch die Wiedereinführung von „moderaten Studienbeiträgen“. Eine konkrete Summe wird zwar nicht genannt, von Minister Faßmann werden aber circa 500 Euro pro Semester angedacht. Wenn eine Regierung also sowieso von allen Student_innen einen Studienbeitrag einheben will, der noch dazu noch höher ist als bisher, dann wird diese Regierung auch keine Regelung aufheben wollen, die sowieso bald obsolet ist. Um trotzdem einen freien und offenen Hochschulzugang zu bewahren, brauchen wir Studierende Strategien und Verbündete. Ein Ansatz könnte sein, bundesweite Kämpfe auf lokale Ebenen zu tragen: denn einerseits kann das jeweilig entscheidende Personal der Universitäten hier deutlich progressiver als die Regierung agieren, andererseits können so flexiblere Lösungen getroffen werden, die zumindest einigen Studierenden Studiengebühren ersparen. Eva Blimlinger, seit Jänner Vorsitzende der Universitätenkonferenz, sieht nicht ein, warum die Universitäten die Studiengebühren für erwerbstätige Studierende nun lokal rückerstatten müssen. Außerdem kann und will sie sich Studiengebühren – egal für wen – nicht vorstellen. Besonders unter den aktuellen Voraussetzungen: „Wissenschaftsminister Heinz Faßmann sieht Studiengebühren als Steuerungsinstrument. Er meint, dass Studierende ihr Studium ernster nehmen, wenn sie dafür zahlen. Davon bin ich nicht überzeugt. Das unterstellt ja, dass Studierende ihr Studium nicht ernst nehmen.“ Für Melanie, die ihre beiden Studien sehr ernst nimmt, würden 500 Euro im Semester eine große Zusatzbelastung darstellen: „Ich bin jetzt schon froh, wenn neben den Ausgaben für meine Lebenskosten dann am Ende des Monats noch was übrigbleibt, die 500 Euro würden mir zusätzlichen Druck aufladen.“ Vielen Studierenden wäre dieser finanzielle Druck sogar zu viel. Als im Jahr 2002 Studiengebühren wiedereingeführt wurden, mussten ungefähr 45.000 Studierende ihr Studium abbrechen. Ein ebenso großer Rückgang (von damals knapp 20 Prozent der Studierenden) würde aktuell einer Zahl von fast 70.000 entsprechen. Am meisten davon betroffen waren bereits 2001 Studierende mit sozioökonomisch schwachem Hintergrund, Erwerbstätigkeit und/oder Betreuungspflichten. Benjamin, 21, studiert Wirtschaftswissenschaften an der WU in Wien. Er ist der Erste in seiner Familie, der studiert, für ihn wären die drohenden Gebühren existenzbedrohend: „Wenn es die 500 Euro schon vor zwei Jahren gegeben hätte, weiß ich nicht, ob meine Eltern mich ein Studium anfangen hätten lassen. Jetzt bin ich im vierten Semester und versuche, noch fertig zu werden, bevor ich zahlen muss.“ Ansonsten könnte er gezwungen sein, das Studium abzubrechen.
Lehren für die Zukunft.
Der Kampf für eine freie Universität, die auch für jene zugänglich ist, deren Eltern keinen akademischen Hintergrund haben, muss also auf vielen Ebenen stattfinden. Es gilt einerseits, sich solidarisch mit jenen Studierenden zu zeigen, die vom Auslaufen des Paragraphen 92 des UG betroffen sind. Einzelne Universitäten – zum Beispiel die JKU in Linz und die Uni Wien – haben bereits angekündigt, die Gebühren möglicherweise einfach nicht einzufordern. Andererseits heißt es, aufmerksam und widerständig zu bleiben. Zahlreiche Ankündigen der Regierung und vor allem des Bildungsministers zeigen schon jetzt, in welche Richtung sich die Hochschulpolitik entwickeln wird: Mehr Zugangsbeschränkungen, der Fokus auf ‚prüfungsaktive’ Studierende und natürlich die Drohung einer Einführung von allgemeinen Studiengebühren sind die Vorschläge, welche die aktuelle Bildungsdebatte beherrschen. Alles Vorschläge, die den realen Uni-Alltag mit den vielen Schwierigkeiten ignorieren: um eine studierendenfreundlichere Bildungspolitik umzusetzen, muss daher einerseits von uns Studierenden regelmäßig auf diese wirklichen Probleme hingewiesen werden und andererseits müssen andere Vorschläge präsentiert werden, um eine Alternative zur elitären und ausschließenden Politik der schwarz-blauen Regierung aufzuzeigen. Aus der politischen Auseinandersetzung um die Studiengebühren für erwerbstätige Studierende könnten einige Lehren für zukünftige Widerstände gezogen werden.





