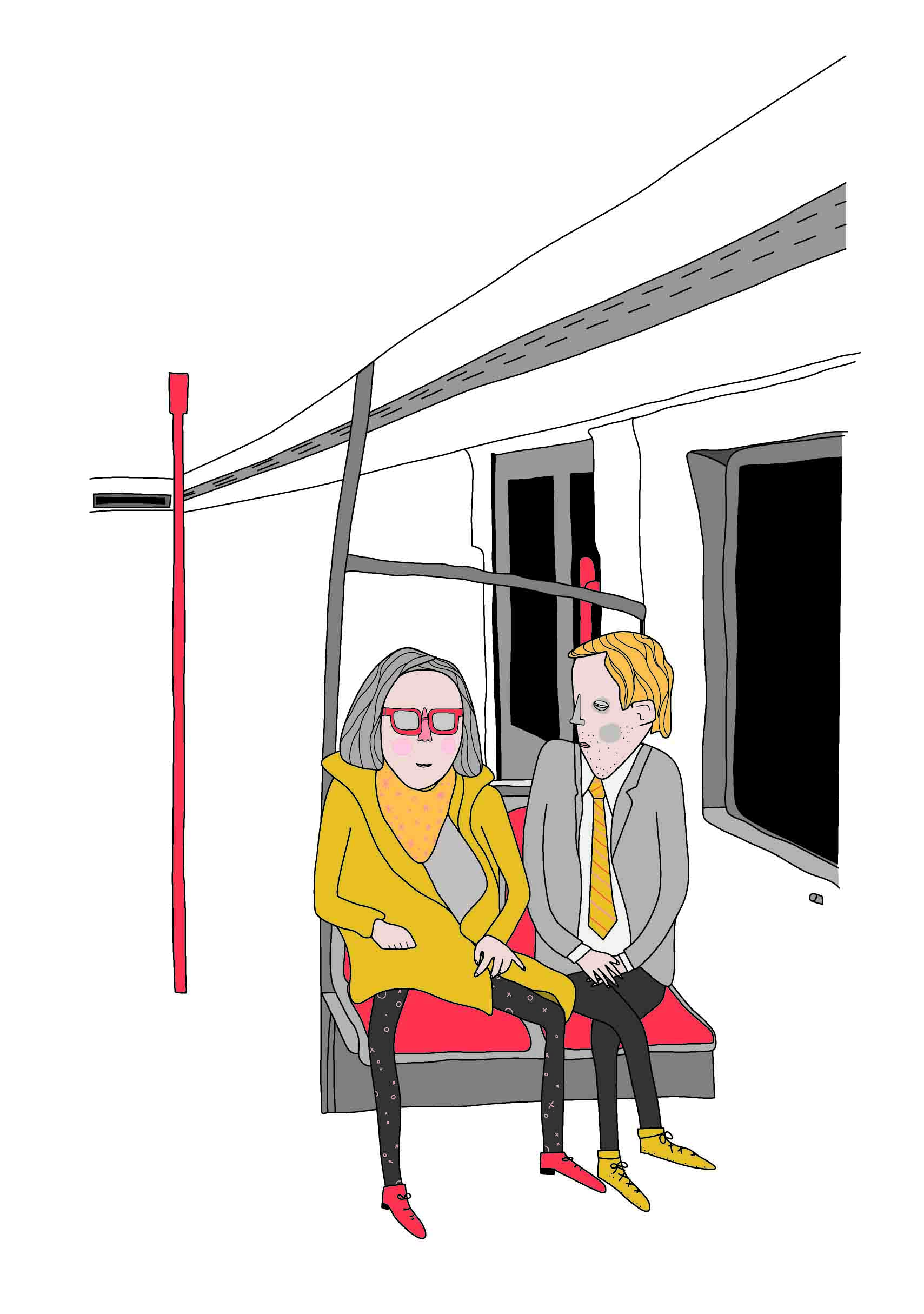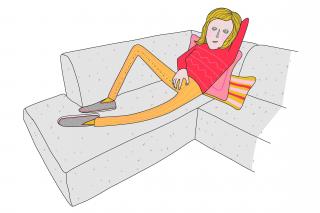Ein Professor, der seine Studentin auf einen gemeinsamen Kurzurlaub einlädt; ein Lektor, der seine Seminarteilnehmerin plötzlich küssen möchte, und ein Arzt, der sich im OP-Saal über den Beziehungsstatus seiner Studentinnen informiert. Sexuelle Belästigung an der Uni hat viele Gesichter; in den meisten Fällen bleibt sie jedoch unbemerkt.
Er ist eigentlich sehr beliebt“, erzählt Sophie*. Die Studierenden mögen ihn, wegen seiner lockeren Art in den Lehrveranstaltungen, er ist lustig und jung – Mitte 30 – und unterrichtet an der Universität Wien. Nach dem Unterricht lädt er die Kursteilnehmerinnen ein, mit ihm etwas trinken zu gehen, und flirtet mit Studentinnen. „Die meisten finden das nett. Ich fand es komisch, dass ein Lehrender ständig danach fragt, ob man gemeinsam fortgeht“, erinnert sich die 24-Jährige an ein Seminar vor mittlerweile zwei Jahren. Als Studentin fühle man sich doch „irgendwie gezwungen“ mitzugehen.
Im Jahr 2012 veröffentlichte die Ruhr-Universität Bochum eine Studie, die 22.000 Studentinnen von 34 höheren Bildungseinrichtungen in Deutschland, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien zu den Themen sexualisierte Gewalt, Belästigung und Stalking befragte. In dem EU-Projekt gaben 61 Prozent der Befragten an, während ihres Studiums mindestens einmal Opfer von sexueller Belästigung geworden zu sein. Rund ein Drittel der Frauen schilderte, dass ihnen nachgepfiffen wurde oder anzügliche Bemerkungen gemacht wurden. Knappe 15 Prozent gaben an, dass ihnen jemand auf unangenehme Weise zu nahe gekommen sei.
MEDIALER TABUBRUCH. Trotzdem ist sexuelle Belästigung ein an den Unis sowie in den Medien kaum besprochenes Thema. Diesbezügliche Aufregung gab es hierzulande 2009, als in einem profil-Artikel mit dem Titel „Altherrenschwitze“ etwa Heinrich Schmidinger, Rektor der Universität Salzburg, beschuldigt wurde, von 20 bis 30 Fällen von sexueller Belästigung gewusst und es unterlassen zu haben, diese zur Anzeige zu bringen. Die lokale Gleichbehandlungsbeauftragte Daniela Werndl vermutete eine hohe Dunkelziffer an Opfern. Schmidingers Kommentar dazu: „Ich fühle mich persönlich sehr schlecht.“ Genaue Angaben sind laut der Vorsitzenden des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen (AKG) an der Uni Salzburg, Siegrid Schmidt, bis heute aus „rechtlichen bzw. Gründen des Datenschutzes nicht möglich“.
Direkt an der Uni ist Sophie nie etwas passiert. Nachdem sie ihre Lehrveranstaltung abgeschlossen hatte, begegnete sie ihrem Lektor zufällig beim Fortgehen im Club – sie erinnert sich, dass er „ziemlich betrunken“ gewesen sei. Miteinander unterhalten haben sie sich nicht. Plötzlich stand er vor ihr und sprach sie mit ihrem Namen an. Er meinte, er würde sie gerne küssen. Sophie hat damals sofort den Club verlassen und hat sogar über den Lektor gelacht. Sie konnte sich gegen die Anmache „wehren“. Trotzdem war sie froh, dass ein Freund neben ihr stand und die Situation mitbekam. „Er war nicht aufdringlich oder aggressiv. Aber es war mir einfach trotzdem sehr unangenehm“, erzählt sie. Seither hat sie es vermieden, bei diesem Lehrenden Seminare zu besuchen. Sie fühlt sich „komisch“ in seiner Gegenwart. Außerdem fürchtet sie sich vor den Konsequenzen ihrer Ablehnung. „Ich hätte Angst, dass er mir die Abfuhr übel genommen hat und sich das dann auf meine Note auswirken könnte“, meint sie.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls hatte die Studentin bereits einige Gerüchte über diesen Lehrenden gehört. Er würde mit jüngeren Studentinnen schlafen, sie beim Fortgehen treffen und dann nach Hause begleiten. „Man weiß ja aber nicht was stimmt, von dem, was erzählt wird“, sagt sie. Als Sophie überlegte, sich beim Institut zu beschweren, war es ein Lehrender, der ihr Unterstützung anbot. „Er meinte aber, dass man wenig machen kann, da ich das Seminar bei besagtem Lehrenden zum Zeitpunkt des Vorfalls schon abgeschlossen hatte.“ Dazu kam, dass dieser nicht im Unigebäude oder in Zusammenhang mit dem Unialltag passiert war und Sophie wollte den Vorfall nicht dramatisieren – viele Studienkolleg_innen verteidigten den Lehrenden eher und beschwichtigten, dass das ja alles „auf Gegenseitigkeit basiert“. Sophie ließ von einer Beschwerde ab. „Ich glaube, dass durch seine Jugendlichkeit niemand das trotzdem existierende Machtverhältnis sieht. Es ist nicht dieses klassische Bild von einem alten Professor, der junge Studentinnen angräbt“, sagt sie. „Aber es ist doch schräg, dass ein Lehrender systematisch 20-Jährige anbrät und sich seine Dates über Lehrveranstaltungen checkt.“

MACHTMISSBRAUCH. Sexuelle Belästigung ist laut Sylwia Bukowska, Leiterin der Abteilung Frauenförderung und Gleichstellung an der Universität Wien, eine komplexe Angelegenheit. Dabei gehe es immer auch um Macht, weshalb das Thema immer noch stark von Tabuisierung betroffen ist. Eine beträchtliche Rolle spielt auch die nach wie vor gesellschaftlich und medial weit verbreitete Degradierung von Frauen zu Sexualobjekten. Von dem Machtgefälle an der Hochschule weiß auch Katharina Hawlik zu berichten. Sie ist studentisches Mitglied im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der Medizin-Uni Wien und stellt fest: „Die Krankenhaushierarchie schlägt sich auch im Alltag vieler Medizinstudentinnen nieder.“ Gerade bei Famulaturen oder im Operationssaal bekämen Studentinnen immer wieder sexistische Kommentare zu hören: „Ich habe es schon erlebt, dass männliche Ärzte ihre Studentinnen vor allen Kolleg_innen bezüglich ihres Beziehungsstatus ausfragten.“ Die Medizinische Universität trägt laut Hawlik aber nicht primär die Verantwortung für dieses „Dilemma“. Das Hauptproblem seien eben die „hierarchischen Krankenhaussysteme“. „Da Hochschule und Krankenhäuser eng miteinander verbunden sind, müsste die Universität hier aber mehr Sensibilisierungsarbeit leisten.“ Immer wieder kommt es auch zu unklaren Situationen, wenn Ärzte speziell Studentinnen fördern. „Es entsteht ein Graubereich, wo die Intention nicht mehr klar ist“, sagt Hawlik. Gleichzeitig trauen sich die meisten Studentinnen nicht, über das Problem zu sprechen, und melden sich daher nicht bei den Anlaufstellen. „Sei es aus Angst vor den Konsequenzen oder wegen der Unsicherheit, ob die eigene Wahrnehmung auch richtig ist“, erklärt Hawlik. Gerade bei einmonatigen Famulaturen scheint dabei für die meisten „Durchtauchen die einfachere Lösung zu sein“. Darüber hinaus wissen die Studierenden meist nichts von den Möglichkeiten, sich zu beschweren. Die Universitätsvertretung der ÖH an der Medizin Uni Wien führt daher seit diesem Wintersemester eine Kampagne, um Einrichtungen für Hilfe bei sexueller Belästigung bekannter zu machen.
Grundsätzlich ist an jeder öffentlichen Universität ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen eingerichtet. Neben der Mitwirkung und Kontrolle bei Habilitations- und Berufungskommissionen ist der Arbeitskreis auch für Fälle von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zuständig. Eine solche liegt laut Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GBlG) vor, wenn Studierende von einer Vertreterin oder einem Vertreter der Universität sexuell belästigt werden oder diese es unterlassen, bei einer ihnen bekannten Belästigung einzuschreiten. Dabei ist die Definition der sexuellen Belästigung sehr offen gehalten und bezieht sich auf „ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten“, das die „Würde einer Person beeinträchtigt“ oder deren Beeinträchtigung „bezweckt“. Zusätzlich muss dieses Verhalten laut Gesetz für die betroffene Person „unerwünscht, unangebracht, entwürdigend, beleidigend oder anstößig“ sein und eine „einschüchternde, feindselige oder demütigende Studienumwelt“ für die betroffene Person schaffen oder dies bezwecken.
UNKLARE DEFINITION. Da die Definition des Begriffs „sexuelle Belästigung“ im B-GBlG schwammig ist, haben die Universitäten Wien, Salzburg und das Mozarteum eigene Leitfäden in Form von Broschüren herausgegeben, um klarere Verhältnisse zu schaffen. In der Broschüre „Grenzen. Erkennen. Benennen. Setzen.“ der Uni Salzburg und des Mozarteums wird zwischen verbaler und non-verbaler Gewalt unterschieden. Nicht nur unerwünschte körperliche Nähe bis hin zur Vergewaltigung wird als sexuelle Belästigung klassifiziert. Auch „Ausziehblicke“, herabwürdigende, sexuell konnotierte Gesten, das Verbreiten von pornographischen Bildern sowie unerwünschte Geschenke, abwertende Namensgebungen, lästige Fragen zum Sexualleben oder unerwünschte Einladungen werden als Formen von sexueller Belästigung angeführt.
Neben ihrer Broschüre versuchen Universität Salzburg und Mozarteum auch verstärkt auf die entsprechende Telefon-Helpline hinzuweisen. Eine Einschätzung der Gesamtsituation findet Schmidt aber noch immer „sehr schwierig“. Vor allem weil die „Bereitschaft der Opfer nicht besonders groß ist, die Beratungs- und Hilfsangebote anzunehmen“. Jedoch liegt dies wohl weniger an der mangelnden Bereitschaft der Betroffenen, das Schweigen zu brechen, sondern vielmehr daran, dass der Umgang der Institutionen mit der Problematik bis heute zu wünschen übriglässt. Sylwia Bukowska geht davon aus, dass Betroffene häufig im persönlichen Umfeld und außerhalb der Universität Hilfe suchen. Bukowska hat an der Uni Wien am Gesamtkonzept für Belästigung und Mobbing in Österreich mitgearbeitet. Eines der wichtigsten Anliegen war dabei von Anfang an die absolute Wahrung der Schweigepflicht und die Möglichkeit auf Anonymität: „Wir versuchen eine Balance zu finden zwischen der Tatsache, dass wir eine universitäre Institution sind, und dem Anspruch, hochwertige Beratung anbieten zu können, die sich auch außerhalb der universitären Strukturen bewegt.“ Nur ihre Kollegin, die die Beratungsgespräche führt, kennt die Namen der Betroffenen.

PSYCHISCHE BELASTUNG. Veronika* wurde vor einem Jahr von ihrem Professor auf eine Konferenz eingeladen. Als dieser davor noch einen gemeinsamen Kurzurlaub plante, lehnte die 28-Jährige ab. Auf kleine Anspielungen folgten E-Mails und Einladungen zu Dienstreisen und Kongressen. Als sie auch die Einladung zu einer Dienstreise per E-Mail ablehnte, wurde er wütend. Die Zusammenarbeit mit dem Professor wurde für Veronika unmöglich. Seitdem kämpft sie jeden Tag mit Schikanen. Seit zwei Jahren sucht sie Hilfe gegen die sexuellen Belästigungen durch ihren Professor – vergeblich. Veronika versuchte gegen ihren Professor vorzugehen und wandte sich an die Frauenbeauftragte ihrer Universität und an eine Psychologin. Die Erfahrungen damit waren für Veronika durchwegs enttäuschend. Der Fall wurde nicht ernst genommen. Ihr Anwalt meinte, er könne ihr nicht helfen, da ihr Professor sie ja nicht außerhalb ihres Arbeitsplatzes „stalken“ würde.
Erst als Veronikas Professor aufgrund anderer Projekte zu beschäftigt war, ließ er von ihr ab. „Aber ich denke, dass wieder etwas passieren wird“, fürchtet sie. Er werde zwar nie übergriffig, aber es spiele sich alles auf der „mentalen Ebene“ ab. Der Professor setze sie unter Druck und versuche sie „fertig zu machen“. Dass er etwas falsch macht, sieht er nicht ein. Jeden Tag recherchiert Veronika am Institut für ihre Masterarbeit – er arbeitet im Nebenzimmer.
Nicht nur in der Uni sind Studierende sexueller Belästigung ausgesetzt. Zwei Drittel von ihnen müssen neben dem Studium arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. So auch Frank*. Der 22-Jährige kam diesen Herbst nach Wien. Da er Geld brauchte, fing er in einem Lokal zu arbeiten an. Sein Chef begann bald, ihm persönliche SMS zu schreiben, einmal zwickte er ihn in den Hintern. Für Frank ist dadurch eine schwierige und belastende Situation entstanden: „Ich habe Angst, wenn ich nachts allein mit ihm das Lokal zusperre. Aber ich kann es mir nicht leisten zu kündigen.”
Allein im Dunkeln, womöglich mit dem/der potentiellen Täter_in in der Nähe – das ist auch auf der Uni furchteinflößend. Sexuelle Übergriffe zu bekämpfen heißt unter anderem auch, bauliche und logistische Maßnahmen zu setzen, damit sich Studierende sicher fühlen können. Aus diesem Grund hat die Medizin-Uni Wien zweijährliche Evaluierungen von Gefahrenquellen und Angsträumen in ihren Frauenförderungsplänen verankert. Auf dieser Basis sollen gezielte Konzepte zur Verbesserung der Sicherheit entwickelt werden. Denn dunkle Gänge in den Bibliotheken, am Campus oder in den Universitätsgebäuden sind Angstherde. Da die Universitäten nachts oft weitgehend menschenleer sind, ist es gerade nach Lehrveranstaltungen am Abend schwierig, im Fall eines Übergriffs Hilfe zu finden.
KLARES STATEMENT. Bis das Ziel einer Universität frei von sexueller Belästigung erreicht ist, ist es ein langer Weg, der aus vielen kleinen Schritten besteht. „Ein klares Statement gegen sexuelle Belästigung seitens der Universität ist notwendig, um einen Wandel des Blickwinkels innerhalb der Institution Universität zu erreichen. Deshalb fand dieses Thema explizit Eingang in den Verhaltenskodex der Universität Wien“, so Sylwia Bukowska. Siegrid Schmidt sagt über die Salzburger Uni: „Die Universität ist sehr interessiert daran, dass nichts im Verborgenen bleibt, dass jede Form der sexuellen Belästigung abgestellt wird.“
Für jene, die von sexueller Belästigung betroffen sind, bleibt die Tabuisierung jedoch ein reales Problem. Das weitgehende Fehlen eines Bewusstseins für sexuelle Belästigung an Hochschulen findet Veronika fatal. Für sie wurde mit der Zeit immer deutlicher, dass sie mit einem Problem kämpft, für das sich niemand zuständig fühlt. Auch nicht die Universität. „Mir kommt es vor, also ob die Universität in meinem Professor mehr Wert sehen würde als in mir – ich bin nur eine von tausend Studierenden.“
Namen wurden von der Redaktion geändert. Die Autorinnen Marlene Brüggemann und Oona Kroisleitner studieren Philosophie und Rechtswissenschaften an der Uni Wien.
Telefon-Helpline Uni Salzburg und Mozarteum:
Mi, 13–14 Uhr, 066/499 9 59 68 ÖH-Helpline (österreichweit): 01/585 33 33
http://www.oeh.ac.at/#/studierenleben/sozialesundgeld/ helpline/