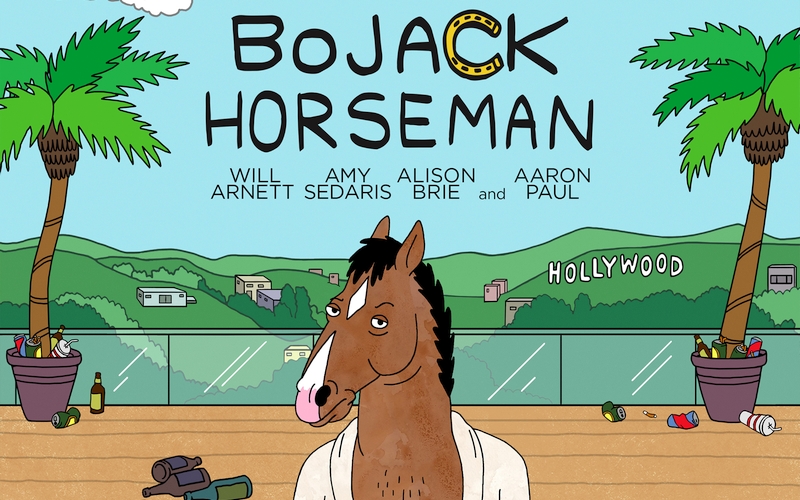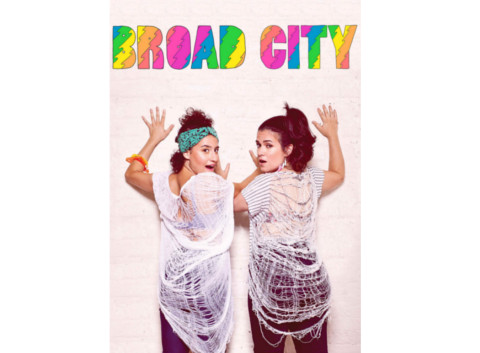Alle reden über Serien. Aber warum machen sie eigentlich so süchtig und wie hat sich unser Schauverhalten in den letzten 15 Jahren verändert? progress hat mit dem Medienexperten Christian Stiegler über den Boom gesprochen.
progress: Warum machen Serien so süchtig?
Christian Stiegler: Es sind vor allem die dramaturgischen Elemente, die süchtig machen. Wenn eine Episode mit einem Cliffhanger aufhört, dann bleibt man dabei. Außerdem mögen wir die Wiederholung und episodenhaftes Erzählen. Es gibt uns eine gewisse Sicherheit, die Charaktere zu kennen, wir entwickeln eine Beziehung zu ihnen.
Was für einen Stellenwert nehmen Serien im Leben der Rezipient_innen ein?
Ich sage immer, im besten Fall schaffen sie eine eigene Medienrealität. Baudrillard hat Hyperrealität dazu gesagt, also eine Realität, die wichtiger ist als die eigene Wirklichkeit.So funktioniert Disneyland, so funktioniert Fußball, so funktionieren all diese Geschichten, die für uns wichtig bleiben, obwohl wir schon ausgeschaltet haben. Wenn Serien gut gemacht sind, dann leisten sie genau das, entweder weil sie Themen bearbeiten, die so weit weg von uns sind, dass sie zu einer Realitätsflucht werden, oder weil sie uns persönlich ansprechen.
Funktioniert die Serie als Fluchtmittel besser als ein Kinofilm?
Natürlich! Es ist viel mehr Zeit zu erzählen, das eröffnet Möglichkeiten, stärker in die Charaktere einzusteigen und ihnen größere Aufmerksamkeit zu widmen. Außerdem kann man sie daheim ansehen und kann so gleich eine ganze Staffel, die mehrere Stunden dauert, anschauen. Das ist das perfekte Mittel zur Alltagsflucht.
Das ist dann das berühmte Bingewatching.
Der Begriff bezieht sich darauf, dass man den üblichen Episoden-Ablauf zerstört, indem man individuell entscheidet, wann man eine Serie ansieht und wie viel davon. Wir sind nicht mehr abhängig davon, dass eine Serie zu einer gewissen Uhrzeit auf einem bestimmten Sender läuft. Genau das hat Netflix mit „House of Cards“ so populär gemacht: Es war revolutionär, als sie gleich die ganze Staffel auf einmal online gestellt haben.
Wie hat sich die Serienkultur in den letzten 15 Jahren verändert?
Schon in den 70er Jahren gab es die ganz großen TV-Serien wie „Dallas“ und danach in den 90ern „Seinfeld“, „Friends“ oder „Beverly Hills 90210“. Heute sind jedoch die sogenannten „Qualitäts-TV-Serien“ im Gespräch. Man nimmt immer das Wort „Quality“ dazu und versucht so die neuen Serien von den herkömmlichen abzugrenzen. Die Entstehung der „Quality-TV-Series“ hat vor allem einen wirtschaftlichen Hintergrund. Als man gemerkt hat, dass das Blockbuster-Kino nicht mehr so rentabel ist, haben die großen US-Medienkonglomerate, zu denen sowohl Filmstudios als auch Fernsehsender zählen, stärker in Serienformate investiert. Dadurch sind qualitätsvollere Produkte und die Möglichkeitim Fernsehen mehr auszuprobieren entstanden.
Ich will das nicht rein wirtschaftlich erklären, aber man darf den Aspekt nicht aussparen. Dass man mehr Geld investiert, bewirkt auch, dass Serien mit größeren Stars besetzt werden. Da sich die aber nie für eine längere Zeit verpflichten lassen, hat sich auch die Serien-Machart verändert und neue Formate sind entstanden, wie die Mini-Series oder Serien wie „True Detective“, in der jede Staffel für sich alleine steht. Durch Formate wie Netflix und die Möglichkeit, Serien in einem selbstbestimmten Rhythmus anzusehen, hat sich auch das serielle Erzählen verändert und so etwas wie der Cliffhanger hat immer weniger Bedeutung.
Der Serientrend kommt aus den USA und ist dann nach Europa übergelaufen. Sind diese Qualitätsserien nun auch bei uns im Fernsehen zu sehen oder hat sich hier lediglich verändert, wo und wie wir Serien schauen?
Vor allem dem deutschsprachigen Publikum traut man das leider nicht zu, deshalb laufen diese ganzen Qualitätsserien auch hauptsächlich in Sparten-Kanälen oder zu günstigen Sendeplätzen spät nachts.
Das heißt, wir sind umso mehr auf neue Medien angewiesen, wenn wir Qualitätsserien schauen wollen?
Auf jeden Fall. Im deutschsprachigen Raum musste man dank dem Internet nicht mehr warten und konntedort auf (semi-)illegalen Portalen alle Serien finden, sobald sie in den USA liefen. Gerade so etwas wie Netflix funktioniert hauptsächlich deshalb, weil es nun legale Anbieter_innen für unsere Serien-Bedürfnisse gibt, die wir bisher hauptsächlich auf (halb-) illegale Weise gestillt haben.
Früher sind am Samstagabend alle vor dem Fernseher gesessen und haben dieselbe Show gesehen. Haben Netflix und das Internet das kollektive Fernseherleben zerstört?
Ich glaube, das ist eher eine Antwort auf eine gesellschaftliche Entwicklung. „Wetten, dass...“ ist ein gutes Beispiel dafür, das kommt aus einer Zeit, in der sich Familien vor dem Fernseher versammelt haben. Aber irgendwann gab es nicht mehr nur einen Fernseher im Haushalt, sondern auch einen im Schlafzimmer und einenim Kinderzimmer, weil verschiedene Familienmitglieder eben verschiedene Präferenzen haben. Früher hat man sich auch nicht am Samstag Abend vor den Fernseher gesetzt, um Zeit miteinander zu verbringen, sondern um etwas Bestimmtes am einzigen TV-Gerät im Haushalt anzuschauen. Die Digitalisierung ist also nicht die Ursache für die Individualisierung des Fernseherlebens, sondern vielmehr Resultat davon.
Stimmt das Prinzip: Sag mir, was du schaust und ich sag dir, wer du bist?
Absolut. Aber das gilt ja nicht nur bei TV-Serien, sondern auch bei Musik oder Filmen. Medieninhalte sind stark identitätsstiftend. Und es mag Schubladendenken sein, aber ich bin mir sicher, dass Menschen, die hauptsächlich Quality-TV-Serien anschauen, anders beurteilt werden als Menschen, die „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ sehen.
Christian Stiegler lehrt an der Universität Wien und ist Professor für Medienmanagement, Consumer Culture und New Media an der Karlshochschule in Karlsruhe.
Sara Schausberger ist freie Journalistin und hat in Wien Germanistik studiert.