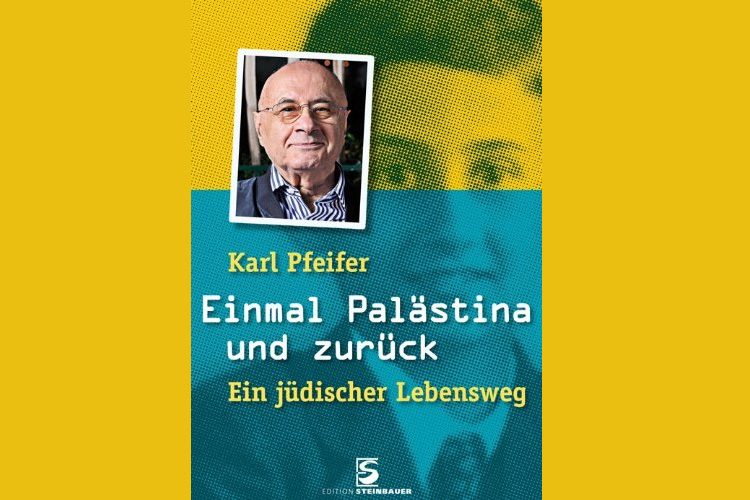Eine Jugend im Konzentrationslager Theresienstadt
Helga Pollak-Kinsky, 1930 in Wien geboren, war zwölf als sie im Jänner 1943 zusammen mit ihrem Vater Otto Pollak nach Theresienstadt deportiert wurde. “Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1944 und die Aufzeichnungen meines Vaters Otto Pollak” wurde im eigens dafür gegründeten Verlag edition Room 28 veröffentlicht. progress online hat mit der Herausgeberin Hannelore Brenner über dieses einzigartige, zeithistorische Dokument und über die Schwierigkeiten für dieses einen Verlag zu finden gesprochen.

Helga Pollak-Kinsky, 1930 in Wien geboren, war zwölf als sie im Jänner 1943 zusammen mit ihrem Vater Otto Pollak nach Theresienstadt deportiert wurde. “Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1944 und die Aufzeichnungen meines Vaters Otto Pollak” wurde im eigens dafür gegründeten Verlag edition Room 28 veröffentlicht. progress online hat mit der Herausgeberin Hannelore Brenner über dieses einzigartige, zeithistorische Dokument und über die Schwierigkeiten für dieses einen Verlag zu finden gesprochen.
progress online: Wie kam es zur Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Helga Pollak-Kinsky?
Hannelore Brenner: 1996 habe ich ein Hörfunk-Feature über die Kinderoper „Brundibár“ von Hans Krása und Adolf Hoffmeister für den Sender Freies Berlin gemacht; ein Jahr später übrigens für den ORF. Im Rahmen der Recherchen lernte ich einige Überlebende von Theresienstadt und Auschwitz kennen. Ich war damals auch in den USA, um Ela Weissberger zu sprechen, die in den Theresienstädter Aufführungen von ‚Brundibár‘ die Katze gespielt hatte. Sie erzählte viel von ihren ‚Freundinnen vom Zimmer 28‘. Beim Abschied ermunterte sie mich, im September nach Prag zu kommen, wo sie sich mit einigen ihrer Freundinnen treffen wollte. Das tat ich, und das war der Beginn. Ich lernte einen außerordentlichen Freundeskreis kennen und erfuhr eine Geschichte, die mich nicht mehr losließ. Ich besuchte die Frauen – zunächst Anna Hanusová in Brünn und Helga Pollak-Kinsky in Wien.
Und dann haben Sie mit der Arbeit an dem Buch „Die Mädchen von Zimmer 28“ begonnen?
So schnell ging das nicht. Aber als ich Flaška (Anna Hanusová) in Brno und Helga in Wien besuchte, zeigten sie mir wertvolle Dokumente. Flaška ihr Poesiealbum und Helga ihr Tagebuch. Dabei sprachen sie davon, dass sie etwas tun wollten zur Erinnerung an die Mädchen, die nicht überlebten, auch etwas zur Erinnerung und Würdigung der Erwachsenen, die sich um sie gekümmert haben. Ich wollte diese Idee spontan unterstützen Wir haben uns gut verstanden, trafen uns dann öfters und sprachen immer wieder über dieses Vorhaben. Dann wurde ein Projekt daraus.
Ab 1998 trafen wir uns - Helga, Flaška und weitere Überlebende von Zimmer 28 –regelmäßig im September in Spindlermühle, Riesengebirge, um an dem Projekt zu arbeiten. Sechs Jahre später erst, im März 2004, kam endlich das Buch heraus - „Die Mädchen von Zimmer 28“. Ohne Helgas Tagebuch und die Aufzeichnungen ihres Vaters hätte das Buch nicht geschrieben werden können. Es diente nicht nur mir als roter Faden, um die Geschichte dieser Mädchen zu erzählen, es diente auch ihren Freundinnen als Katalysator der Erinnerung.
Dachten Sie damals schon daran, Helgas Tagebuch als separates Buch zu veröffentlichen?
Ja, natürlich. Ich hätte damals schon gerne Helgas Tagebuch als eigenständiges Buch veröffentlicht. Es ist ja ein wunderbares Dokument. Aber es galt, die gemeinsame Geschichte dieser Mädchen zu schreiben. Das war das Anliegen, der Ausgangspunkt. Es sollte ein Buch werden zur Erinnerung an die Mädchen, die umgekommen sind. Helga hat ihr Tagebuch ganz bewusst in den Dienst dieses Anliegens gestellt.
Als ich später für Helgas Tagebuch einen Verlag suchte, lehnten alle ab. Es stehe doch schon alles in dem Buch über ‚Die Mädchen von Zimmer 28‘, hieß es oft. Aber das stimmt natürlich nicht. Es ist eine ganz andere Geschichte, Helgas genuin persönliche Geschichte.
Sie haben extra einen Verlag gegründet, um die Tagebücher herauszugeben, warum war es so schwierig einen Verlag zu finden?
Das verstehe ich selbst am wenigsten. Ich habe immer wieder Briefe und Exposés an Verlage geschrieben, aber es kamen nur Ablehnungen. Eigentlich ein Wahnsinn – wenn ich an die vielen Lesungen mit Helga, an die vielen Zeitzeugengespräche und Veranstaltungen mit ihr denke und an das Interesse an ihr und dem Tagebuch. Helga ist eine äußerst sympathische und beeindruckende Persönlichkeit und alle waren immer sehr berührt von ihr und den Lesungen und viele haben gefragt: Warum ist das Tagebuch nicht längst veröffentlicht? Irgendwann war für mich klar: Ich muss das Buch einfach selber herausbringen.
Das Buch besteht ja nicht nur aus Helgas Tagebüchern, sondern auch aus den Notizen des Vaters, Briefen, Postkarten, historischen Fakten und Interviews. Wie ist entschieden worden, was ins Buch hineinkommt?
Wir wollten ein Buch machen, das vor allem von jungen Menschen gelesen wird. Das heißt, es genügte nicht, einfach die Dokumente abzudrucken. Sie mussten in den historischen und biografischen Kontext gestellt werden, vieles musste erklärt werden, verständlich gemacht werden. Vor allem die Kindheitsgeschichte musste erzählt werden. Erst durch sie erfährt man, wer Helga war, wie sie in Wien und dann in Gaya/Kyjov (heute Tschechische Republik) gelebt hat bevor sie nach Theresienstadt kam. Ihre Kindheit zu kennen heißt, ihr Tagebuch besser zu verstehen und das, was ihr und ihrem Vater widerfahren ist. In dem Kapitel ihrer Kindheit lernt man auch viele der Verwandten kennen, von denen am Ende fast alle nicht mehr da sind.
Ja, und dann stellten sich einige Fragen. Wie mit der Tatsache umgehen, dass der dritte Band von Helgas Tagebuch verloren gegangen ist, dass ihre Aufzeichnungen im April 1944 aufhören? Wie die Geschichte zu Ende erzählen? Die Antwort lag auf der Hand. Denn in den Aufzeichnungen ihres Vaters spiegelt sich vieles von dem wieder, was Helga erlebte. So musste das Kalendertagebuch eingeflochten werden, so dass die Aufzeichnungen des Vaters dort, wo Helgas Tagebuch endet, die Geschichte weiter erzählen. Es kommt hinzu, dass ich natürlich weiß, dass Helga sich an vieles erinnert, was nicht in ihrem Tagebuch steht; ich bin sicher, im dritten Band wäre einiges zu lesen gewesen – über die Kinderoper Brundibár, Friedl Dicker-Brandeis, die Konzerte, die sie besuchte, Rafael Schächter, über die Transporte im Mai und über vieles andere. Also war es nötig, auch dies zu beleuchten und so kam es zu den Interviews.
Das Kulturleben in Theresienstadt und die Bedeutung, die es gehabt haben muss, ist auch beim Lesen der Tagebücher auffallend.
Vor allem Musik, Konzerte. Sie beschreibt immer wieder Konzerte. Und dann ihre Erinnerungen an Verdis Requiem, an Rafael Schächter. Ja, Sie haben vollkommen Recht – es bedeutete ihr sehr viel.
Und auch die Literatur.
Auch die Literatur, ja. Oder die philosophischen Gespräche, die sie mit ihrem Vater führte. Sie wird ja manchmal sehr philosophisch. Da sind wunderschöne Stellen drin! Zum Beispiel schreibt sie einmal nachdem sie ein Konzert erlebt hat: „Musik ist die schönste Schöpfung der menschlichen Seele, die der Mensch aus dem Nichts geschaffen hat.“ Oder sie schreibt darüber, dass sie oft an sich zweifele, und dass sie mit Rita darüber gesprochen habe und Rita ihr sagte: „Nur dumme Leute sind sich ihres Handelns und ihrer selbst sicher. Je klüger ein Mensch, desto mehr zweifelt er.“ Und dann fügte sie hinzu: “DENKEN IST DIE SCHÖNSTE SACHE“.
Es sind so kluge Sachen drin. Helga denkt viel über die Welt nach, verliert sich manchmal für Augenblicke in ihrer Gedankenwelt, träumt von der Zukunft, malt sich in ihrer Vorstellung die Zukunft aus, dass sie eines Tages studieren und Ärztin oder Wissenschaftlerin wird.
Es erzählt ja auch die Geschichte einer Jugend.
Ja, Helga kommt mit zwölf Jahren nach Theresienstadt, sie ist noch ein Kind. In den folgenden Monaten reift sie heran, man spürt den Übergang von der Kindheit hin zum Erwachsenenalter, erlebt mit wie sie sich verändert und immer reflektierter wird, nachdenkt über Dinge, über die viele junge Menschen nachdenken. Ich glaube, dass heutige Jugendliche sich in sie einfühlen, sich mit ihr identifizieren können. Und ich glaube, dass die Lektüre von Helgas Tagebuch vergleichbar ist mit dem Tagebuch der Anne Frank.
Ich bedaure sehr, dass der dritte Band verlorenging. Denn gerade gegen Ende des zweiten Bandes fängt sie an, erstaunlich dichterisch zu werden. Der letzte Eintrag vom 5. April 1944 – er ist phantastisch! Sie erzählt ein wunderbares Märchen - es liest sich wie eine Parabel auf ihre eigene Geschichte. Ein Märchen, das ihr die Musik eingab, während sie einem Beethoven-Konzert zuhörte. Dieses Märchen könnte genauso wie es geschrieben ist, als Kinderbuch veröffentlicht werden.
Was ist mit dem dritten Tagebuch geschehen?
Helga hatte 1951 geheiratet und lebte mit ihrem Mann zunächst in Bangkok, dann in Addis Abeba. Als sie 1956 wieder nach Europa zurückkehrten und sie ihr Umzugsgut auf dem Schiffsweg nach London transportieren ließen, kam ein großer Teil zerstört am Hafen an. Auf dem Schiff war ein Feuer ausgebrochen und hatte einige Container in Brand gesetzt, in einem war der dritte Band des Tagebuchs.
Ein Glück, dass es die Kalendernotizen von Otto Pollak gibt.
Otto Pollak erzählt die Geschichte weiter. Von ihm erfahren wir, was er erlebte und was Helga erlebte, ehe sie am 23. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert wurde. Doch nach dem 19. Oktober 1944 sind die Seiten im Kalender von Otto Pollak leer. Zu schwer war es für ihn, mit ansehen zu müssen, wie seine Tochter nach Auschwitz deportiert wurde. Er konnte nicht mehr schreiben. Was dann geschah, können nur Erinnerungen und vereinzelte Dokumente vermitteln.
Am 1. April um 19:00 Uhr wird “Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1944 und die Aufzeichnungen meines Vaters Otto Pollak” im Top Kino in Anwesenheit von Helga Pollak-Kinsky mit anschließender Podiumsdiskussion präsentiert:
http://edition-room28.de/Termine.html
Hier kann man das Buch bestellen: http://edition-room28.de/index.html
Sara Schausberger hat Germanistik studiert und arbeitet als Kulturjournalistin (u.a. für den Falter) in Wien.