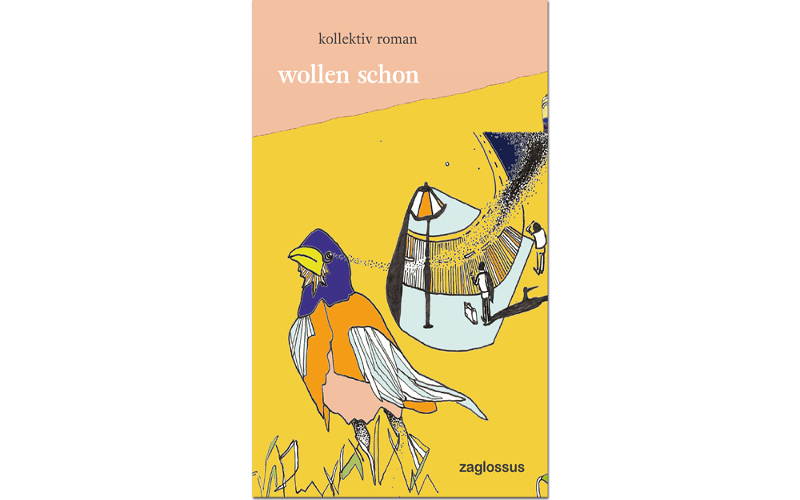Genderwahn an Hochschulen

Die Besorgnis, Wissenschaft würde durch die Gender Studies für die Umsetzung einer politischen Ideologie missbraucht werden, ist ein präsentes Thema im medialen Diskurs. Aber was ist dran an den Vorwürfen der Unwissenschaftlichkeit und fehlenden Objektivität?
Bedenken bezüglich der Wissenschaftlichkeit der Gender Studies werden von unterschiedlichen Personengruppen geäußert. Von journalistischen GendergegnerInnen über AntifeministInnen hin zu christlichen FundamentalistInnen (Ja, auch die machen sich Sorgen um den Verfall der Wissenschaft). Eine kritische Reflexion von Forschung ist grundsätzlich durchaus wünschenswert, allerdings muss sie auf einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Gegenstand fußen, um einen konstruktiven Beitrag zu leisten. In der Gendergegnerschaft ist dies nun nicht ganz der Fall; die Gender Studies werden ohne tiefergehende Kenntnis pauschal als „pseudowissenschaftlicher Hokuspokus“ abgelehnt. Das macht es nicht ganz einfach, sich mit Argumenten der GendergegnerInnen auseinanderzusetzen. Versuchen wir es trotzdem, indem wir uns einen Kernvorwurf genauer ansehen: jenen der fehlenden Objektivität der Gender Studies aufgrund ihres politischen Gehaltes.
FEMINISTISCHE INVASION? Es ist kein großes Geheimnis, dass die Gender Studies einer politischen Bewegung entstammen und dass Gender ein höchst politischer Begriff ist. Hinter ihm steht die analytische Beobachtung, dass Menschen nach ihrer Geburt aufgrund ihrer äußeren Geschlechtsmerkmale einer Kategorie (männlich oder weiblich) zugeordnet werden und diese Zuordnung ihren weiteren Lebenslauf bestimmt. Begonnen bei der Sozialisation von Jungen und Mädchen werden sehr unterschiedliche gesellschaftliche Vorstellungen und Anforderungen an Männer und Frauen herangetragen. Das Konzept Gender problematisiert das ungleiche Geschlechterverhältnis, das auf dieser Trennung fußt. Es geht also nicht darum, Menschen umzuerziehen und ihnen ein bestimmtes Verhalten aufzudrängen, sondern darum, den Rahmen für mögliches Verhalten zu erweitern. Männer sollen Gefühle zeigen dürfen und Frauen technische Berufe ergreifen können – wenn ihnen das entspricht – ohne dabei Schwierigkeiten zu bekommen. Es handelt sich also um eine Idee, die, wenn auch nicht unter dem Vorzeichen „Gender“, in weiten Teilen der Gesellschaft akzeptiert und bejaht wird. Aus einer bestimmten Blickrichtung ist es damit durchaus plausibel, Gender als eine Bedrohung wahrzunehmen. Eine Bedrohung für sehr fundamentale gesellschaftliche Strukturen, die trotz des Fortschrittes der letzten 100 Jahre noch bestehen. So sind auch in der westlichen Gegenwartsgesellschaft Frauen diejenigen, die den Großteil von schlechtoder unbezahlter Versorgungsarbeit leisten, häufiger von Gewalt und Armut betroffen sind, weniger in Führungspositionen aufsteigen und Männer diejenigen, die misstrauisch beäugt werden, wenn sie mit Kindern arbeiten wollen. Dass das Infragestellen so fundamentaler gesellschaftlicher Prinzipien Anlass für emotionale Auseinandersetzungen gibt, ist wenig überraschend.
OBJEKTIV ODER DOCH POLEMISCH? Die Gender- KritikerInnen sprechen von einer „Genderisierung“ der Hochschulen, als ob es sich um eine staatlich verordnete „Invasion“ handle, die Unmengen an Steuergeldern verschlingen würde. Diese Behauptung hält einem Blick in die Realität jedoch nicht Stand. So sind beispielsweise an österreichischen Hochschulen 2.420 ProfessorInnen tätig, wobei sechs Professuren eine Volldenomination für Geschlechterforschung haben. Das Bild der Invasion ist, wenn auch wenig plausibel, dennoch wirkungsmächtig und nur ein Beispiel für den fast durchgängig polemischen Stil genderkritischer Beiträge, die den „Genderwahn“ als Gefahr für die Wissenschaft darstellen. Die Soziologinnen Sabine Hark und Paula-Irene Villa weisen darauf hin, dass dabei meist, ohne weitere Erörterung, von einem alltagsweltlichen Verständnis von Wissenschaft ausgegangen wird, das an positivistische Maßstäbe der Naturwissenschaften angelehnt ist. Dies ist aus mindestens zwei Gründen problematisch: Erstens delegitimiert ein derartiges Wissenschaftsverständnis jegliche Erkenntnismethoden der Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Zweitens ist ein alltagsweltliches Wissenschaftsverständnis bestenfalls für den Alltag geeignet, eine vermeintlich wissenschaftliche Kritik darauf zu stützen, ist aber alles andere als passend. Widersprüchlich ist weiters, dass der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit, trotz des engen Wissenschaftsbegriffes, nur an die Gender Studies gerichtet wird (übrigens auch an ihre naturwissenschaftlichen Forschungsarbeiten). Es werden weder ganze wissenschaftliche Disziplinen noch sozialwissenschaftliche Forschungen von Gleichgesinnten angegriffen. All das spricht dafür, dass die Abwertung der Gender Studies nicht einer bloßen Besorgnis um Wissenschaftlichkeit geschuldet ist, sondern eher den Bedenken und Feindseligkeiten jener, die an den alten Strukturen hängen und eigene Privilegien gefährdet sehen. Es handelt sich um eine politische Motivation genau jener Art, wie sie den Gender Studies vorgeworfen wird und die wissenschaftlicher Objektivität vermeintlich im Weg steht.
POLITISCHE OBJEKTIVITÄT? In diesem Zusammenhang ist zu fragen, was wissenschaftliche Objektivität überhaupt sein kann. Das Bild eines isolierten Wissenschaftlers, der im Labor kulturunabhängige Ergebnisse produziert, ist in der Realität nicht haltbar. Jede forschende Person ist auch Teil der Gesellschaft, hat Vorstellungen und Wertehaltungen, die in den Forschungsprozess miteinfließen. Alleine die Wahl eines Forschungsgegenstandes ist schon von gesellschaftlichen Umständen geprägt. Denn was als erforschenswert angesehen wird, ist keine Frage, die objektiv beantwortet werden kann, sondern das Ergebnis von gesellschaftlichen Diskursen und Kräfteverhältnissen. Objektivität ist im Sinne einer völligen Unabhängigkeit von Gesellschaft undenkbar, egal in welcher wissenschaftlichen Disziplin. Dies bedeutet allerdings nicht, dass keine nachvollziehbare wissenschaftliche Erkenntnis möglich wäre, sondern nur, dass es einen bedachten Umgang mit der eigenen Rolle als forschende Person und dem Entstehungszusammenhang der Ergebnisse geben muss. Aus diesen Überlegungen heraus hat sich in den Sozialwissenschaften ein reger Diskurs darüber etabliert, wie solch ein Umgang Teil des Forschungsprozesses selbst werden kann. Gerade die Gender Studies haben hierzu einen wesentlichen Beitrag geleistet.
Carina Brestian hat Soziologie und Gender Studies an der Universität Wien studiert.