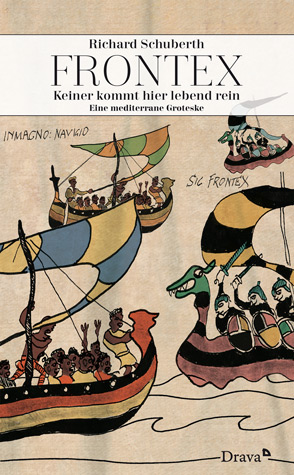Die Forderung, Schauspieler_innen mit migrantischem Hintergrund auf die Bühne zu bringen, ist nicht neu. Trotzdem sind Markus Subramaniam und Nancy Mensah-Offei noch immer Ausnahmefälle in der deutschsprachigen Theaterlandschaft. progress hat mit den beiden Schauspieler_innen über ihre Erfahrungen gesprochen.
Bei seinem ersten Vorsprechen an einer Schauspielschule wurde Markus Subramaniam gesagt, er solle sich auch nach Job-Alternativen umsehen. „Ich finde es in Ordnung, dass man den Leuten, die vorsprechen, realistisch sagt, dass ihr Talent nicht ausreicht. Aber dann haben sie mir noch ein paar Rollen vorgeschlagen, die ich beim nächsten Mal vorsprechen solle und das waren ausschließlich dunkelhäutige Paraderollen, wie zum Beispiel der ‚Mohr‘ bei Shakespeare. Da habe ich mir gedacht: Also groß ist eure Fantasie nicht.“
Subramaniam hat sich nicht nach Job-Alternativen umgesehen und wurde kurz danach am Max Reinhardt Seminar in Wien zum Schauspielstudium aufgenommen. Während seines Studiums war seine Hautfarbe kein Thema, erzählt er: „Aber ich glaube schon, dass sie trotzdem eine Rolle spielt. Allein, weil ich auffalle. Weil es im staatlichen Theaterbereich kaum andere Dunkelhäutige gibt. Und ich spüre schon immer eine besondere Aufmerksamkeit, wenn ich wo vorspreche.“ Direkt nach dem Studium ging der gebürtige Deutsche, dessen Vater aus Sri Lanka kommt, ans Landestheater Linz, wo er vier Jahre lang festes Ensemblemitglied war. „Als ich auf der Schauspielschule war, habe ich mir gedacht, dass ich bestimmte Rollen wahrscheinlich nicht bekommen werde, aber meine zweite Rolle war gleich ‚Karl Moor’ in Schillers ‚Die Räuber‘, wo ich einen weißen Bruder und einen weißen Papa hatte. Die Theaterleiter in Linz haben mich nie in eine Ecke gedrängt, dafür bin ich ihnen sehr dankbar.“

Ausnahmefälle. Daraus zu schließen, dass in der deutschsprachigen Theaterlandschaft alles eitel Wonne sei, wäre aber zu kurz gegriffen. Immer wieder war das Theater in den letzten Jahren repräsentationspolitischen Debatten ausgesetzt. Unter anderem wird dabei die Frage verhandelt, welche Rolle Rassismus auf den deutschsprachigen Theaterbühnen spielt. Subramaniam ist als dunkelhäutiges Ensemblemitglied an einem österreichischen Theater ein Ausnahmefall. „Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt er. In seinem vierten und letzten Jahr am Landestheater in Linz wurde das von den Theaterleitern genutzt und Markus Subramaniam als „Othello“ besetzt. Als er den Vertrag für Linz unterschrieb, war seine Bedingung, dass er die Paraderolle, die sonst nach wie vor meist mit weißen Schauspielern besetzt wird, spielen dürfe.
Auch Nancy Mensah-Offei hat es wie Markus Subramaniam auf eine staatliche Schauspielschule geschafft. Mensah-Offei, die in Ghana geboren wurde und mit sieben Jahren nach Österreich kam, wird dieses Jahr mit dem Schauspielstudium am Konservatorium der Stadt Wien fertig. Auch ihr wurde ein Festengagement an einem Theater angeboten, das sie aber abgelehnt hat, um erst mal als freie Schauspielerin zu arbeiten. „Bis jetzt hat man mir am Theater oder in der Schauspielschule nie das Gefühl gegeben, dass meine Hautfarbe ein Problem wäre. Bei der Aufnahmeprüfung war nur mein Bein ein Thema, weil ich humple. Die Frage war, ob man darüber hinwegsehen kann oder nicht. Das heißt, es sind insgesamt drei Faktoren, die es in Österreich für mich schwieriger machen: Ich bin eine Frau, ich bin schwarz und ich habe eine körperliche Behinderung.“
Im Theater sei bisher nie ihre Hautfarbe der Grund für ihre Besetzung gewesen, so die Schauspielerin. Im Gegensatz zum Film: „Bei der ORF-Produktion ‚Schlawiner‘ war klar, dass eine dunkelhäutige Schauspielerin gesucht wird.“ Obwohl Nancy Mensah-Offei am Theater durchwegs positive Erfahrungen gemacht hat, kam es in Kritiken auch schon zu fragwürdigen Aussagen aufgrund ihrer Hautfarbe. So schrieb beispielsweise die Wiener Zeitung in einer durchaus begeisterten Kritik über die „Argonauten“ am Rabenhoftheater: „Die Entdeckung des Abends ist Nancy Mensah-Offei. Ihre Medea ist wie eine hoheitsvolle Voodoo-Priesterin.“

Reproduktion von Rassismen. Nicht nur in Theaterkritiken kommt es immer wieder zu (subtilen) Rassismen. Erst kürzlich wurde es um das Thema in der Theaterlandschaft wieder laut, als vor ein paar Monaten die Wiener Festwochen ihr diesjähriges Programm veröffentlichten. Der Verein Pamoja – The Movement of the Young African Diaspora in Austria initiierte via Facebook eine Petition zur Absetzung eines Stücks von Jean Genet, das in der deutschen Übersetzung mit „Die Neger“ betitelt wurde. Die Kritik: Durch den Titel werde eine rassistische Haltung reproduziert, der man entgegenwirken müsse. Der Regisseur Johan Simons schlug eine
Titeländerung zu „The Blacks“, in Anlehnung an die englische Übersetzung, oder zu „Die Weißen“ vor. Der Übersetzer der deutschen Fassung, Peter Stein, lehnte das jedoch ab, da der Titel für die Clownerie aus den 50er-Jahren, die auf gleichnishafte Weise mit Klischees arbeitet, bewusst provokant gewählt sei.
Für Aufregung sorgte auch ein Bild im Programmheft der Festwochen, auf dem schwarz angemalte weiße Gesichter zu sehen waren. Diese Praxis des Blackfacing wird oft mit „Minstrel-Shows“ in den USA des 19. Jahrhunderts in Verbindung gebracht, in denen weiße Schauspieler_innen schwarz und oft mit grotesken Mienen geschminkt wurden, um sich auf der Bühne mit Hilfe klischeehafter Zuschreibungen über Schwarze lustig zu machen. Blackfacing wird allerdings bereits seit dem Mittelalter auch in Europa betrieben.
Die Prämisse des Autors Jean Genet, „Les nègres“, wie der Titel des Stücks im französischen Original lautet, nur mit schwarzen Schauspieler_innen zu besetzen, wurde von Regisseur Johan Simons in seiner Festwochen-Produktion bis auf eine Ausnahme jedenfalls nicht eingehalten. „Wäre es nicht wenigstens drin gewesen, dass Simons den einzigen Witz des Stoffes nicht kaputtmacht? Genets Regieanweisung, nur schwarze Schauspieler zu besetzen, hatte immerhin verstanden, dass es beim Rassismus im Theater um konkrete Repräsentationsfragen geht. Dass Simons nun weiße Schauspieler schwarze Schauspieler spielen lässt, die weiße Kolonialisten spielen, zeigt dagegen, dass er das Stück überhaupt nicht begriffen hat“, schrieb Die Zeit. Im Endeffekt passierte dann nicht viel. Die Aufführungen von Genets Stück gingen nach den Protesten im Vorfeld still über die Bühne. Beim Salongespräch zur Inszenierung, das ebenfalls im Rahmen der Festwochen unter dem Titel „Political Correctness auf der Bühne. Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit“ stattfand, saßen auf dem Podium ausschließlich Weiße. Im Falter hieß es dazu: „Intendant Hinterhäuser sagt, man habe vergeblich versucht schwarze Diskutanten zu finden.“
Weiße Norm und schwarze Schminke. In den letzten Jahren war es in Zusammenhang mit Blackfacing immer wieder zu heftigen Diskussionen gekommen: In der Inszenierung von „Kassandra oder die Welt als Ende der Vorstellung“ 2010 am Schauspielhaus Wien, in dem es um das Schicksal afrikanischer Boat People ging, malten sich die Schauspieler_innen in der Inszenierung von Felicitas Brucker schwarz an und machten sich dann mit Mehl wieder weiß. Die Blackfacing-Debatte wurde damals noch nicht aufgegriffen, die Kritik hob den dadurch verursachten Verfremdungseffekt hervor. Wiederbelebt wurde die Blackfacing-Debatte dann 2011, als in Deutschland gleich zwei Theaterhäuser Premieren mit weißen Schauspielern, die schwarz angemalt werden sollten, ankündigten. Eine hitzige Diskussion entbrannte, die Inszenierung am Deutschen Theater wurde schließlich abgesagt, weil der Autor des Stücks, der Pulitzer-Preisträger Bruce Norris, dem Theater, das die Figuren nicht werkgetreu besetzte, die Aufführungsrechte entzog. Das Deutsche Theater, eines der vier subventionierten Sprechtheater Berlins, scheiterte daran, Schwarze
als Schwarze zu besetzen.

Am Linzer Landestheater wurde 2012 „Lulu“ von Frank Wedekind inszeniert. „Da kommt am Ende eine als ‚Neger‘ bezeichnete Figur mit dicken Lippen und singt Gospels. Genau so ist die Rolle angelegt. Als Reaktion auf die damalige Blackfacing-Debatte hat der Linzer Schauspieldirektor Gerhard Willert einen Kollegen von mir schwarz angemalt und ihn diese Rolle spielen lassen, während ich weiß angemalt wurde und den Weißen gespielt habe“, erzählt Markus Subramaniam.
Nancy Mensah-Offei sagt zu Blackfacing: „Ich finde es schon störend, dass ein ‚Othello‘ fast immer schwarz angemalt wird. Es gibt genug dunkelhäutige Schauspieler hier in Österreich, die das könnten, aber nicht die Chance bekommen.“ Dass es an den deutschsprachigen Theatern nach wie vor kaum Schauspieler_innen gibt, die nicht einer herrschenden Norm entsprechen, die sich nach wie vor als „weiß“ definiert, ist eine Tatsache.
Migrant-Mainstreaming. Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum die Auseinandersetzung mit Themen wie Rassismus und Migration bisher fast ausschließlich in einer Nische geschieht. Die Forderung, Schauspieler_innen mit migrantischem Hintergrund auf die Bühne zu bringen, ist keineswegs neu. Obwohl in Wien mehr als 50 Prozent der Einwohner_innen migrantischen Hintergrund haben, hat die Realität der Einwanderungsgesellschaft noch nicht wirklich auf die großen Bühnen gefunden. Die rot-grünen Kulturpolitiker_innen fordern seit 2010 zwar von den geförderten Kulturbetrieben, dass sie aktiv „Migrant-Mainstreaming“ betreiben, trotzdem sind große gesellschaftliche Gruppen im Sprechtheater noch immer unterrepräsentiert. Postmigrantisches Theater findet nicht an den großen Häusern, sondern vor allem im Off-Bereich und auf den Wiener Mittelbühnen statt. Dass Wien eine Stadt der Eingewanderten ist, spiegle sich auf den Bühnen viel zu wenig wider, meint auch der Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ).

So meint auch Nancy Mensah-Offei, dass sie manche Rollen und an manchen Häusern wahrscheinlich nie spielen werde: „Ich habe mich nicht unbedingt am Burgtheater oder an der Josefstadt beworben. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich im deutschsprachigen Raum als Gretchen besetzt werde, ist gering. Ebenso hält sich die Chance, die Julia zu spielen, in Grenzen. Ich werde wahrscheinlich auch nie in Salzburg im ‚Jedermann’ spielen. Und ich glaube schon, dass meine Hautfarbe der Grund dafür ist. Wenn man mir eine Rolle in einem dieser großen Klassiker anbieten würde, würde ich aber natürlich sofort ja sagen.“
Anne Wiederhold, die künstlerische Leiterin des Kunst- und Sozialraums Brunnenpassage, hält es angesichts dieser Situation für nötig, dass sich die großen Häuser umorientieren: „Die Idee von öffentlicher Kulturförderung ist ja im Prinzip, dass Kunst ein Spiegel für die Gesellschaft sein soll. Wenn sich die Gesellschaft komplett verändert hat, dann muss da was passieren. Alle zahlen Steuern, aber nur ein Bruchteil rezipiert. Im Off-Theater-Bereich zu bleiben, ist aus meiner Perspektive absolut zu wenig.“
Postmigrantisches Theater. Die deutsche Theaterszene ist da vielleicht schon einen Schritt weiter. Seit der Saison 2013/14 wird das staatlich geförderte Maxim Gorki Theater in Berlin als Theater, das sich der kulturellen Vielfalt nicht verschließt, geführt. Man geht davon aus, dass das Leben längst transkulturell ist und bringt das auch auf die Bühne. Das Ensemble ist vielfältig, gespielt wird Neues und Klassisches. Geleitet wird das Maxim Gorki Theater von Jens Hillje und Shermin Langhoff, die den Begriff des postmigrantischen Theaters nach Deutschland gebracht hat. Ihr ehemaliges Theater Ballhaus Naunynstraße wurde unter ihrer Leitung zum Inbegriff eines Theaters für Menschen, die vielleicht nicht selbst migriert sind, aber in diesem Kontext leben, und zum „Kristallisationspunkt für Künstlerinnen und Künstler migrantischer und postmigrantischer Verortung“. Dass die dort uraufgeführte Inszenierung „Verrücktes Blut“ von Nurkan Erpulat und Jens Hillje als erstes postmigrantisches Stück zum prestigereichen Berliner Theatertreffen eingeladen wurde, war ein bedeutender Schritt.
Seit ein paar Jahren findet durchaus auch in Wien eine Auseinandersetzung mit postmigrantischem Theater statt. So vergibt etwa das interkulturelle Autorentheaterprojekt der Wiener Wortstätten seit 2007 jährlich einen Preis an Stücke, die sich mit Identität und Interkulturalität auseinandersetzen. Ibrahim Amir wurde 2013 für seine Ehrenmord-Komödie „Habe die Ehre“ mit dem Nestroypreis für die beste Off-Produktion ausgezeichnet und die Theatergruppe daskunst arbeitet seit Jahren unter der Leitung von Asli Kislal zur Hybridisierung der Gesellschaft. Das Wiener Mittelbühnen-Theater Garage X, das sich auf zeitgenössische Dramatik spezialisiert hat, startete 2011 zusammen mit Kislals Theatergruppe eine Schwerpunktreihe zum Thema „Pimp my Integration“. Mit exemplarischen Theateraufführungen und Podiumsdiskussionen wurde der Frage nachgegangen, welche kulturpolitischen Maßnahmen es braucht, damit postmigrantische Positionen und Themen zunehmend auf die Wiener Theaterbühnen finden. Als Fortsetzung der Reihe wurde 2012 das Erfolgsstück „Verrücktes Blut“ in der Garage X in einer eigenen Wiener Version von Volker Schmidt inszeniert. In dem Stück geht es darum, sich nicht darauf reduzieren zu lassen, Migrant_in oder Postmigrant_in zu sein. Nancy Mensah-Offei hat mitgespielt: „Obwohl es im Stück viel um Herkunftsfragen geht, hat meine Hautfarbe in der Inszenierung keine Rolle gespielt. Es ging hauptsächlich um das Kopftuch, das ich getragen habe“, erzählt sie.
Große Pläne, wenig Geld. Die Garage X, das Kabelwerk und die Theatergruppe daskunst haben sich nun auch zusammengetan und das Werk X gegründet. Dort soll inhaltlich progressives Theater mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen auf internationalem Niveau und unter Einbezug der Diversität der Wiener Bevölkerung geboten werden. Teil des neuen Programms ist das DiverCITYLAB von Asli Kislal, das sich der Heranführung migrantischer Publikumsgruppen an das Theater widmet. Es will „dem Gegenwartstheater ein neues, unserer postmigrantischen Gesellschaft angemessenes Gesicht geben, mit neuen Akteur_innen und neuen Theatermacher_innen“ und beinhaltet auch eine eigene Schauspielschule für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.
Die Budgets von Werk X und DiverCITYLAB werden übrigens separat verwaltet: Während das Werk X mit über 1,5 Millionen Euro von der Stadt Wien gefördert wird, gehen an Asli Kislal und ihr DiverCITYLAB gerade einmal 100.000 Euro jährlich.
Sara Schausberger ist freie Journalistin und hat in Wien Germanistik studiert.