Zwischen Widerstand und Kompliz*innenschaft
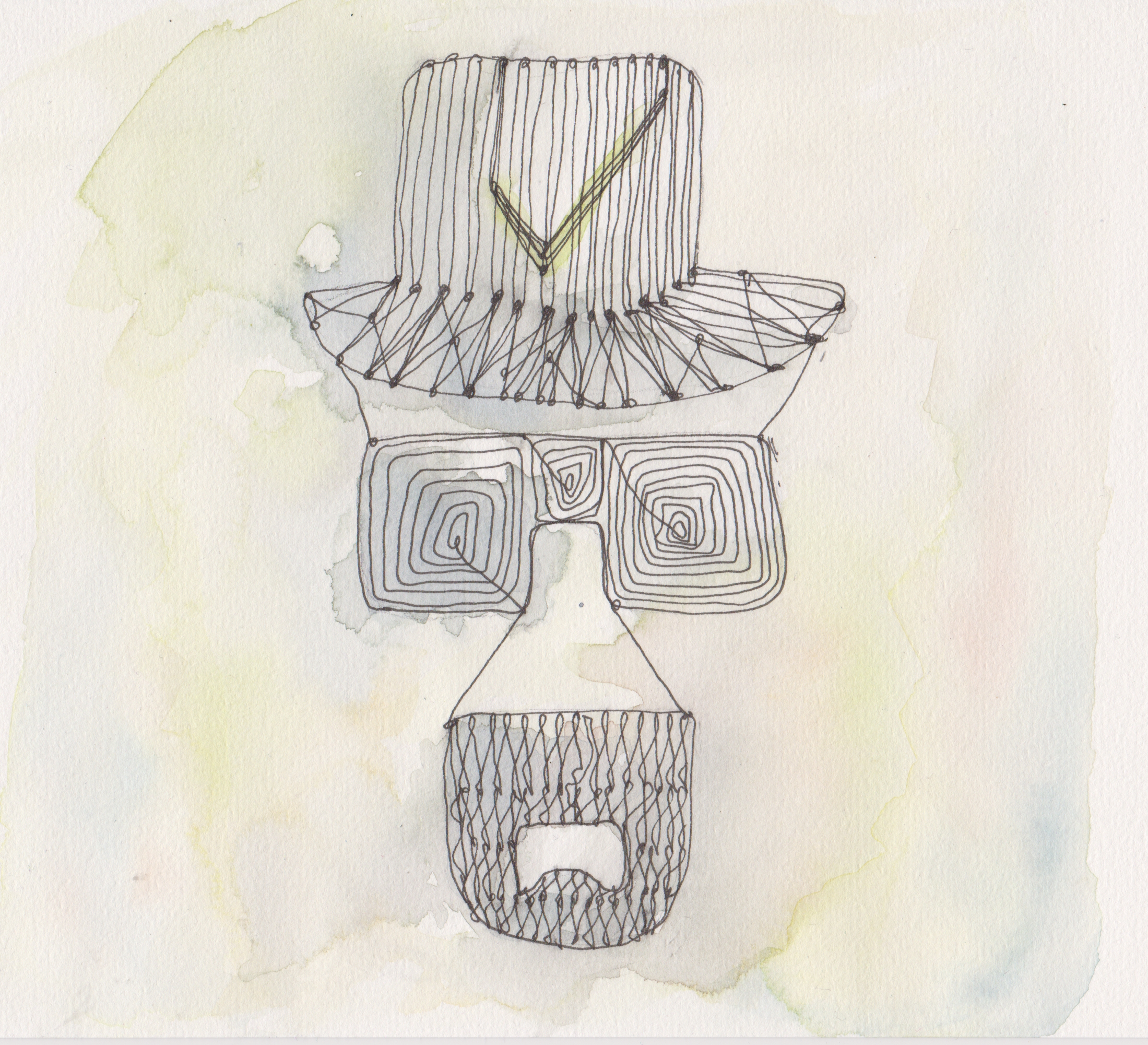
Bei der Arbeit an der Basis der Studienvertretung macht man immer wieder Erfahrungen mit widersprüchlichen Verhältnissen und schwierigen Situationen.
Die Arbeit in einer Studienvertretung ist anders als die in den höheren Ebenen der ÖH. Alles passiert nur im kleineren Rahmen und viel unvermittelter: Die Menschen, denen du gerade noch in einer Sitzung volle Opposition geben musstest, geben dir in der Woche darauf vielleicht schon entscheidende Noten. Personen, denen du vielleicht ihr unfaires Verhalten gegenüber anderen Studierenden vorwerfen musstest, entscheiden später über deine Zukunft im wissenschaftlichen Betrieb. Oder es fragen dich Lehrende, mit denen du persönlich gut auskommst, deren Lehre aber grottig schlecht ist, warum du gegen ihre Lehrveranstaltung im kommenden Semester gestimmt hast.
Manche Studienvertretungen organisieren sich dabei auch noch als Basisgruppen. Das bedeutet, dass sie versuchen, möglichst ohne Hierarchien zu arbeiten. Die durch die Wahlen gewonnenen Mandate sind dabei irrelevant, denn Entscheidungen werden in der Gruppe getroff en und der Diskussionsprozess ist dabei wichtig: Jede*r darf mitdiskutieren, und gegebenenfalls ein Veto einbringen, und dann muss eine andere Lösung für ein Problem gefunden werden. Klassische Kampfabstimmungen sind nicht Teil des Selbstverständnisses solcher Basisgruppen.
Diese Gruppen verstehen sich also nicht als Vertreter*innen, die für die anderen Studierenden sprechen. Sie wollen einen off enen Raum schaff en, in dem sich alle, die das möchten, einbringen können. Oft sieht man sich dann leider mit einer passivierten Studierendenschaft konfrontiert. Ob durch den Neoliberalismus im Allgemeinen oder durch den Bologna-Prozess im Speziellen, die Universitäten werden nicht mehr als Raum gesehen, in dem Mitgestaltung möglich ist. Davon zeugt auch die weiterhin sinkende Wahlbeteiligung bei den ÖH-Wahlen. Das durch die Reformierung der Universitäten erzeugte Selbstbild der Studierenden ist nicht mehr das eines gleichberechtigten Teils dieser Institution, sondern im besten Falle noch das von Kund*innen: Wir nehmen nur mehr eine Dienstleistung in Anspruch, und es gibt kein besseres Mindset, um für Studienplatzfinanzierung oder Studiengebühren zu argumentieren.
GREMIEN, KURIEN, DISKUSSIONEN. Zu den Rechten von gewählten Mandatar*innen einer Studienrichtungsvertretung gehört die Teilnahme an Curricular-Arbeitsgruppen, in denen einzelne Institute die konkrete Gestaltung ihrer Studienpläne erarbeiten. Und das kann ein langer Prozess sein. Zwischen persönlicher Abneigung und internen Grabenkämpfen wird dort jede einzelne Formulierung diskutiert, wird darüber entschieden, welche Module von Studierenden wie absolviert werden müssen und jedes administrative Detail des Curriculums geklärt. Es ist zwar selbstverständlich, dass die Studierendenkurie Teil dieser Gremien sein darf, aber nicht, dass sie dort auch gehört wird.
Je nach Verhältnis zum jeweiligen Gegenüber gibt es genügend Situationen, in denen Beiträge von Studierendenvertreter*innen einfach belächelt oder schlicht ignoriert werden. Wurde dem Institutsvorstand schon einmal Sexismus vorgeworfen? Musste man schon mehrmals Konflikte von Studierenden mit der Studienprogrammleiterin ausfechten? Dann kann es gut sein, dass studentische Einwände prinzipiell überstimmt werden. Denn viele Institutionen des Studienrechts sind mittlerweile in einer Form gestaltet, die es leicht macht, solche Anliegen zu übergehen. Es scheint fast so, als sollten es sich Studierende zweimal überlegen, die übergriffi ge Sprache eines Professors zu kritisieren, um im nächsten Gremium überhaupt noch gehört zu werden, oder sogar eine Chance auf Mitgestaltung zu bekommen.
Die Studienkonferenz ist dagegen das einzige Gremium, in dem Studierende tatsächlich eine Mehrheit stellen können. Dort werden konkrete Fragen der Lehre diskutiert, zum Beispiel welche Lehrveranstaltungen im nächsten Semester angeboten werden und welche auf gar keinen Fall Teil des Angebots sein sollen. Das klingt nach einer sehr mächtigen Position, und wenn das Verhältnis zum Institut gut läuft, kann dort tatsächlich ernsthafter Einfluss auf die Ausrichtung der Lehre genommen werden. Aber letztlich hat die Studienkonferenz nur mehr eine beratende Funktion, das letzte Wort hat immer noch die Studienprogrammleitung.
In diesem Kontext ist es oft schwierig, den Sinn der eigenen Arbeit noch zu sehen. Ist es wirklich alles, mit dem eigenen Budget spannende Projekte zu fördern und jedes zweite Semester eine Party zu organisieren? Oder noch viel schlimmer: Sind wir hier unfreiwillige Kompliz*innen im neoliberalen Umbau der Universitäten, wenn wir mit unserer Anwesenheit in diesen Gremien auch noch deren Entscheidungen legitimieren, selbst wenn wir dagegen sind? Erlauben wir der Universität, sich hier mit den Federn der Studierendenbeteiligung zu schmücken, auch wenn von den guten Ideen der Curricular- Arbeitsgruppe nach der Überarbeitung durch die Senats-Kommission nicht mehr viel übrig ist?
DESHALB BETEILIGEN. Wahrscheinlich müssten diese Fragen mit einem Ja beantwortet werden. Aber diese Universitäten und ihre Teile, sowie deren einzelne Kurien und Fraktionen sind eben keine geschlossenen Gefäße, keine starren Einheiten. Immer wieder lassen sich kleine Allianzen fi nden, mit denen manchmal eine Mitgestaltung im kleinen Rahmen möglich wird. Die Position, durch die Studierende in Konfl ikten gegenüber Lehrenden und ihrer Autorität solidarisch unterstützt werden können, ist notwendig. Denn ob nun die Studienvertreter*innen in den Gremien und Kurien anwesend sind, kann den Instituten und Fakultäten egal sein. Sie können auch ohne die Zustimmung der Studienvertreter*innen Entscheidungen treff en. Eine Totalverweigerung hätte also keinen Stillstand der Institution zur Folge, sondern würde nur bedeuten, dass Studierende gar keine Stimme mehr hätten. Und auch wenn es nicht immer die gewünschte Wirkung hat, ist ein konsequentes Betonen der spezifi schen Bedürfnisse von Studierenden wichtig. Wenn es nicht Teil der Lebensrealität von Lehrenden ist, oder nicht ihrem Bild von Studierenden entspricht, wird nie mitbedacht werden, was bestimmte Änderungen für Studis mit Betreuungspflichten, in Lohnarbeitsverhältnissen oder mit psychischen Schwierigkeiten bedeuten. In diesen Gremien zu sitzen, bedeutet das Schlimmste zu verhindern, oder es zumindest zu versuchen. Es ist eine anstrengende, oft undankbare und meistens gar nicht bezahlte Arbeit, aber sie ist wichtig.
Rem Bibischew studiert an der Universität Wien und engagiert sich in einer Basisgruppe.







