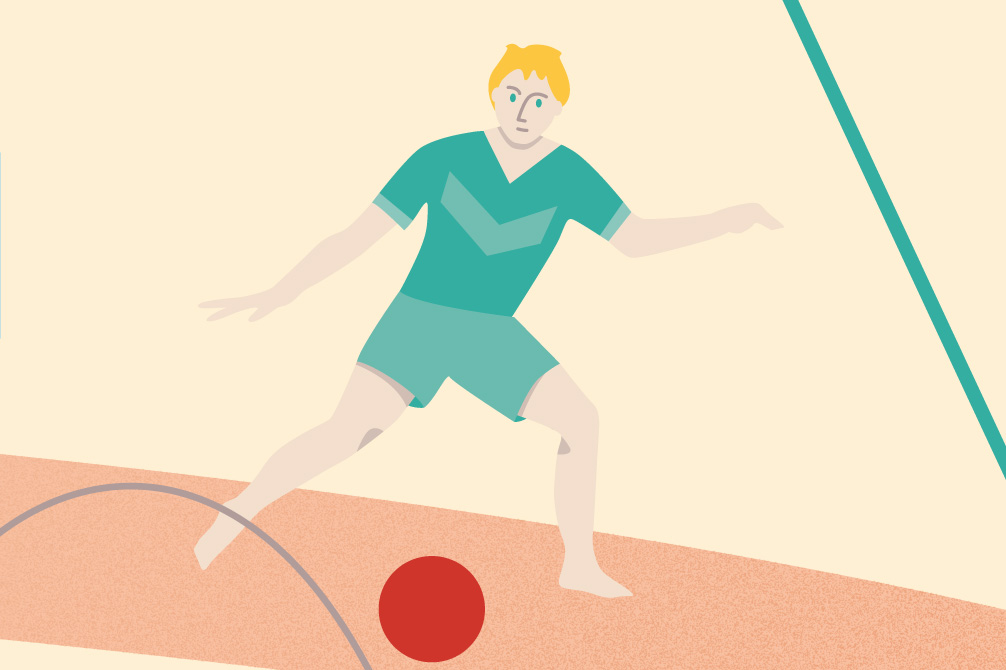Es muss nicht immer Joggen sein
Vier unkonventionelle Sportarten im Portrait.

Vier unkonventionelle Sportarten im Portrait.
Der Weg des Schwertes

Bei der japanischen Kampfsportart Kendo entscheiden nicht Kraft und Größe. „Die Schnelligkeit macht’s aus“, sagt Dieter Hauck und seine Mundwinkel zucken bei dem Gedanken an so manche Niederlage. Die Sportart setzt sich aus den beiden Wörtern Ken und Do zusammen, was so viel bedeutet wie „Weg des Schwertes.“ Mit echten Schwertern wird freilich nicht gekämpft, Bambusstangen in schwertähnlicher Form verhindern wirkliche Verletzungen. Dieter, laut eigenen Angaben eigentlich eher nicht prädestiniert für diese Sportart, weil zu groß und zu stark, trainiert seit über 30 Jahren Kendo. Schon als Jugendlicher beginnt er mit der japanischen Kampfsportart Jiu Jitsu. „Mitunter ein Grund war damals, mich gegen meine noch größeren Brüder wehren zu können“, sagt er und lacht. Durch einen Freund kam der 51-Jährige zu Kendo und ist seither überzeugter Kendoka. Heute ist er Vizepräsident der europäischen Kendo-Föderation.
Im Gegensatz zu anderen Kampfsportarten setzt Kendo speziell auf der geistigen Ebene an: Den oder die Gegner_ in zu lesen und sich selbst und die Menschen in der eigenen Umgebung zu erfahren, sind Teil des Weges, den es beim Erlernen von Kendo zu bewältigen gilt. Dabei ist die größte Herausforderung bei einem realen oder nachempfundenen Kampf – und damit in der maximalen Risikosituation – die gelernten Techniken durch rasche Entscheidungen und unter Aufwendung aller Energiereserven genau richtig einzusetzen, um den/die Gegner_in zu treffen. Diese Kampfsituationen werden regelmäßig bei Turnieren und bei Welt- und Europameisterschaften nachempfunden, bei denen Dieter auch schon oft als Kämpfer und Funktionär beteiligt war. „Leben kann man von Kendo in Europa allerdings so gut wie nicht“, sagt er. Dafür ist die Kendo- Population in diesen Breiten noch zu klein. In Japan ist die Sportart Teil der Ausbildung von Polizist_innen, des Militärs und der Palastwache und wird auch in Schulen stark gefördert.
Trainiert wird die Kampfsportart ein ganzes Leben lang, sie ist somit Teil des Lebensweges und ständiger Begleiter – auch für den Wiener. Dieter erzählt vom Vater seines japanischen Trainers, der noch bis drei Tage vor seinem Tod Kendo trainiert haben soll. „Wir haben dann gesagt, wir reduzieren das auf zwei Tage, dann haben wir wirklich etwas erreicht“, sagt er und zeichnet mit seinen Armen die typische Schwertbewegung von Kendo nach. (AS)
2,40 Meter hoch, sieben Sprossen
Eine zufällige Begegnung mit einem Diabolo-Spieler in Berlin hat sie inspiriert und damit ihr bisheriges Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Rosalie Schneitler hat braune Haare und ein Talent, ihr Italienisch so klingen zu lassen, als wäre sie nicht in Oberösterreich geboren. Die heute 30-jährige Mutter beginnt nach diesem Erlebnis die akrobatische Sportart Leiterartistik an der Scuola di Circo Vertigo in Turin zu studieren und entdeckt dort ihre Leidenschaft für den zeitgenössischen Zirkus.
Als eine von 60 Bewerber_ innen an der Zirkusschule wird sie zusammen mit 15 weiteren Studierenden aufgenommen und stellt sich zwei Jahre lang täglich einem siebenstündigen Training: Muskelkraft, Flexibilität, Bodenakrobatik, zeitgenössischer Tanz und Theater stehen auf der Tagesordnung. Dem folgt ein Training in der jeweiligen individuellen Disziplin der einzelnen Studierenden – für Rosalie war es die Leiter: „Drauf zu stehen und das Gleichgewicht zu halten, das ist eine der ersten Aufgaben, die es zu bewältigen gilt“, sagt Rosalie. Ohne die Leiter an die Wand zu lehnen, versteht sich. Danach folgen die ersten Tricks: Über die vorletzte Sprosse springen und auf der anderen Seite wieder auf dieser landen, die Leiter in Tempo auf und ab erklimmen oder auf der obersten Sprosse in „Fliegerposition“, mit dem Becken auf der Leiter, schweben. Heute lebt die Artistin von dieser akrobatischen Sportart und sieht es als ihre größte Herausforderung, ihre körperlichen Fähigkeiten in einen Ausdruck zu verwandeln und so jedes Stück einzigartig werden zu lassen. „Genau das ist das Besondere am zeitgenössischen Zirkus – jede Person trägt ihre persönliche Note zu einem Stück bei.“ Ihr beruflicher Alltag besteht daraus, von Fest zu Fest zu reisen, von einem Auftritt zum nächsten. Von Mai bis Oktober dauert die Saison. Im Winter hingegen werden neue Shows geprobt, alte verbessert und trainiert. Rosalies eineinhalbjährige Tochter und ihr Lebensgefährte – selbst ein Zirkusartist – sind auf ihren zahlreichen Reisen immer im Gepäck.
Doch die geborene Zwettlerin wünscht sich seit kurzem einen festen Platz im Leben. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten überlegt sie, einen Grund in Italien zu kaufen. „In Österreich gibt es für den zeitgenössischen Zirkus leider zu wenige Möglichkeiten“, sagt sie. Dass diese Art von Zirkus aber nun auch langsam hierzulande ankommt, freut sie besonders. (AS)
Paddeln, fangen, Tore schießen
Wer Kanufahren und Ballsport mag, der ist beim KanuPolo richtig. Zwei Mannschaften mit je fünf SpielerInnen versuchen bei dieser Crossover-Sportart, einen Ball mit der Hand oder dem Paddel möglichst oft im gegnerischen Tor zu versenken – während sie in einem Kanu sitzen. Die Sportart erfordert Multitasking: „Es ist eine Herausforderung, ein Boot ideal zu manövrieren und gleichzeitig den Ball zu fangen und zu werfen“, meint die Studentin Michaela Motowidlo. Zum KanuPolo kam sie wie viele andere EinsteigerInnen auch: Eigentlich wollte sie, als sie einen Schnupperkurs des Vienna KanuPolo- Teams besuchte, nur paddeln lernen. Heute ist sie ein führendes Mitglied des Vereins. Auch die Sportart selbst ist vor etwa 100 Jahren in Paddelvereinen entstanden.
Gespielt wird auf einem Spielfeld, das etwa die Maße eines Sportbeckens hat. Im Winter besteht die Möglichkeit, indoor zu trainieren. Allerdings sind die BesitzerInnen von Schwimmhallen oft skeptisch, da sie Angst haben, die Boote könnten das Becken beschädigen. So wird bis November im Freien gespielt. Wenn die Feinmotorik durch die Kälte gehemmt wird, verlagert das Team das Balltraining in die Halle, studiert Spielzüge ein oder analysiert Matches. Im Spielfeld gibt es beim KanuPolo keine fixen Positionen, sondern jede/r macht das, was seinen/ihren Fähigkeiten entspricht.
Ein Match dauert zwei Mal zehn Minuten. Die Verletzungsgefahr ist niedrig, da die SpielerInnen Schutzkleidung tragen. Die Boote sind an den Enden gummiert, da es erlaubt ist, gegnerische SpielerInnen zu rammen – allerdings nur, wenn diese gerade den Ball haben. Die Ausrüstung ist hauptsächlich Vereinsbesitz, weshalb die Kosten für die Mitglieder niedrig sind. „Anfänglich kamen hauptsächlich KanufahrerInnen zum Training, allerdings sind die oft sehr individualistisch. Beim KanuPolo geht es aber vor allem um Teamplay“, meint Heinz Hanko, der das Vienna KanuPolo- Teams trainiert.
Die Sportart ist actionreich und es fallen häufig Tore. Deshalb hat das Training des Vienna KanuPolo- Teams an der Alten Donau immer ZuschauerInnen. Einige davon bekommen dann Lust, KanuPolo selbst auszuprobieren. Neben Wien gibt es KanuPolo noch in Ybbs, Innsbruck und Salzburg. Im Moment besteht das Vienna KanuPolo-Team hauptsächlich aus StudentInnen. Im Training wird mixed gespielt, bei Meisterschaften gibt es eine Damen- und Herrenklasse. Weltweit führend sind die Niederlande. Olympisch ist die Sportart jedoch nicht, weshalb es auch wenig Förderungen und Berichterstattung darüber gibt. Es finden aber häufig internationale Turniere statt, an denen das Vienna KanuPolo-Team teilnimmt. Michaela träumt außerdem von einer Damennationalmannschaft, dafür gibt es derzeit allerdings noch zu wenige Spielerinnen. (ML)
Kampf unter Wasser
Von Unterwasserhockey über Unterwasserfußball bis zu Unterwasserrugby: Immer mehr Sportarten werden neuerdings auch im Nassen gespielt und so zu einer besonderen Herausforderung. „Man muss verschiedenste Fähigkeiten beherrschen, da der Sport plötzlich dreidimensional wird“, erklärt Heinz Frühwirt, der Co-Trainier des österreichischen Unterwasserrugby- Nationalteams. Neben Ausdauer, Kraft und Teamfähigkeit werden den SpielerInnen auch gute Tauchfähigkeiten abverlangt. „Viele sind von Unterwasserrugby schnell begeistert, geraten aber ebenso schnell an ihre Grenzen“, erzählt Frühwirt, der den Sport selbst schon beinahe seit seiner Erfindung betreibt.
Unterwasserrugby entstand in den 1970er Jahren in verschiedenen Tauchklubs. Ein Spiel dauert zwei Mal 15 Minuten, Tore werden geschossen, indem die SpielerInnen einen mit Salzwasser gefüllten Ball in einem Korb am Beckengrund versenken. Eine Mannschaft besteht aus zwölf SpielerInnen, davon sind sechs im Spiel, sechs warten auf ihre fliegende Einwechslung. Unterwasserrugby ist ein Vollkontaktsport, bei dem, wie beim Rugby, fast alles erlaubt ist, um dem/ der GegnerIn den Ball zu entreißen. Drei SchiedsrichterInnen, zwei unter, eine/r über Wasser, achten darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Zur Ausrüstung gehören ein kurzer Schnorchel, Flossen, eine Maske, eine Badehaube und ein Badeanzug. Die Verletzungsgefahr ist durch das Wasser gemindert, da es die Wucht der Stöße dämpft. „Man kann sich die Sportart als Mischung zwischen Basketball und Eishockey vorstellen. Basketball, weil es mehr Körperkontakt als beim Rugby gibt, Eishockey wegen des fliegenden Einwechselns der SpielerInnen“, erklärt Frühwirt.
Unterwasserrugby ist ein Sport im Auftrieb. Der Wiener Unterwasserrugby Club, der drei Mal pro Woche nach Badeschluss in öffentlichen Schwimmbädern trainiert, profitiert vor allem von einem Unterwasserrugby-USI-Kurs. Den Großteil des Vereins machen StudentInnen aus, die restlichen Mitglieder sind bunt gemischt. Trainiert wird mixed, bei höheren Meisterschaften gibt es Damen- und Herrenteams. Etwa ein Drittel der SpielerInnen sind weiblich, wobei in Österreich gerade versucht wird, ein Damenteam aufzubauen. Unterwasserrugby ist ein traditionell europäischer Sport, führend sind hier vor allem die skandinavischen Länder sowie Deutschland. In Österreich wird Unterwasserrugby in Wien, Salzburg, Klagenfurt, Graz und Innsbruck gespielt. Olympisch ist die Sportart nicht, aber in Wien beispielsweise gibt es ausreichend Förderungen für das Team, so dass es regelmäßig an internationalen Turnieren teilnehmen kann. (ML)
Margot Landl studiert Politikwissenschaft sowie Deutsch und Geschichte im Lehramt in Wien.
Anne Schinko studiert Politikwissenschaft und Geschichte in Wien.