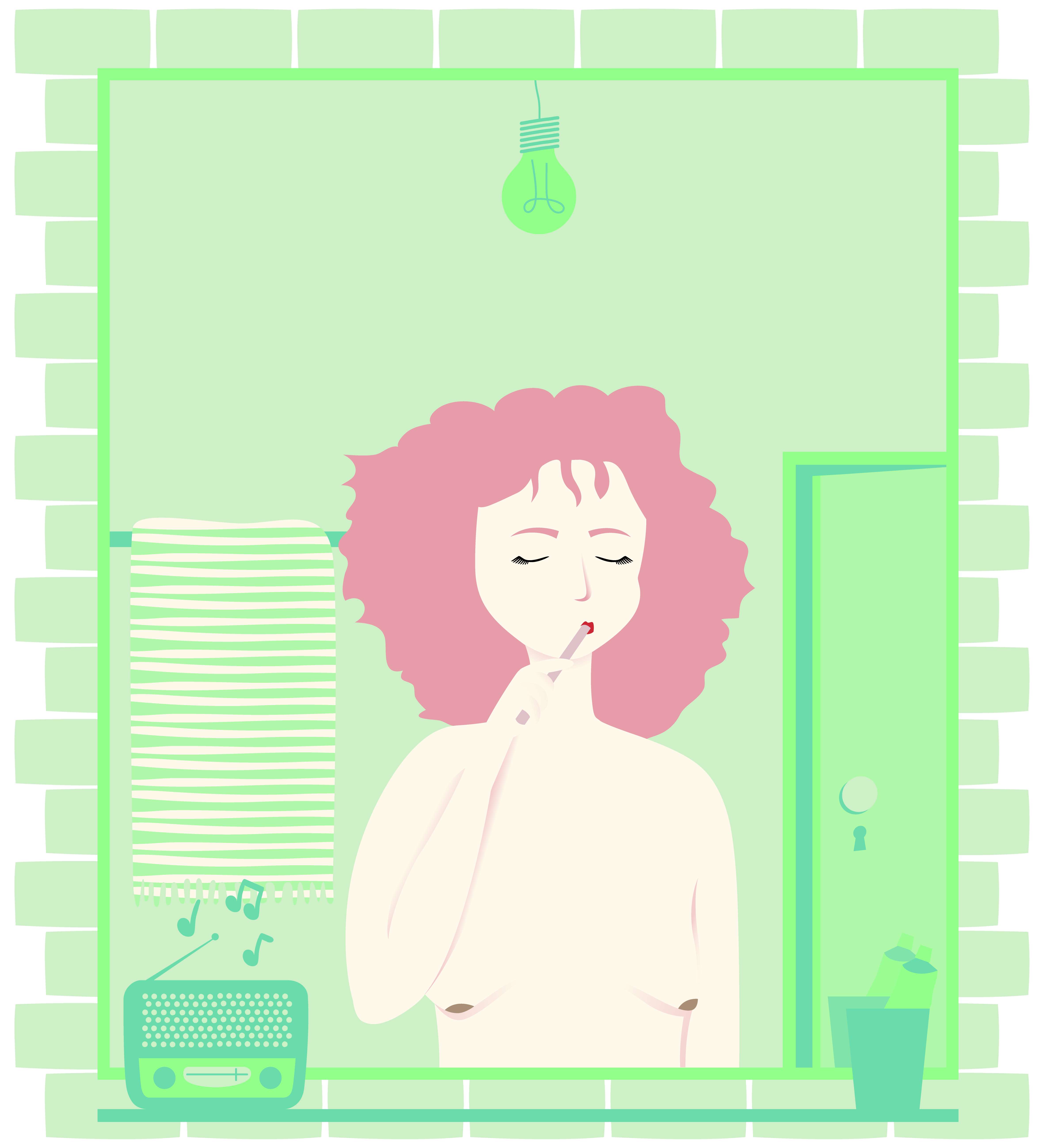Kann Schule soziale Ungleichheit verringern?

Stefan Hopmann ist international anerkannter Professor für Vergleichende Bildungswissenschaften an der Universität Wien. Mit progress spricht er über Schulkultur, Standardisierung und die Flucht des Mittelstandes.
progress: Unser Schulsystem ist in vielen Dingen gut, aber schlecht darin, soziale Ungerechtigkeit zu verringern, stimmen Sie zu?
Stefan Hopmann: Ja, da stimme ich zu. Allerdings mit einem Nachsatz: Wieso nehmen wir eigentlich an, dass Schule Ungleichheit verringern kann oder soll? Meiner Meinung nach ist diese Ansicht Teil des großen Kompromisses, auf dem unsere Gesellschaft aufgebaut ist: Wir tauschen Steuern gegen Beteiligung am Risiko geboren zu sein, also Alter, Krankheit, Bildung.
In bürgerlichen Institutionen werden deshalb formal alle gleich behandelt. So auch im österreichischen Schulsystem: Alle sollen gleich behandelt werden, obwohl sie eigentlich verschieden sind. Das bedeutet, dass formal Chancengleichheit besteht, weil ja allen die gleichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Leider geht diese Rechnung in der Praxis aber nicht auf, da die SchülerInnen wie gesagt aus unterschiedlichen Kontexten kommen. Schwächere SchülerInnen bräuchten gezielte Förderungen, um die gleichen Chancen zu haben wie ihre KollegInnen. Reformen wie die Ganztagsschule sind diesem Gedanken widersprüchlich, weil sie eben diese Unterschiede nicht ausgleichen. Wir sprechen deshalb von einem kontrafaktischen Gleichheitsverständnis.
Wer kann Ungleichheit vermindern, wenn nicht die Schule?
Aktuell sind alle westlichen Gesellschaften von einem Anstieg an Ungleichheit gekennzeichnet, die Bildung alleine ist überfordert, wenn die Gesellschaft nicht ebenfalls versucht, Gleichheit zu schaffen. Dass Schule alleine überfordert ist, zeigt sich zum Beispiel an Leistungstests, also an Überprüfungen von SchülerInnenleistung wie PISA: Oft ist hier das Problem, dass sozial schwächere SchülerInnen auch schlechter abschneiden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was die Ursache dafür ist: Liegt das schlechtere Ergebnis vor allem an LehrerInnen, SchülerInnen, didaktischen Methoden oder der Schulstruktur? Das Ergebnis ist ernüchternd: Nur 10 bis 15 Prozent der Unterschiede lassen sich überhaupt auf Strukturen in der Schule zurückführen. Viel prägender sind Faktoren wie Herkunft, Muttersprache oder finanzielle Situation und Bildungsgrad der Familie. Wenn man also wirklich weniger Ungleichheit in der Gesellschaft schaffen will, muss man beginnen, auch Vermögen radikaler umzuverteilen.
Was ist das Problem am österreichischen Bildungssystem? Braucht es mehr Budget?
Nein, es braucht sicher kein größeres Budget. Wir haben bereits eines der teuersten Schulsysteme der Welt und geben mehr Geld aus als Länder wie Finnland oder Norwegen. Das Problem in Österreich ist also nicht die Größe, sondern die „gießkannenartige“ Verteilung der finanziellen Mittel. Man versucht, ganz im Sinne des oben beschriebenen Prinzips, allen möglichst gleich viele finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Viel effektiver wäre es meiner Meinung nach, statt großflächigen Reformen wie dem Pflichtkindergarten bedürftige Kinder und Einrichtungen gezielt zu unterstützen.
Sie sind Professor für Vergleichende Bildungsforschung – gibt es ein Land, das es richtig macht?
Ja und nein. Einerseits ist natürlich kein Schulsystem perfekt, andererseits gibt es schon Länder, von denen wir einiges lernen können. So werden zum Beispiel in manchen skandinavischen Ländern die Eltern viel stärker in den Schulbetrieb miteinbezogen. Zudem sind die Gestaltungsspielräume für Schulen viel größer. Oft ist die Schule Mittelpunkt einer Gemeinde und wird als sehr wichtig angesehen – da ist es dann selbstverständlich, dass sich der BürgermeisterInnen um den Sportplatz kümmern.
Natürlich leiden aber alle westlichen Gesellschaften unter dem Problem, dass es zu wenig soziale Durchmischung an Schulen gibt. Wir bezeichnen dies auch als „Flucht des Mittelstandes“. In allen westlichen Gesellschaften, also auch in Österreich, ist zu beobachten, dass Eltern, die es sich leisten können, ihre Kinder privat einschulen. Gesellschaftspolitisch ist das problematisch, man kann es aber nur durch mehr Qualität in den öffentlichen Schulen verhindern.
Wie kann man diesem Phänomen entgegenwirken?
Gezielte Förderungen schwächerer Schulen könnten der „Flucht des Mittelstandes“ entgegenwirken. Weil Bildung sehr wichtig ist, wird darin investiert. In vielen Ländern ist es nicht ungewöhnlich, einen Kredit aufs Haus aufzunehmen, um den Privatschulbesuch des Nachwuchses zu finanzieren. Eltern sind bereit, an allen Rädchen zu drehen, die sie nur irgendwie finden können, damit ihre Kinder auf die „richtige“ Schule kommen – und die ist eben oft privat. Die einzige Art, das zu unterbinden, ist an öffentlichen Schulen eine Qualität zu schaffen, die die „Flucht ins Private“ unnötig macht. Denn letztendlich sind es die Eltern, die die Schulentscheidung treffen und auf jeden Fall das Beste für ihr Kind wollen.
Welche Rolle spielen die LehrerInnen in der Umsetzung neuer Konzepte?
Eine Schlüsselrolle. Das Problem dabei ist, dass LehrerInnen nicht so sehr durch die Universität oder Ausbildung geformt werden wie durch den ersten Arbeitsplatz. Dort werden die neu Dazugekommenen nach dem Motto „Hier machen wir das so“ eingewiesen. Dadurch ändert sich sehr wenig an der Unterrichtsart an Schulen.
Dennoch gibt es auch Positivbeispiele und neue Konzepte wurden angenommen – zum Beispiel in Norwegen. Hier wird nun nicht länger in Klassen unterrichtet, sondern viel freier. Für die LehrerInnen hat das natürlich eine große Umstellung bedeutet: Sie wussten am Anfang eines Tages nicht mehr, was sie erwarten würde, mussten plötzlich viel spontaner sein und sich an neue Situationen anpassen. Anfangs hat das großes Misstrauen erweckt, doch nach einiger Zeit lernten sie die Vorteile schätzen. Allerdings brauchen solche Implementierungsprozesse immer Zeit, um die LehrerInnen von der Umstellung zu überzeugen. Dazwischen liegt ein „Jammertal“, eine Phase der Umgewöhnung und Ablehnung, die zu überwinden man den LehrerInnen helfen muss. Man sollte ihnen also vor Augen führen, warum sich die Umstellungen lohnen könnten und Engagement belohnen.
Hinzu kommt noch ein weiteres Problem: Als beispielsweise die Neue Mittelschule (NMS) eingeführt wurde, gab es viele LehrerInnen, die Initiative ergriffen haben und tolle, neue Konzepte ausgearbeitet haben. Als die NMS dann zur Regelschule erklärt wurde, wurden viele dieser Konzepte verboten. Natürlich ist so etwas sehr frustrierend und hemmt den Willen der LehrerInnen, sich auf Neues einzulassen.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Standardisierung und Chancengleichheit?
Ja, aber einen kontrafaktischen: Die Begründung von Standardisierung ist eigentlich, dass die Besten durchkommen, wenn man allen die gleichen Ressourcen gibt. Wenn also alle einen Standard erfüllen müssen und das gleiche Maß an Unterstützung bekommen, sollte Herkunft kein ausschlaggebender Faktor zum Schulerfolg sein. In der Realität ist das aber oft anders herum.
Grund dafür ist einerseits, dass diejenigen mit mehr Ressourcen auch mehr Ressourcen haben, um auf neue Standards zu reagieren. So können sich SchülerInnen aus reicheren Familien beispielsweise Zusatzmaterialien zu neuen Standards wie der Zentralmatura leisten, die für finanziell weniger starke KollegInnen schwerer zugänglich sind. Außerdem profitieren Kinder aus bildungsnäheren Familien von der längeren Schulerfahrung der Eltern.
Hinzu kommt noch, dass im Zuge der zunehmenden Standardisierung SchülerInnenleistungen immer öfter überprüft werden. Das bedeutet auch, dass von dem, was die SchülerInnen leisten, auf die Leistung von Schule und Lehrenden geschlossen wird. Dass so ein linearer Schluss nicht treffend ist, mag logisch erscheinen, in der Praxis wird aber genau auf diese Weise argumentiert. So stehen Lehrende und Schulen unter Druck – plötzlich müssen sie sich rechtfertigen, wieso ihre Klasse oder ihr Jahrgang etwas kann oder nicht kann. LehrerInnen neigen deshalb dazu, sich auf das mittlere Leistungsfeld zu konzentrieren, denn hier ist es am einfachsten, Zugewinne zu generieren. Dabei geht das Augenmerk auf SchülerInnen, die über- oder unterdurchschnittliche Leistungen erbringen, verloren. VerliererInnen der Standardisierung sind also die sozial Schwachen.
Sie stellen dem das Konzept der starken Schule entgegen.
So ist es. In der Schule gibt es zwei wichtige Pole, zwischen denen den SchülerInnen Wissen vermittelt wird: Einerseits ist das Qualifizieren, also das Erlernen bestimmter Fähigkeiten bzw. Kompetenzen, ein wichtiger Aspekt. Andererseits von großer Bedeutung ist das Kultivieren, also das Sozialisieren, das dazu führt, dass Kinder Teil einer Gemeinschaft und letztlich Mitglieder unserer Gesellschaft werden.
Ich reise aktuell mit einer Vortragsreihe zum Thema „starke Schule“ durchs Land, da ich überzeugt bin, dass der Fehler, der gerade gemacht wird, ist, dass zu viel Fokus auf Qualifizierung gelegt wird. Dabei geht die Schulkultur verloren.
Eine Schule ist stark, wenn sie eine starke Schulkultur hat. Das bedeutet, dass klar ist, warum die SchülerInnen da sind, was sie machen sollen und wie. Meiner Ansicht nach ist das einer der Hauptgründe, warum SchülerInnen an Privatschulen meist gute Ergebnisse erzielen. Solche Schulen haben eine klare Identität, mit der man sich identifizieren kann. Allen Kindern ist klar, was die Schule, die sie besuchen, ausmacht.
Wie profitieren sozial schwächere Kinder von dem Konzept der starken Schule?
So eine starke Schulkultur macht es neuen oder sozial schwächeren SchülerInnen einfacher, sich in die Gemeinschaft einzufügen. Untersuchungen haben ergeben, dass durch starke Schulkultur langfristig alle SchülerInnen bessere Ergebnisse in Leistungstests erzielen. Kinder, die an Schulen wie „die Schotten“ gehen, fühlen sich als Teil eines Ganzen und sind stolz auf ihre Schule. Darum helfen sie sich gegenseitig und sind motivierter, weil man das so macht hier. Solche sozialen Dynamiken sind extrem wirkungsvoll.
Clara Porak studiert Deutsche Philologie und Bildungswissenschaften an der Universität Wien.