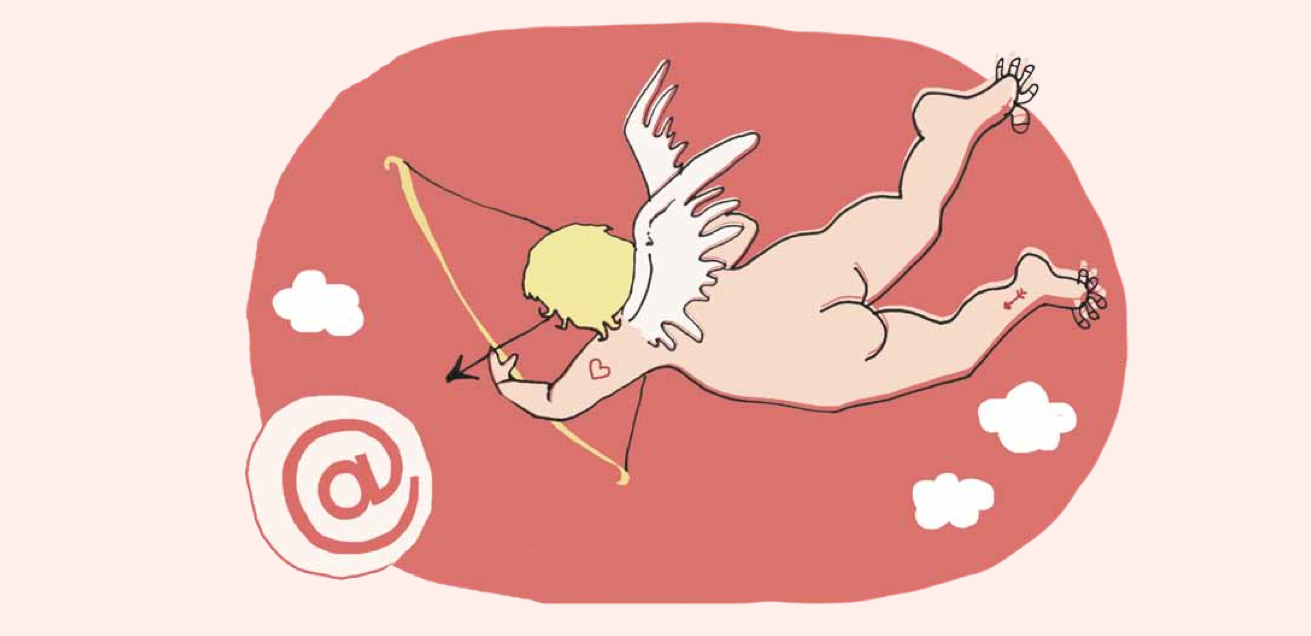Einmal Flirten zum Mitnehmen
Wie und warum die neuen Dating-Apps funktionieren und was das über unsere Gesellschaft und die Zukunft des Flirtens aussagt.Wie und warum die neuen Dating-Apps funktionieren und was das über unsere Gesellschaft und die Zukunft des Flirtens aussagt.
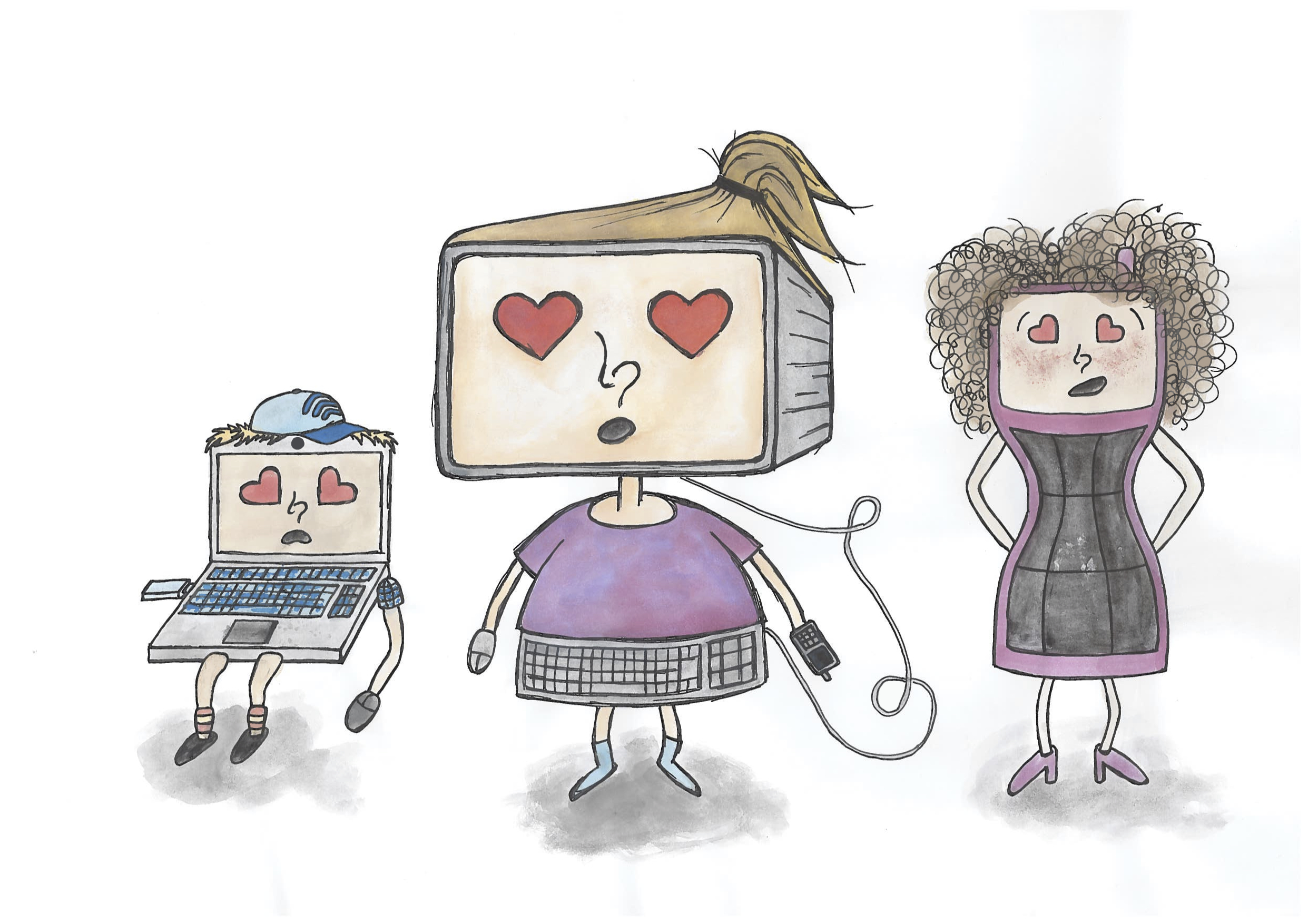
Wie und warum die neuen Dating-Apps funktionieren und was das über unsere Gesellschaft und die Zukunft des Flirtens aussagt.
Facebook stirbt. Das kann man heute mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit behaupten. Ob das nun in drei oder zehn Jahren der Fall sein wird, spielt keine Rolle. Fakt ist, dass der jüngste Rettungsversuch des Social Networks die Übernahme von WhatsApp ist. Der Deal droht nun aus Datenschutzgründen zu platzen. Die 19 Milliarden, die Zuckerberg für Whatsapp hinzulegen bereit ist, bestätigen aber: Mobil ist sexy. Das zeigt auch ein Blick auf die Hypes um diverse andere Smartphone-Applikationen wie Instagram, Snapchat, Telegram und Tinder. Besonders letzteres erfreut sich erstklassiger Mundpropaganda. Die Dating-App hat im vergangenen Jahr von L.A. aus einen Siegeszug über den gesamten Globus hingelegt und dabei auch Österreich nicht ausgelassen. Neben ähnlichen Angeboten wie Lovoo, Badoo oder Grindr (die Mutter der Dating-Apps aus der Schwulenszene), ist Tinder der absolute Kassenschlager - würde es was kosten. Ende Jänner war die App laut AppAnnie Ranking auf Platz 1 der meistgeladenen Lifestyle Apps und auf Platz 10 aller geladenen Apps in Österreich. „It’s like real life, but better“, so der Slogan der App, bei dem potenzielle „Matches“ in deiner räumlichen Nähe gesucht werden. Gewünschtes Geschlecht, Alter und maximale Entfernung zum „Match“ werden voreingestellt und schon scannt der Dating-Radar die Umgebung. Da das Ganze mit dem Facebook-Account verbunden ist, sieht man bei der Auslese, die Tinder für einen trifft, Profilfotos, gemeinsame Facebook-Freunde und ein paar Interessensangaben. Ein Wisch nach links bedeutet „Nicht interessiert“, ein Wisch nach rechts „Interessiert“. Erst wenn beide Nutzer sich zufällig gegenseitig „geliked“ haben, werden sie informiert und der Chat freigeschaltet.

Der Sachbearbeiter. Michael braucht im Schnitt drei Sekunden, um sich zu entscheiden in welche Richtung er ein Foto wischt. Michael ist 35 und gehört damit zu den älteren Usern. Eine amerikanische Studie vom Mai 2013 besagt nämlich, dass mobile Dating-Apps vor allem bei 25- bis 35-Jährigen einschlagen. Michael ist seit einem Jahr auf Tinder. Das Aussortieren der virtuellen Vorschläge ist „wie ein Stapel Akten, den ich wie ein Sachbearbeiter abarbeite“, sagt er. Romantisch klingt das nicht, aber zumindest ehrlich. Michael chattet mit zwei bis drei Frauen pro Woche. Mit 20 Prozent trifft er sich dann auch, vorzugsweise am Wochenende mit Option auf eh schon wissen. Denn einer Beziehung ist er zwar nicht abgeneigt, aber „Luftschlösser bauen sollte man auch nicht.“ Einer der größten Vorteile zum ‚realen Flirten’ - da sind sich Michael und die Tinder-Gründer einig - ist das gegenseitige Liken bevor es überhaupt zur Kommunikation kommt. Dieser Trick eliminiert das Risiko einer Abfuhr. „Die Angst vor Zurückweisung ist eine der größten Ängste der Menschen und eng verknüpft mit der Verlust- und Trennungsangst, die existenzielle Implikationen hat. Eine App, die diese Ängste kontrollieren kann, ist natürlich sehr attraktiv“, sagt Psychologe Dr. Anton Laireiter von der Uni Salzburg. In Michaels Worten: „So abgebrüht kannst’ gar nicht sein, dass dir ein Korb nichts ausmacht.“ Der andere Vorteil, mit dem Tinder sich rühmt, ist die Verknüpfung mit dem Facebook-Account: User könnten sich nicht beliebig als Calvin Klein-Models ausgeben, da sie die Fotos ihres Facebook-Profils verwenden müssen. Doch wer sagt eigentlich, dass auf Facebook nicht geschummelt wird? Auch hierzu hat Michael einschlägige Erfahrungen bei einem Date gemacht: dank Photoshop hatte das Profilbild der Dame nur wenig mit ihrem wirklichen Aussehen zu tun.
Lass dich anschauen. Aber ist es wirklich nur das Äußere, das zählt? Apps wie Tinder, bei denen die kurze Durchsicht einer Handvoll Fotos als Entscheidungsbasis genügt und die virtuelle Kontaktaufnahme bestimmt, suggerieren das. Diese Oberflächlichkeit ist aber nicht (allein) als Auswuchs unserer modernen Selfie-Gesellschaft zu verstehen. Laut Psychologe Dr. Laireiter ist sie ein natürliches Auswahlkriterium des Homo Sapiens: „Die Entscheidung ‚like’ vs. ‚not like’ liegt beim Menschen im Millisekundenbereich – egal ob ein Auto, eine Handtasche oder ein anderer Mensch betrachtet wird. Die ‚rationale Entscheidung’ ist bei uns immer noch deutlich unterentwickelt. Erst im Laufe des Kennenlernprozesses werden die sogenannten inneren Werte und Lebensauffassungen wichtiger.“ Gesichter spielen dabei laut Laireiter eine hohe, aber oft täuschende Rolle: „Das Problem bei Gesichtern ist, dass sie für Präferenzentscheidungen sehr wichtig sind, aber notwendige Informationen wie Habitus, Stimme, Sprache oder Ausdruck noch vorenthalten.“ Ob nun virtuell oder real, die äußere Erscheinung ist nicht nur wichtig für die Partnersuche, sondern auch Objekt eines ständigen Vergleichs (Stichwort: Hot or not). Patricia Groiss, Saferinternet.at-Trainerin für Jugendliche, beobachtet, dass in diesem Zusammenhang unser Selbstbewusstsein nach außen gestiegen und nach innen gesunken ist: „Bisher standen wir immer nur im Vergleich mit Menschen, die wir treffen, durch das Internet vergleichen wir uns mit der ganzen Welt und für viele drängt sich die Frage auf: Warum sollte mich jemand nehmen, wenn’s die anderen auch alle gibt?“ Weil das Tinder-Prinzip also einerseits natürlich und ehrlich, aber andererseits doch etwas einseitig ist, gibt es einige Versuche anderer App-Hersteller, die Tinder-Kritiker_innen einzufangen: Sie nutzen zwar auch die Ortungsfunktion, ‚matchen’ aber aufgrund gemeinsamer Interessen und Lebenseinstellungen. Eine der skurrileren Apps ist Snoopet, bei dem Hundebesitzer verbandelt werden sollen. „Travelling the globe for prince charming“ verspricht wiederum der Radar von Twine Canvas, einer auf Interessen bezogenen, aber noch sehr ausbaufähigen App, bei der die Fotos erst angezeigt werden, wenn beide Seiten einverstanden sind. Schräges Extra: Im Chatfenster werden passend zu den Interessen des virtuellen Gegenübers Eisbrecher-Sätze wie „Do your friends like Quentin Tarantino as well?“ vorgeschlagen.
Darf ich bitten? Zurück zu Tinder: Alex hat die App „nur so zur Gaudi“ heruntergeladen. Ernst genommen habe sie das Ganze nicht, betont die 23-Jährige. Aber egal ob am Handybildschirm oder in der Bar, sie selbst würde nie den ersten Schritt machen: „Frauen erwarten, dass der Mann zuerst schreibt. Das ist beim Fortgehen ja auch so.“ Auch Michael bestätigt das alte Rollenbild: „Von den Frauen kommt nie was. Es bin immer ich der, der ‚Hallo, wie geht’s?’ schreibt.“ Neue Dating-Technologie bedeutet also nicht auch Fortschritt in Sachen Geschlechterklischees. Psychologe Laireiter kann da nur zustimmen: „Auch wenn wir in einer sexuell und gendermäßig liberalen Gesellschaft leben, sind die Geschlechtsrollen beim Dating noch relativ konservativ. Die Frau selektiert, der Mann muss anfangen.“ Was außerdem auffällt, ist die Hemmschwelle, vor allem bei Frauen, zuzugeben auf einer Dating-Plattform zu sein. Aktiv auf der Suche (vor allem nach Sex) zu sein, ist für Männer anscheinend immer noch akzeptabler und natürlicher. Wohl gerade deshalb versucht sich Tinder öffentlich nicht als Dating-Plattform, sondern als soziales Netzwerk darzustellen. Für Alex etwa war die blitzschnelle, simple Installation von Tinder ein Schritt, den sie als genügend unverfänglich empfunden hat – anders als eine Anmeldung bei einer klassischen Partnerbörse.
Ich schau nur Ein weiteres Charakteristikum der App lässt sich also feststellen: Tinder fühlt sich nicht wie eine Dating App an. Und vielleicht ist das ihr großes Erfolgsgeheimnis. 96% der User sollen vor Tinder noch nie eine andere Dating App genutzt haben. Es trauen sich also auch die, die sich normalerweise nicht trauen. „Meet new friends, chat, socialize“ (Badoo), „Tinder is how people meet“, „Express yourself and meet interesting people“ (Twine Canvas) sind Slogans, die jeder beliebigen sozialen Plattform zugeordnet werden könnten. Flirten darf sich also nicht wie Flirten und Dating nicht wie Dating anfühlen. Unverbindlich, praktisch und amüsant soll die Suche, die nicht wie eine Suche wirken soll, sein. Da ist eine Online-Anmeldung bei einer Partnerbörse inklusive psychologischem Text schon viel expliziter. Caroline Erb, Psychologin bei Parship, sieht die Apps daher nicht als Konkurrenz zu klassischen Partnerbörsen. Abgesehen davon, dass die Altersgruppe bei Parship & Co höher ist und die meisten dieser Websites kostenpflichtig sind, haben deren Kunden laut Erb eine andere Herangehensweise: „Bei Parship geht es um langfristige Beziehungen. Die Apps sprechen eher Leute an, die flirten, Leute kennen lernen und vielleicht Affären beginnen wollen.“ Klar kann Mann oder Frau auch über eine App den Menschen fürs Leben kennenlernen. Fakt ist aber laut dem Psychologen Anton Laireiter, dass es in Europa einen deutlichen Trend hin zu mehr unverbindlichen, kürzeren Beziehungen gibt: „Internationale Studien haben herausgefunden, dass vor allem in West- und Zentraleuropa unsichere Bindungsstile in dieser Altergruppe (Anm. bis 35) zunehmen.“
Dating 3.0 Laut der Mobile-Dating Marktstudie 2013 wurden bis zum Januar 2013 in Österreich 972.000 Dating-Apps heruntergeladen. Und das war noch vor Tinders Sprung über den großen Teich. Die Nachfrage ist da, und es ist nur eine Frage der Zeit bis sich andere Technologien zum noch vereinfachteren, noch unkomplizierteren Kennenlernen etablieren und das Handy-Flirten überholen. Die To Go-Mentalität wird wohl bleiben, sei es mit oder ohne Smartphone. Saferinternet.at-Trainerin Patricia Groiss sieht allgemein eine Entwicklung in Richtung Technologie am Körper, sei es Kommunikation von Uhr zu Uhr mithilfe von Smart Watches oder automatisierte Gesichtserkennung. Tinder & Co sind erst der Anfang einer beschleunigten, zweckdienlichen und zwanglosen Tendenz, wenn es um menschliche Begegnungen geht. Ob das hot or not ist, liegt bei jedem/r Einzelnen.
Elisabeth Schepe