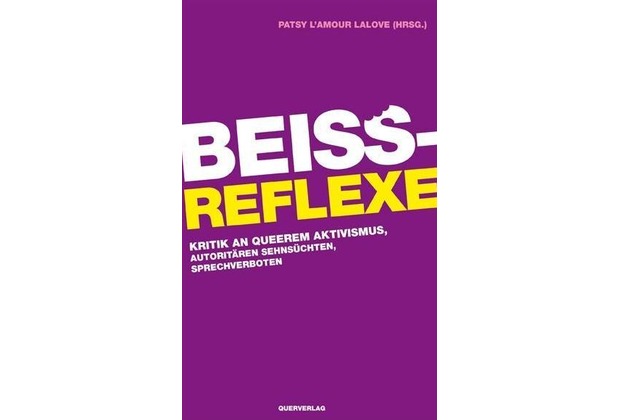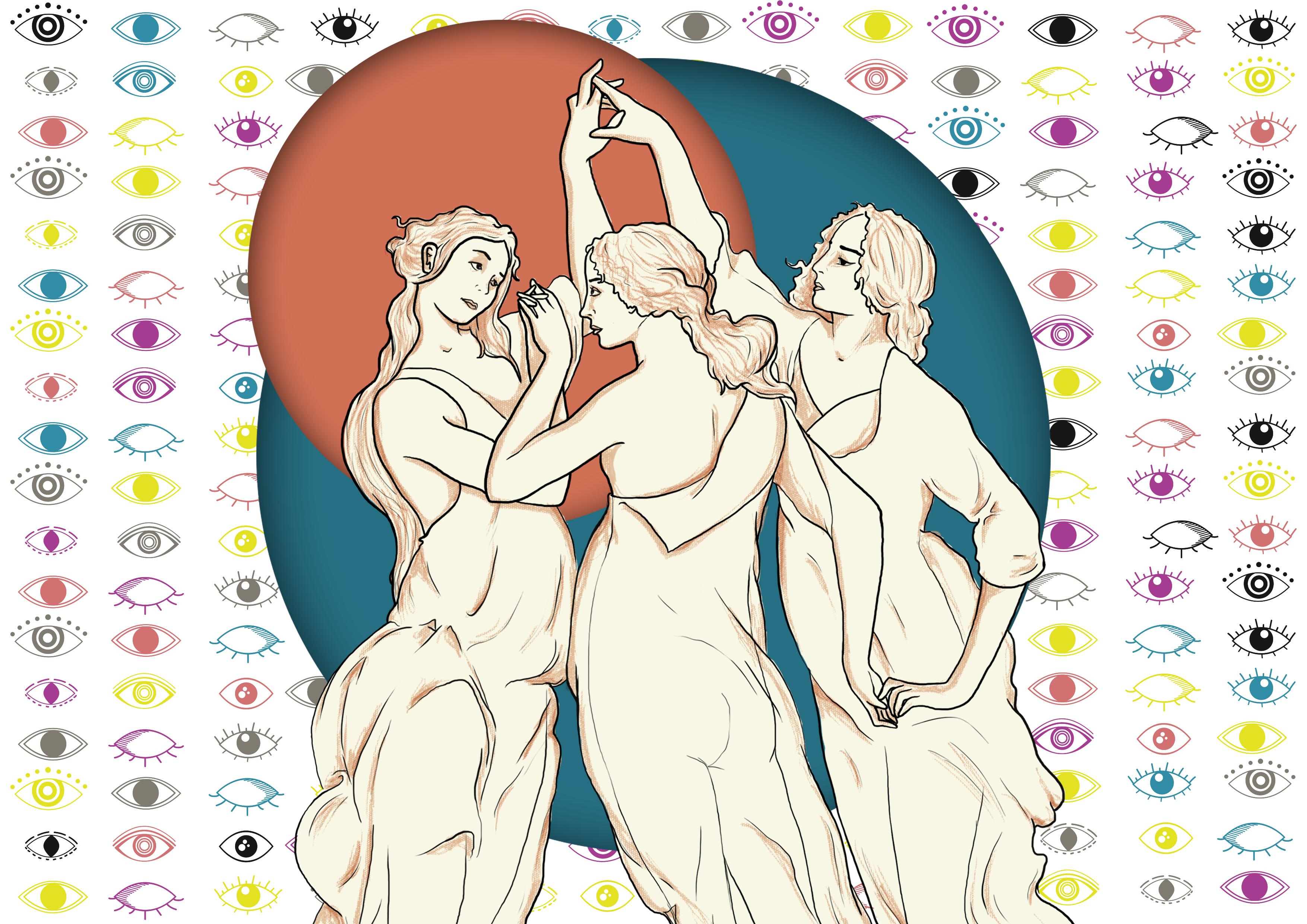„Es gibt keine Sicherheit, keinen Schutz in Syrien... nicht einmal im Libanon. Es gibt keine Hoffnung. Alle Türen wurden in mein Gesicht geschlagen... auf jeden möglichen Weg. Ich wartete lange auf einen Hoffnungsschimmer von irgendjemanden. Oder auf jemanden der mir helfen könnte und meine sexuelle Orientierung versteht.... Aber ich wurde von der Gesellschaft zurückgewiesen.. von meinen Eltern... den Menschen... der ganzen Welt.“
Knallroter Lippenstift ziert den Mund, der von dieser Hoffnungslosigkeit erzählt. Make-Up wird aufgetragen. Die Kinnpartie zittert. Im Kurzfilm „My refugee story“ erzählen LGBTIQ-Personen, die von Syrien in den Libanon flüchteten, ihre Geschichte. Sie erzählen davon, wie sie von ihrer Familie gezwungen wurden, sich auszuziehen, um der Gesellschaft zu zeigen, wie ihre Körper ausschauen. Sie erzählen, wie sie aufgrund ihrer Trans*-Identitäten von der Schule geschmissen wurden. Sie erzählen von Diskriminierungen, von Gewalterfahrungen, von Todesdrohungen, von Vergewaltigungen.
„My refugee story“ ist das Ergebnis von Workshops für geflohene LGBTIQ-Personen, die gemeinsam mit der Medienorganisation „One more Cup“ und der Initiative „Mosaic Mena“ durchgeführt wurden. Beide Organisationen setzen sich für marginalisierte Gruppen im Libanon ein. In beiden Gruppen ist der ägyptische Filmemacher und Aktivist Mohamed Nour Metwally tätig. progress erzählte er die Entstehung von „My refugee story“:
UNHCR arbeitet gemeinsam mit der Initiative „Mosaic“ an Projekten für LGBTIQ Flüchtlinge. Da kam die Idee auf. einen Film zu produzieren. Als ich zu UNHCR ging, um erste Schritte zu besprechen, fand ich mich plötzlich in einem Vortrag für LGBTIQ Flüchtlinge wieder. Ich begann mit den Personen zu sprechen, fragte sie, was sie machen wollen. Die Antwort: Wir müssen einen Film machen, weil wir von Übergriffen betroffen sind, wir müssen aufzeigen, wie sehr wir im Libanon leiden. Es ist jedoch nicht möglich, mit den Personen auf die Straße zu gehen und die Belästigungen zu zeigen. Als ich das erste Mal in den Libanon kam, sagten mir alle, ich darf keine Fotos machen. Durch die verschiedensten politischen Parteien, die teilweise stark verfeindet sind, ist das sehr schwierig im Libanon. Daher hatte ich die Idee einen Medienkompetenz-Workshop zu machen. Die Leute lernten so selber die Techniken zur Entwicklung eines Dokumentarfilms – vom Drehbuchschreiben, bis hin zu Regie und dem Schneiden. Wir begannen mit dem Schreiben von Geschichten. Wir sammelten diese Geschichten, wählten manche davon gemeinsam aus und an einem Tag drehten wir den Film.
[[{"fid":"2366","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Foto: Benjamin Storck","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Foto: Benjamin Storck"},"type":"media","attributes":{"alt":"Foto: Benjamin Storck","title":"Foto: Benjamin Storck","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
Das Ergebnis sind sehr intime Geschichten, die von verschiedenen Formen von Gewalt und Diskriminierung gegenüber LBGTIQ Flüchtlingen erzählen. Es sind Eindrücke, die auch vom UNHCR bestätigt werden. So sind laut dem UN-Flüchtlingshochkommissariat LGBTIQ Flüchtlinge mit Gewalt und sexuellem Missbrauch vonseiten der „refugee community“ ebenso konfrontiert wie von der eigenen Familie. Diskriminierung und Belästigungen gehen von staatlichen als auch von nicht-staatlichen Organisationen aus. Dies zeigt eine Studie, in der UNHCR weltweit 106 Asylbehörden im Zeitraum Juli 2014 bis Mai 2015 zum Thema queere Flüchtlinge befragte. Eines der Ergebnisse: Obwohl 64 Prozent der Behörden angaben, mindestens eine Maßnahme im Aufnahme- oder Registrierungsprozess zu haben, die sich speziell an LGBTIQ Personen richtet, berichten trotz dem Wissen um Diskriminierung und Gewalt gegenüber queeren Flüchtlingen nur 14 Prozent von der Einrichtung sicherer Schutzzonen. Zudem seien die Befragungen im Asylverfahren oft unsensibel, unangebracht. Der Film ist ein kleines Puzzlestück wie der letzte Punkt – zumindest im Libanon – geändert werden könnte, erzählt Metwally:
Im Libanon wurde der Film nicht öffentlich gezeigt. Er wird als Toolkit für Schulungen zu sexueller Orientierung und Genderidentitäten verwendet. Besucht werden diese Schulungen von Vertreter*innen verschiedener NGOS, von Sozialarbeiter*innen, Sachbearbeiter*innen – von allen, die mit queeren Refugees in Berührung kommen. Der Film wurde sehr gut aufgenommen, weil vielen dieser Personen ein persönlicher Zugang zu LGBTIQ Personen fehlt. Durch das Aufzeigen verschiedener Arten von Diskriminierung mit denen LGBTIQ Personen konfrontiert sind, erhalten sie erstmals Einblick in die Probleme und beginnen zu verstehen.
So hoffnungsvoll zeigt sich der Film jedoch nicht unbedingt. „Als ich mich endlich mit meiner Identität auseinander gesetzt und alles verarbeitet habe, traf ich nach wie vor auf Ablehnung und Zurückweisung von den Menschen, sie lehnten meine gesamte Existenz ab“, erzählt eine* der Protagonist*innen des Films. Das war der Punkt an dem sie die Hoffnung verlor – sowohl in Syrien als auch im Libanon.
Laut den Erfahrungen von Metwally gibt es trotzdem Unterschiede zwischen Syrien und dem Libanon, wenn es um LGBTIQ-Personen geht. Der Libanon sei offener. Stattdessen ist dort der Rassismus, insbesondere gegenüber Menschen aus Syrien ein großes Problem. „Es gibt einen Groll zwischen den beiden Ländern, weil Syrien den Libanon vor langer Zeit besetzte. Dadurch kommt eine Ebene des Rassismus gegenüber syrischen Flüchtlingen dazu“, erzählt Metwally. Die untragbare Situation für LGBTIQ-Personen in Syrien hat sich erst mit dem Krieg zum Schlechten gewandelt. Ob der Filmemacher und Aktivist an eine erneute Änderung in der MENA-Region (Middle East & North Afrikca) glaubt?
Ich denke, dass die Bildung diesbezüglich eine große Rolle spielt. Bevor ich in den Libanon kam, wusste ich nichts über Gender Studies. Als ich herkam, besuchte ich Schulungen zu Menschenrechten, zu sexuellen Orientierungen, zu Genderidentitäten. Ich lernte verschiedene Begriffe kennen. Ich lernte, dass es einen riesigen Unterschied zwischen Geschlecht und Sexualität gibt. So ging es auch vielen meiner Freund*innen, die von Algerien, von Tunesien oder auch vom Libanon nach Ägypten kamen, um Gender Studies zu studieren. All diese Personen und auch ich können ihre Gesellschaften, ihre Familien, durch das Wissen, das sie erlangt haben, positiv beeinflussen. Wenn man mit diesem Wissen spricht, kann man zu mehr Akzeptanz und Verständnis beitragen. Denn Stigma wird vom Nicht-Wissen produziert. Die Gesellschaft lehrt uns nur bestimmte Geschlechterrollen. Sie lehrt uns nicht, dass diese geändert werden können. Durch Bildung, durch das Sprechen über diese Dinge, beginnen die Menschen verschiedene Identitäten mehr zu akzeptieren.
[[{"fid":"2367","view_mode":"colorbox","fields":{"format":"colorbox","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Foto: Benjamin Storck","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Foto: Benjamin Storck"},"type":"media","attributes":{"alt":"Foto: Benjamin Storck","title":"Foto: Benjamin Storck","height":"253","width":"380","class":"media-element file-colorbox"}}]]
Derzeit ist es eines der Probleme noch die Unterbringung in den Zielländern. Viele der vom UNHCR befragten Behörden berichteten, dass die Akzeptanz von LGBTIQ-Personen in den Unterkünften niedrig sei, insbesondere in großen Camps. Auch Metwally kennt diese Problematik vom Libanon.
Es gibt kaum Personen, die in einer geeigneten Unterkunft wohnen. Hinzu kommt das Rassismus Problem im Libanon. Es gibt verschiedene Regionen, die unterschiedlich – je nach Religion – kategorisiert sind. Christ*innen werden getrennt, Muslim*innen werden getrennt und innerhalb der jeweiligen Regionen gibt es wieder Trennungen. Das heißt, auch LGBTIQ Flüchtlinge werden nach diesen Merkmalen untergebracht.
Er ist sich jedoch bewusst, dass es auch in Europa Aufholbedarf in der Unterbringung von queeren Flüchtlingen gibt:
Du kannst geflüchtete LGBTIQ Personen nicht in eine heterosexuelle Unterkunft geben. Viele der Personen kommen nach Europa und erwarten hier ein besseres Leben, erwarten Zugehörigkeit, „gay prides“, usw. Dann kommen sie in eine Flüchtlingsunterkunft und damit in eine Gesellschaft von der sie eigentlich flüchteten. Daher braucht es unbedingt individuelle Unterbringungsmöglichkeiten.
Valentine Auer arbeitet als freie Journalistin in Wien.