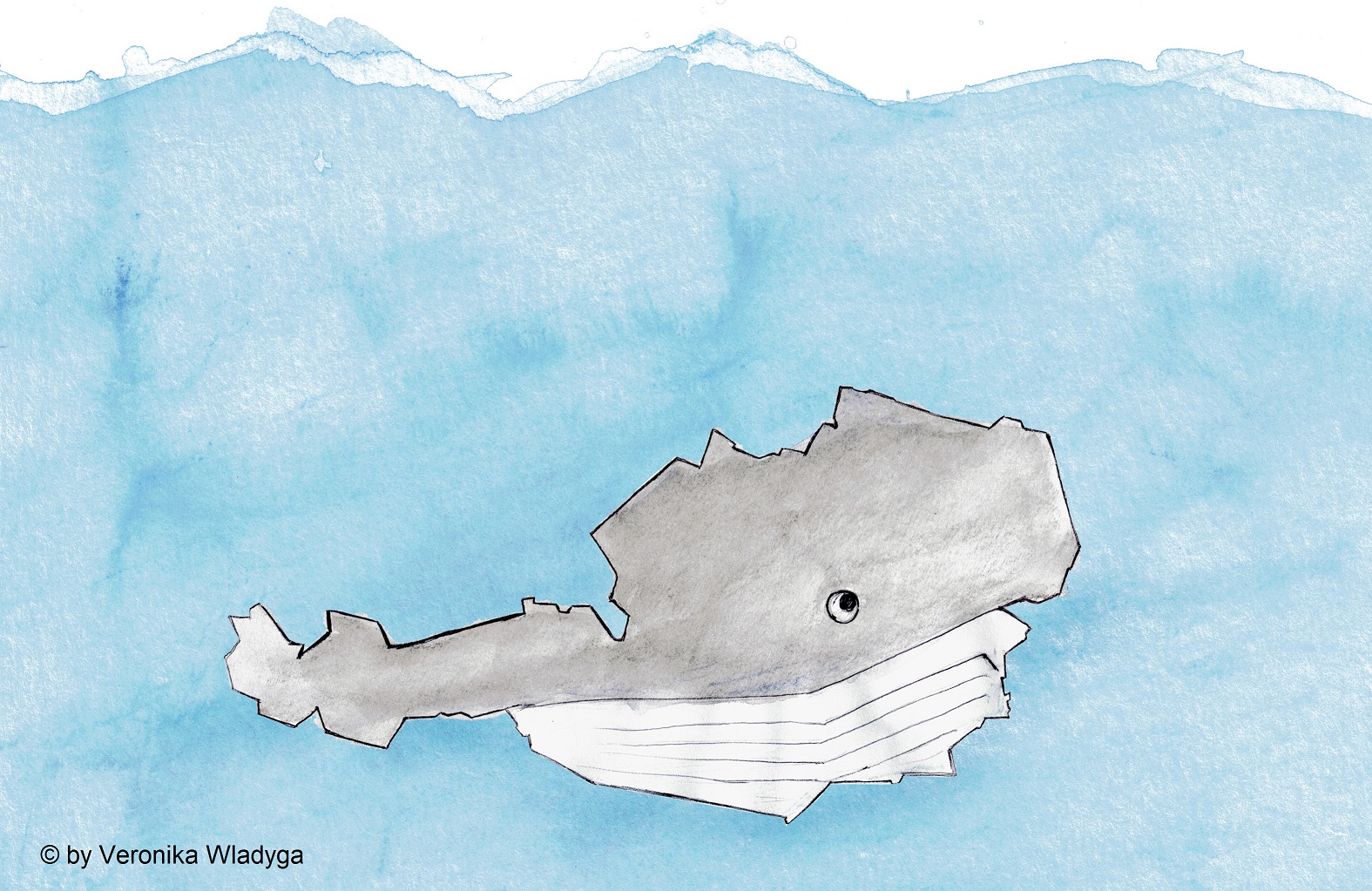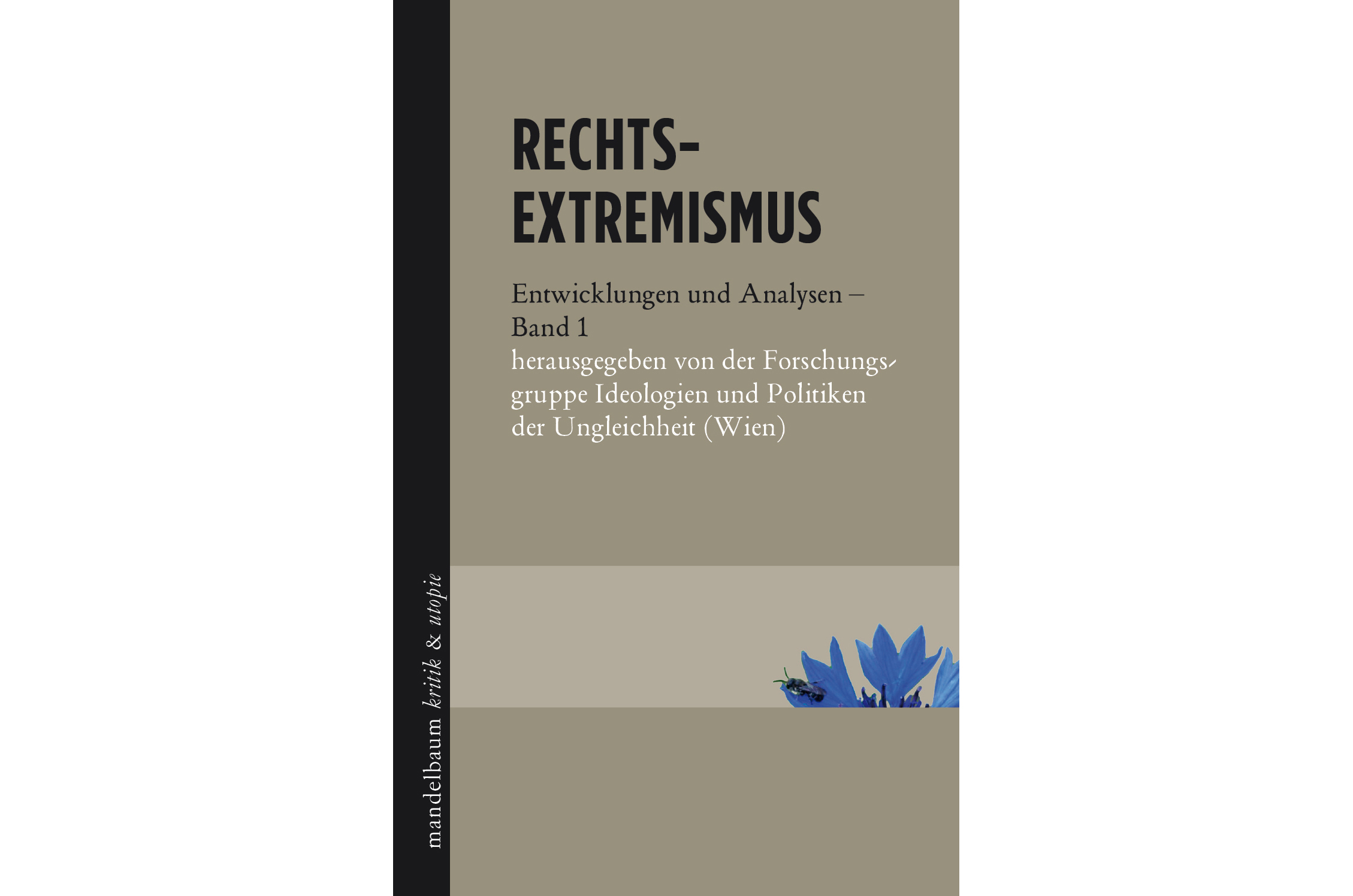Während des Studiums Eltern zu werden, ist schwierig. Oft folgen lange Studienzeiten und eine hohe finanzielle Belastung. Manche Studierende planen die Familiengründung jedoch ganz bewusst während der Unizeit.
Erst Studium und Karriere, dann Nachwuchs. Viele Studierende planen so ihr Leben. Manche entscheiden sich jedoch schon während des Studiums für ein Kind. Laut der aktuellen Studierendensozialerhebung 2011 vom Institut für höhere Studien (IHS) sind neun Prozent der Studierenden in Österreich Eltern. Das sind 25.100 StudentInnen. In Deutschland rieten jüngst PolitikerInnen jungen Frauen, ihre Kinder bereits während des Studiums zu bekommen, damit der Karriere danach nichts mehr im Weg steht. Frau, aber auch Mann sei viel flexibler als später im Beruf, so die Begründung. Doch: Was halten jene von diesem Gedanken, die bereits Nachwuchs haben? Und: Können sich Studierende überhaupt Kinder leisten? progress traf studierende Elternteile in verschiedenen Lebenssituationen. Drei Aufzeichnungen.
Zwischen Extremsport, Windeln und Peru

Jasmin studiert seit sechs Semestern Sportwissenschaften und Spanisch auf Lehramt. Nach einem längeren Aufenthalt in Südamerika kam sie zusammen mit ihrem peruanischen Freund nach Wien und brachte dort ihre Tochter auf die Welt. Bereits nach einem Monat stand sie wieder am Fußballfeld.
progress: Wann hast du das letzte Mal durchgeschlafen?
Jasmin: Kurz vor der Geburt, denn am Tag als Micaela auf die Welt kam, wurde ich um fünf Uhr morgens von den Wehen geweckt. Ich werde jetzt noch immer ganz wild, wenn im Hörsaal jemand neben mir sitzt und genervt ist, dass er um neun Uhr aufstehen musste. Schlaf ist für mich mittlerweile Luxus.
Seit wann machst du wieder Sport?
Ich bin bis eine Woche vor der Geburt mit meinem Rad durch Wien gekurvt. Bereits nach einem Monat stand ich wieder auf dem Fußballfeld, weil ich meine Mannschaft nicht zu lange alleine lassen wollte. Seit Oktober studiere ich auch wieder und mache ein paar Sportkurse. Bewegung war für mich schon immer wichtig.
Turnst du also wie gehabt mit?
Ja, so gut es geht. Mein Körper ist durch die Geburt schon sehr geschwächt. Bei ein paar Übungen muss ich immer aussetzen. Mir ist es wichtig, mein Studium so schnell wie möglich zu absolvieren. Ich muss auch sagen, dass ich Glück habe. Mein Freund kümmert sich zurzeit um unser Kind. Ab dem nächsten Semester wird es stressiger werden, weil er dann arbeitet.
Da dein Freund aus Peru kommt, habt ihr auch bürokratische Hürden. Wie läuft es bei auch ab?
Als Ausländer muss er jedes Jahr Visa beantragen, das bekommt er nur, wenn er genug Geld am Konto hat. Deswegen geht er jetzt arbeiten. Wir kommen glücklicherweise finanziell über die Runden. Es ist nicht leicht für ihn, einen guten Job zu finden, der obendrein auch noch ein bisschen flexibel ist. Ich bin wegen der Aufenthaltsbewilligung innerlich immer ein bisschen nervös, weil ich keine Idee habe, was wir machen würden, wenn Javier wieder zurück nach Peru müsste.
Du hast gesagt, du möchtest dein Studium schnell abschließen. Kann das mit Kind überhaupt funktionieren?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Sagen wir so: Ich versuche jetzt alle Einführungsveranstaltungen abzuschließen. Ich studiere zwar schon seit, quantitativ gesprochen, sechs Semestern, aber ich war währenddessen oft in Südamerika und bin herumgereist. Dort habe ich auch Javier kennengelernt, als ich bei ihm jobbte. Er besaß ein Restaurant in Lima, das er wegen mir und Micaela aufgab. Ich spüre einen innerlichen Druck, jetzt endlich fertig zu werden. Prinzipiell finde ich, dass die Studienzeit eine gute Zeit für Kinderist. Wer weiß, ob ich in ein paar Jahren auch so flexibel wäre wie jetzt.
Organisation ist die halbe Miete

Julia wurde vor viereinhalb Jahren zum ersten Mal Mutter, davor arbeitete sie als Kindergartenpädagogin und studierte Literaturwissenschaften. Zusammen mit Christian entschied sie sich 2010 für ein anderes Studium und ein weiteres Kind. Mittlerweile studiert die 27-Jährige seit vier Semestern Soziologie und sieht die Sache mit dem Kinderkriegen relativ gelassen.
Wer holt heute deine Söhne vom Kindergarten ab? Du, oder Christian?
Er. Ich habe heute den ganzen Tag Kurse an der Uni. Wir lösen alles rund um Kinderbetreuung, Kids abholen oder in den Kindergarten bringen sehr demokratisch. Dieses Wintersemester kümmert er sich mehr um die zwei, damit ich mit Soziologie vorankomme.
Hört sich nach jeder Menge Organisationsarbeit an.
Ja, aber im Regelfall verläuft alles super. Wir telefonieren nahezu ständig, weil sich immer Termine verschieben. Alle zwei Wochen sitzen wir am Abend eine Stunde zusammen und gleichen unsere Terminkalender ab. Außerdem planen wir unsere Semester gemeinsam, weil Christian neben seiner Arbeit jetzt auch Philosophie studiert.
Warst du vor der Geburt deiner Kinder auch so organisiert?
Nein, gar nicht. Ich habe durch die Mutterschaft mehr Ernsthaftigkeit entwickelt. Ich studiere mittlerweile zielstrebiger. Aber ich stresse mich nicht, es in Mindestzeit durchzuziehen. Das würde sich nie ausgehen, weil Kinder einem viel Kraft und Energie abverlangen.
Nachdem dein erster Sohn auf die Welt gekommen war, hast du begonnen, Literaturwissenschaften zu studieren. War es mit Studium und Baby manchmal schwierig?
Als ich mit Literaturwissenschaften begonnen habe, war mein Erstgeborener bereits neun Monate alt. Also nicht mehr ganz so klein. Der Studienbeginn hat für mich super funktioniert, weil ich gewusst habe, dass mein Partner und ich uns gegenseitig unterstützen. Und für das Kind macht es keinen Unterschied, ob jetzt die Mutter oder der Vater daheim bleibt, um sich um ihn zu kümmern. Manchmal haben auch FreundInnen oder meine Mutter auf ihn aufgepasst. Wir haben Glück, dass wir von ihnen unterstützt werden.
Habt ihr das Gefühl, dass Studieren mit Nachwuchs finanziell belastet?
Wir beginnen erst jetzt zu merken, dass das Geld monatlich knapper wird. Je älter die Kinder werden, umso mehr Kosten fallen an, zum Beispiel für Kinderbetreuung. Aber wir nehmen das in Kauf, schließlich ist es unsere freie Entscheidung, zu studieren. Ich könnte ja auch arbeiten gehen. Da hätte ich aber weniger Zeit für die Kinder und wäre weniger flexibel. Wir erhalten zudem noch vom Staat Hilfe und werden auch von unseren Familien unterstützt. Während des Studiums ist man flexibler.
Ist das für dich auch eine bessere Zeit, um Kinder zu bekommen?
Ich tue mir mit solchen Aussagen schwer. Wir waren relativ jung und wussten nicht, was uns erwartet. Aber es hat so gut funktioniert, sodass wir uns für ein zweites Kind entschieden haben. JedeR soll Nachwuchs dann bekommen, wenn es für sie/ihnpasst. Vor, nach, während dem Studium oder gar nicht. Wir zum Beispiel sind aber sehr beweglich, weil wir noch nicht genau wissen, wo wir beruflich Fuß fassen möchten. Das kann schon ein Vorteil sein.
Das erste graue Haar mit 23

Benjamin kommt aus Deutschland und studiert in Wien im siebten Semester Anglistik. Seine Tochter Maria* kam vor dreieinhalb Jahren in der ostdeutschen Stadt Jena in Thüringen auf die Welt, wo der damals 22-Jährige zusammen mit seiner Freundin wohnte. Seit zwei Jahren leben und studieren die drei in Wien.
Ist Wien eine kinderfreundliche Stadt?
Schwer zu sagen. Jena war sicher kinderfreundlicher. Dort gab es selbst in der Mensa Kinderspielplätze. Aber Wien ist groß und bietet viele Möglichkeiten.
Warum hat es dich gerade nach Wien gezogen?
Anfangs wollten wir beide nur ein Auslandssemester in Wien absolvieren, daraus wurden dann zwei. Schlussendlich sind wir ganz hier geblieben, weil es uns hier so gut gefiel. Außerdem waren einige meiner Freunde bereits in Wien. Somit war die Stadt kein komplett fremdes Umfeld für mich. Das war in Jena schlimmer, dort kannten wir nämlich so gut wie niemanden.
Du warst noch relativ jung, als deine Tochter auf die Welt kam. Nach einem Semester in Deutschland seid ihr nach Österreich gezogen. Wie hast du hier den Studienanfang erlebt?
Das war irre. Der Umzug hat zwar super geklappt, aber es war damals eine komplette Umstellung für uns. Es dauerte lang, einen Rhythmus zwischen Kind und Studium zu finden. Und dann noch in einer neuen Stadt. Mein erstes graues Haar bekam ich übrigens schon im Alter von 23.
Du hast deine Uni-Karriere mit Kind gestartet. In dem Sinn hast du nie den „klassischen“ Studienalltag erlebt. Stört dich das?
Nein. Eigentlich stört mich nur, dass ich nicht flexibel genug bin, um mich intensiv mit den spannenden Themen meines Studiums zu beschäftigen. Dafür fehlt mir einfach die Zeit. Es ist aber nicht so, dass ich mich wegen dem Kind eingeengt fühle. Es würde mich niemand davon abhalten, manchmal fortzugehen und Party zu machen. Aber dafür ist man einfach zu müde.
Sind Lehrende nachsichtiger, wenn sie es mit studierenden Eltern zu tun haben?
Das ist unterschiedlich. Man merkt ziemlich schnell,wer selbst Kinder hat und wer nicht. Ich habe das Gefühl, dass Lehrende, die selbst Nachwuchs haben, etwa mit Abgabeterminen nachsichtiger sind. Manchen ist das aber egal. Einmal war meine Tochter krank und ich konnte eine Arbeit nicht rechtzeitig abgeben. Meine Kursleiterin war zwar so nett und ließ mich die Seminararbeit eine Woche später abgeben. Der Haken aber war, dass ich mit einer schlechteren Note rechnen musste.
Aber schaffst du es, immer alle Kurse abzuschließen, die du dir vornimmst?
Bislang bin ich noch an keinem Kurs gescheitert. Ich mache auch meist nur maximal fünf Veranstaltungen. Dieses Semester wird es aber sehr knapp, weil alle Referats- und Abgabetermine zusammenfallen. Hoffentlich schaffe ich das.
Kommt ihr finanziell über die Runden?
Das ist das einzige, was mich wirklich stresst. Da ich Vater bin, bekomme ich drei Semester länger Bafög – das ist die deutsche Studienförderung. Aber das reicht nicht aus. Obendrein läuft es nächstes Sommersemester aus. Mich stresst die Vorstellung, nebendem Studium meine Familie zu finanzieren.
*Name geändert.
Die Autorin Elisabeth Gamperl, studiert Kultur- und Sozialanthropologie an der Uni Wien.