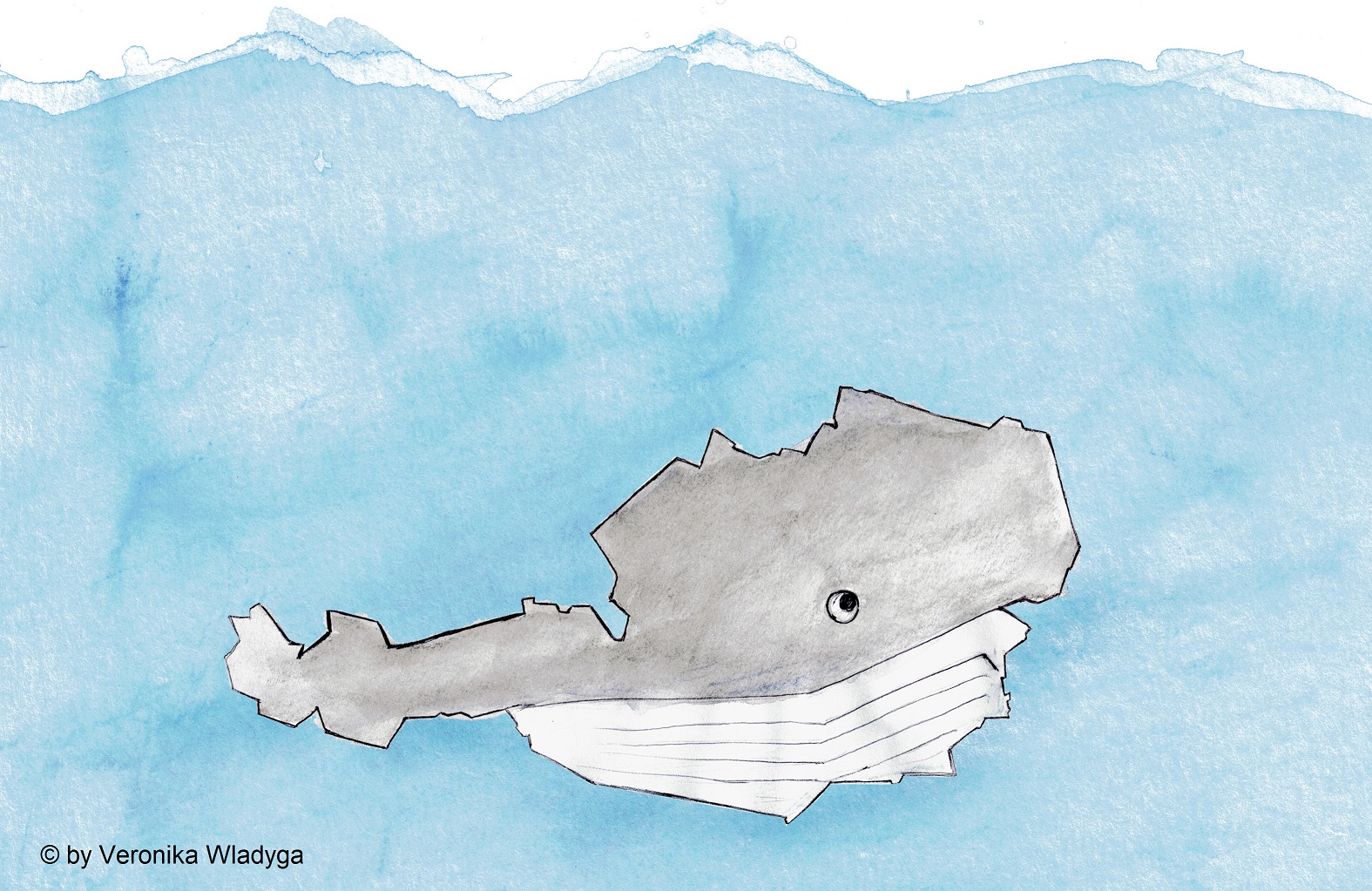Wer sich der Piratenpartei seriös nähern will, muss erst einmal die Klischeefalle vermeiden. Eine so junge politische Bewegung hat einen zweiten und einen dritten Blick verdient.
Eine Vorwarnung: Das ist kein Artikel, der die Welt erklären will. Normalerweise geht das ja so: Wer mit einem Piratenpartei-Text die Hirne der LeserInnen entern und nicht bei der Überschrift schon Schiffbruch erleiden will, muss in jedem zweiten Satz eine Jack- Sparrow-Metapher einbauen. Dann werden die PiratInnen wahlweise zu den kommenden HerrscherInnen der Weltmeere oder zum Sturm im Wasserglas erklärt. Zuviele Indianer ohne Häuptling, weltfremde IT-Nerds, FDPler ohne Porsche. Viel hat sich die Piratenpartei schon nennen lassen müssen. Was unbestritten ist: Sie hat bisher eine Erfolgsgeschichte hingelegt. 7,1 Prozent bei der Europawahl in Schweden 2009 waren gleichbedeutend mit dem ersten Einzug eines Piraten in ein legislatives Gremium. Drei Piraten sitzen in tschechischen Kommunalparlamenten, zwei Piraten in spanischen Gemeinderäten und ein Mandat in einem Schweizer Kanton wird von einem Piraten eingenommen. Das Mekka der Piratenpartei ist Deutschland. Mit insgesamt 45 Landtagsabgeordneten im Saarland, in Nordrhein- Westfalen, in Schleswig-Holstein und in Berlin sowie 194 VertreterInnen in Gemeinden sind die deutschen PiratInnen mitten im Parteiensystem angekommen. Zwischenzeitlich bis zu zwölf Prozent in deutschlandweiten Umfragen nach dem sensationellen Einzug ins Berliner Landesparlament im Herbst 2011 machten die Piratenpartei zum ersten ganz neuen politischen Player auf der Bühne des größten EU-Mitgliedsstaats, seit dem die Grünen vor 29 Jahren in den Bundestag eingezogen sind. In Berlin ärgern sich SPD und Grüne seit Monaten, dass die Piratenpartei ihre mögliche Mehrheit bei den nächsten Bundestagswahlen so gut wie verunmöglicht. Auch Österreich hat inzwischen seinen gewählten Piraten: Bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl im April diesen Jahres zog Alexander Ofer mit 3,8 Prozent der Stimmen ins Stadtparlament ein.
„Ballettschwuchteln“ und „Realdemokraten“. Innsbruck ist aber nicht nur der erste Gemeinderatseinzug der neuen Partei. Die Tiroler Landeshauptstadt ist auch ein schönes Beispiel dafür, woran es bei den PiratInnen in Österreich krankt. Kurz nach dem Wahlerfolg gab es sofort erste Positionskämpfe. Es folgten Parteiausschlüsse und gegenseitige Klagsdrohungen. Mittlerweile hat sich Österreichs einziger gewählter Pirat mit seiner Landesorganisation überworfen. Auf Heinrich Stemeseders Facebook- Wall finden sich zahlreiche Fotos von Erotik-Models, der „PiratenAnwalt“ hetzt außerdem gegen „Ballettschwuchteln“. Österreichs Piratenpartei wiederum hatte kürzlich einen schmerzhaften Abgang zu verkraften: Der ehemalige Piratenpartei-Chef Stephan Raab gründete mit drei Mitstreitern die „Realdemokraten“, die ebenfalls bei der Nationalratswahl 2013 kandidieren wollen. Nur in der Steiermark und in Wien gibt es gewählte Vorstände der Piratenpartei. Die Wiener PiratInnen sind inzwischen für ihre Stammtische in ihr drittes Lokal übersiedelt, nachdem ihnen zwei Mal Hausverbot erteilt wurde. Unter anderem, weil Vorstands-Mitglied Rodrigo Jorquera einen anderen Piraten körperlich attackiert haben soll. In allen anderen Bundesländern sind die PiratInnen in der Gründungsphase. Ein relativ präzises Parteiprogramm haben die steirischen Piraten im September diesen Jahres beschlossen. Es enthält nicht nur allgemeine Positionierungen im liberalen Spektrum, sondern auch konkrete Forderungen wie die Nicht-Privatisierung eines Grazer Krankenhauses, die Rücknahme der Alkohol-Verbotszonen in der Landeshauptstadt und die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche PartnerInnenschaften. Dennoch: Die PiratInnen zwischen Neusiedler See und Schwäbischem Meer bleiben ein Fleckerlteppich von ambitionierten Linksliberalen und frustrierten ModernisierungsverliererInnen, die sich als Opfer eines politischen Systems sehen, das sie oft gar nicht zu fassen kriegen.
Nerd-Alarm? Eine Gruppe fehlt in der Aufzählung: in der IT-Branche beschäftigte Menschen, die rund um die Proteste gegen das Datenschutzabkommen ACTA das erste Mal auch in Österreich auf sich aufmerksam gemacht haben. Die Demonstrationen gegen das EU-Abkommen waren die erste Gelegenheit, bei der man in Österreich vielerorts PiratInnen- Fahnen sehen konnte. Aus dem männlich dominierten IT-Milieu kommt auch der programmatische Fokus der Piratenpartei. Denn trotz aller Unterschiede: Bei den sogenannten Internet-Themen sind sich die PiratInnen von Stockholm bis Barcelona und von Klagenfurt bis Kiel einig. Das ist es auch, was Aufschluss über potenziellen Erfolg und Misserfolg der PiratInnen geben könnte.
Lebenswelt Internet. 76 Prozent aller ÖsterreicherInnen haben Zugang zum Internet, 91 Prozent der Unter-30jährigen verbringen zumindest Teile ihrer Freizeit online. Dass in mehreren deutschen Städten am Höhepunkt der Proteste gegen ACTA vor allem junge, nicht politisch organisierte Menschen anwesend waren, führt Markus Beckendahl darauf zurück, dass sich sogenannte „youtube-Kids“ an den Aufrufen beteiligt haben. Diese Teenager betreiben auf der weltweit größten Videoplattform ihre privaten Tagebücher und berichten über ihre neue Frisur, das neue Auto des großen Bruders und über das Outfit, das sie am Samstag in die Disco anziehen werden. Und auf einmal berichteten die „youtube-Kids“ in Deutschland auch über ACTA. Nicht aus theoretisch-weltanschaulichem Interesse, sondern weil sie verstanden hatten, dass das Abkommen ihre unmittelbare Lebenswelt und den Lieblingstreffpunkt ihrer Freizeit gefährden würde. „Die nehmen uns unser Wohnzimmer weg“, sagt ein Videoblogger in einem Aufruf zu den Demos.
Nagelprobe Berlin. Im „digital gap“ liegt die Chance der PiratInnen. Denn auch wenn viele Grüne und netzaffine SozialdemokratInnen schon seit mehreren Jahren die Themen Datenschutz, Netzneutralität und Open Government beackern, ist die Piratenpartei trotzdem am klarsten mit dem Thema „Internet“ verknüpft. Diese Positionierung ist doppelt erfolgsversprechend: Einerseits, weil die Netzthemen längst keine Nischenprobleme mehr sind . Und andererseits, weil mit der Netzpolitik ein modernes, kreatives Image verknüpft ist. Die Nagelprobe für die Piratenpartei in Berlin statt: Hier waren die PiratInnen bei den Landtagswahlen auch deswegen erfolgreich, weil sich eine einmalige Chance bot. Die Grünen waren mit dem Rückenwind der gewonnenen Wahlen im bürgerlichen Südwesten des Landes als „neue Volkspartei“ im Gespräch, inszenierten ihre Bürgermeisterinkandidatin Renate Künast bombastisch und machten damit Platz für eine nicht-etablierte, linksliberale Oppositionspartei. Jetzt muss sich die Fraktion im Landesparlament beweisen. In der Berliner Fraktion sitzen 14 Männer und eine Frau. Österreichs PiratInnen sind von diesen realpolitischen Sphären noch weit entfernt. Ihr innerparteilicher Aufbau ist aber schon wie beim großen Bruder in der Bundesrepublik. Im Bundesvorstand sitzen drei Männer, im Länderrat sechs Männer. Frauen sucht man in den höchsten Gremien der Österreichischen PiratInnen vergeblich. Das ist mehr als ein Schönheitsfehler: Es ist ein Zeichen für mangelnden Pluralismus. Schade, denn die Piratenpartei wäre eine Chance für das verkrustete Parteiensystem dieser Republik. Vor allem in Kenntnis der Alternativen, die sich bei der Nationalratswahl 2013 anstellen, um den etablierten Parteien ihre Stimmen und Mandate streitig zu machen.
Der Autor hat Politikwissenschaft und Pädagogik in Wien und Innsbruck studiert und bloggt u.a. zur Piratenpartei auf www.querschrift.me.