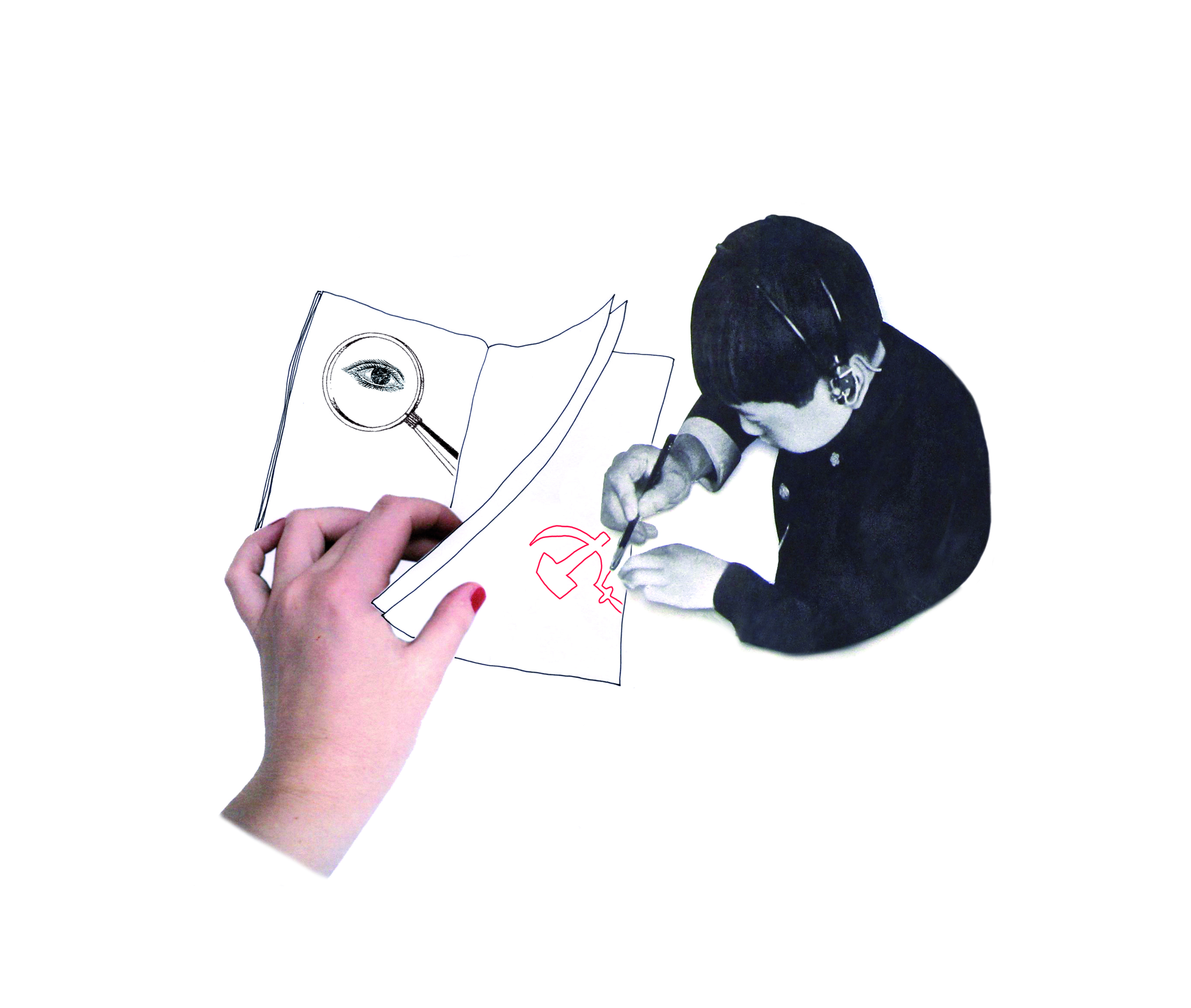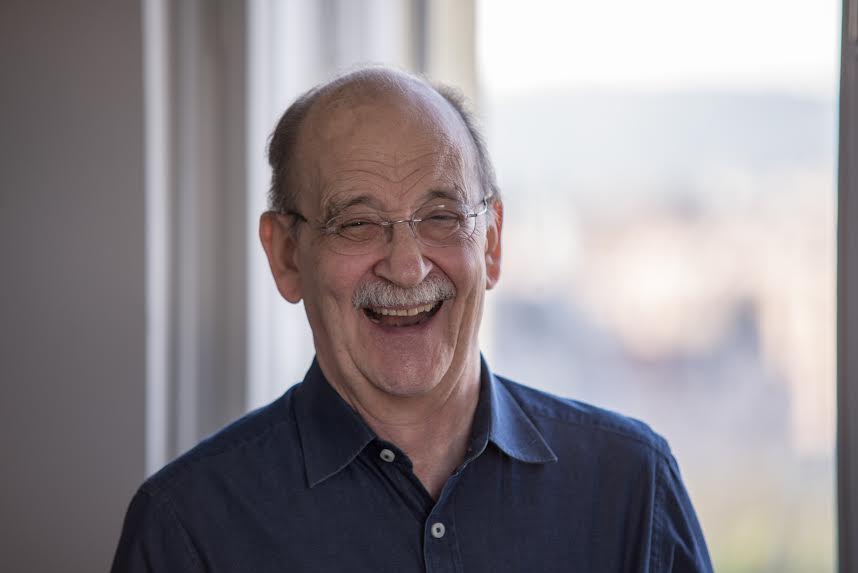Nach 150 Jahren ist Das Kapital von Karl Marx in aller Munde, seine Theorie und kommunistische Kritik sind aber weitgehend vergessen. Was die zu bieten haben, soll dieses ABC skizzieren.
Abstrakte Arbeit
ist nicht zu verwechseln mit einer bestimmten Tätigkeit, die einen bestimmten Nutzen erzeugt, sondern bezeichnet die Eigenschaft der Arbeit, den Wert der Waren zu produzieren – in einem proportionalen Verhältnis zur Arbeitsdauer. Dieser Begriff stellt klar, dass das Lob der Arbeit sich mit Marxismus nicht verträgt. Arbeit ist als Lebensnotwendigkeit jenseits von Lob oder Verdammung, immer mehr Arbeit für immer mehr Wert ist der Zweck der kapitalistischen Produktionsweise. Marx hat es behauptet, die VWL hat es bezweifelt – aber KapitalistInnen praktizieren das Wertgesetz, wenn sie in ihren Maßnahmen ihr Kapital zu seiner Vermehrung einsetzen, also darum konkurrieren, möglichst viel abstrakte Arbeit bei sich zu versammeln und gleichzeitig das Maß dieser Konkurrenz immer höher zu schrauben, also Arbeit bei sich zu reduzieren, die die Konkurrenz noch aufbringen muss (vgl. ➡️ Arbeitswertlehre ➡️ Produktivkräfte).
Arbeitskraft
Während die Arbeitskraft allgemein in der physischen Fähigkeit des Individuums besteht, die Natur zu seinem Zweck zu verändern, besteht die kapitalistische Variante dieses Umstands darin, dass die Arbeitskraft Ware sein darf. Als solche wird sie veräußert, auf dass ihre KäuferInnen sie für diese Periode – die Arbeitszeit – frei zu ihrem Zweck einsetzen können. Insofern ist der Satz unwahr, dass Arbeit bezahlt wird. Bezahlt wird dder Wert der Ware Arbeitskraft, nicht der der Arbeit, denn ihr Produkt gehört dem Kapital. Weil ArbeiterInnen nicht versklavt sind, gewinnen sie jeden Abend die Verfügung über ihre Arbeitskraft zurück, um sich erholen zu können (für den nächsten Tag).
Arbeitswertlehre
Keine „Lehre“, sondern die Kritik der politischen Ökonomie, die sich nicht mit der Banalität erledigt, dass sich der Preis der Waren nicht durch die Arbeit „berechnen“ lässt. 1. weil Marx im Kapital erklärt, dass der Wert der Ware keinen Rechtsanspruch der ProduzentInnen bezeichnet, sondern das Ergebnis eines Konkurrenzkampfes, der sich hinter dem Rücken der ProduzentInnen abspielt. 2. weil man schon kapieren muss, warum Arbeit Wert schafft, aber Maschinen – selbst Arbeitsprodukte – ihn nur übertragen, man die Wissenschaft von der Ökonomie auf die vulgärökonomische Flachheit reduziert, das Phänomen, dass jeder für seine Ware verlangt, was er kriegen kann, für den Begriff der Sache zu halten. 3. Näheres bei Marx!
Ausbeutung
hat mit einem moralischen Vorwurf nichts zu tun. Ausbeutung wird durch ➡️ KapitalistInnen dadurch erreicht, dass sie ➡️ LohnarbeiterInnen unbezahlte Mehrarbeit verrichten lassen, indem deren Arbeit ein wertvolleres Produkt produziert, als ihre Bezahlung kostet. Ausbeutung bezeichnet die trostlose Rolle der produktiven ArbeiterInnen, für diesen Zweck in Haftung genommen zu werden und ist insofern kritisch gemeint. Die Forderung eines gerechten Lohns, der den ArbeiterInnen die Arbeit wirklich entgilt, ist mit der Kritik der Ausbeutung nicht verbunden. Diese Forderung übersieht nicht nur, dass nicht die Arbeit, sondern Ware ➡️ Arbeitskraft bezahlt wird – sie geht auch von der Trennung aus, die das ➡️ Privateigentum zwischen Reichtum und ArbeiterInnen zieht.
Dialektik
Eine Wunderwaffe, mit der man Widersprüche rechtfertigt, ohne sie zu erklären, weshalb sie sich besonders in Uni-Seminaren bestens bewährt.
Gebrauchswert & Tauschwert
Was an Arbeitsmitteln und an Genussmitteln, also sachlichem Reichtum, zur Verfügung steht, macht zunächst den Reichtum jeder Gesellschaft aus. Im Kapitalismus gewinnt dieser Gebrauchswert-Reichtum zusätzlich die Qualität des Tauschwerts: Die nützlichen Dinge haben Wert, weil sie tauschbar sind. Diese zweite Qualität der Ware drückt sich in ➡️ Geld aus.
Geld
ist materialisierte, quantifizierte und ausschließende Kommandomacht über Produkte und Arbeit. Die irrationale Gestalt des ➡️ Privateigentums als Ding, auf dem die politische Ökonomie des Kapitalismus beruht.
LohnarbeiterInnen, doppelt freie
Die/Der LohnarbeiterIn bezeichnet eine recht kümmerliche Gestalt, die über die Mittel ihres eigenen Lebens nicht verfügt, aber dabei tun und lassen kann, was sie will. Durch den ➡️ privateigentümlichen Ausschluss von den ➡️ Produktionsmitteln sind die LohnarbeiterInnen auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen, was ihre Freiheit recht bescheiden ausfallen lässt.
Entfremdung
Entgegen modernen Gerüchten bezeichnete Marx mit der Entfremdung nicht Kapitalismuskritik als Sinnfrage, sondern den Umschlag des Eigentumsgesetzes (MEW 23, S. 609–611), wonach nicht mehr eigene Arbeit das ➡️ Eigentum am Produkt begründet, sondern die ➡️ kapitalistische Meisterleistung, alle Elemente des Produktionsprozesses zu bezahlen. Für die ArbeiterInnen bedeutet dies auch, dass ihre Arbeit in der Unterordnung unter den vom Kapital organisierten Produktionsprozess besteht. Die – reale – Absurdität besteht darin, dass die Arbeit nicht das Mittel derer ist, die arbeiten.
Freiheit & Gleichheit
Keine Werte, die im Kapitalismus vor die Hunde gehen, sondern die realen, juristischen Bedingungen, unter denen ➡️ Lohnarbeit und ➡️ Kapital sich begegnen. Diese Bedingungen bestehen in der realen Abstraktion davon, was die gegensätzlichen Interessen ausmacht und worüber sie verfügen. Kapital und Arbeit begegnen sich als Personen auf dem Markt, wo sie einen höchst ungleichen Tausch machen, der die Verfügung über die Ware Arbeitskraft gegen Lohn entgilt. Dass Freiheit und Gleichheit eine ungemütliche Sache sind, lässt sich auch daran studieren, dass die ArbeiterInnen anders in den Produktionsprozess eintreten (MEW 23, S. 189–191), als sie aus ihm herausgehen (MEW 23, S. 319f.).
Krisen
kommen und gehen, machen jedenfalls dem Kapitalismus leider nicht den Garaus.
Hegel
muss man nicht gelesen haben, um Marx zu verstehen (dafür müsste man Marx lesen).
historisch erkämpft
ist die Gleichberechtigung der ProletarierInnen mit ihren ArbeitgeberInnen, ebenso wie alles Soziale an der Marktwirtschaft, was für keinen der beiden Erfolge spricht. Während zu ersterem mit ➡️ Freiheit und Gleichheit das Nötige gesagt ist, besteht die Errungenschaft des Sozialstaats einfach darin, von den Schädigungen der ➡️ Lohnarbeit auszugehen, um diese zu kompensieren und die Lebenslüge des Lohns wahrzumachen, von ihm „leben“ zu können. Der Sozialstaat erhält die Gesellschaft, die ihn nötig macht, weil er sie affirmiert. Und ProletInnen leben als „einfache Leute“ vor sich hin, weil und solange sie sich ein Leben außerhalb der Organisationsformen moderner Armut nicht vorstellen mögen.
Industrielle Reservearmee
Arbeitslose; ein Produkt des kapitalistischen Einsatzes der ➡️ Produktivkräfte, wobei die Industrielle Reservearmee nicht entsteht, weil die ArbeitgeberInnen keine Arbeit „geben“, sondern weil das Kapital die Lohnarbeit so anwendet, wie es für seine Verwertung zuträglich ist. Mit ihrer Konkurrenz entfalten die Arbeitslosen segensreiche Wirkungen auf den Arbeitsmarkt, wo das Kapital durch Lohndrückerei seinen ➡️ Profit steigern kann.
KapitalistIn
Der Eigentümer von Kapital, der die ➡️ doppelt freien Lohnarbeiter für seinen Profit ➡️ ausbeutet. Als solcher hat er keinen schlechten Charakter, sondern betätigt sich als Charaktermaske, womit gemeint ist, dass er als bloße Personifikation einer ökonomischen Kategorie handelt. Gibt es nicht nur in männlich, wie schon früh eine „Dame mit dem gemütlichen Namen Elise“ bewies (MEW 23, S. 269).
Kommunismus
Kein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird, sondern die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt.
MEW
Marx-Engels-Werke. MEW Band 23 = Das Kapital Bd. 1. Lesen!
Müllhaufen der Geschichte
Bestimmungsort aller theoretischen Schriften der Agenda Austria.
Privateigentum
Im Unterschied zum Besitz einer Sache bezeichnet Privateigentum nicht den schlichten Umstand, über eine Sache (zwecks ihrer Konsumtion) zu verfügen, sondern die Willkür, sie anderen vorzuenthalten. Seine bestechende Durchschlagskraft erhält dieses Recht, wo es das Produktionsverhältnis des Kapitals kodifiziert, also dem Kapital sein Monopol auf den Reichtum der Gesellschaft sichert, während es den LohnarbeiterInnen die Unsicherheit ihrer Existenz garantiert. Deswegen muss es beseitigt werden.
Produktionsmittel
(auch: Rohstoffe, Maschinen, Gebäude) gehören dem Kapital, was dieses zur herrschenden Klasse qualifiziert. An den Produktionsmitteln hantieren diejenigen, die sie nicht haben, zum Wohle derjenigen, die damit „Arbeitsplätze schaffen“. Dieser verantwortungsvolle Beruf besteht in der eigentümlich eigennützigen Handlung, andere für sich arbeiten zu lassen – auf der schlichten Grundlage des ➡️ Privateigentums an den Produktionsmitteln.
Produktivkräfte
werden gesteigert, damit am Preis der Arbeit gedreht wird. Das Kapital verändert das Verhältnis von Vor- und Überschuss, indem es den Wirkungsgrad der Arbeit erhöht, mittels neuer Technologie und Arbeitsmethoden, was keine Wohltat für die arbeitende Menschheit ist, weil sie gleich doppelt auf ihre Kosten geht: 1. wird ihre Arbeit nicht weniger, sondern überflüssig, was zur Bildung einer ➡️ Industriellen Reservearmee führt. 2. wird die bezahlte Arbeit der nicht entlassenen Mannschaft reduziert, was schlecht ist für Leute, die ausgerechnet davon leben, möglichst viel von ihrer Arbeit zu verkaufen. Die Verringerung der bezahlten Arbeit ist die Senkung der Lohnstückkosten, wodurch das Kapital den Ausschluss der ArbeiterInnen von ihrem Produkt steigert, also seinen ➡️ Profit.
Profit (auch Gewinn)
besteht im Geld-Überschuss, den KapitalistInnen realisieren, wenn Waren verkauft werden und dabei mehr einstreichen, als sie in ihrem Vorschuss (Arbeitskräfte, Produktionsmittel usw.) investiert haben. Da der Profit für mehr Profit reinvestiert wird, also maßlos ist, steht er im Ruch, dem Gemeinwohl zu widersprechen, was nicht gerecht ist, weil er als Bedingung allen andern Einkommens (Zinsen, Renten, Gehälter) genau das Gemeinwohl stiftet, das der Kapitalismus zustande bringt: Wirtschaftswachstum!
Utopien
gehen nicht, weshalb realitätsbewusste ZeitgenossInnen gerne den ➡️ Kommunismus als eine solche bezeichnen. „Phantastische Gemütsschwärmerei“ (MEW 4, S. 3) war allerdings Marx und Engels eher peinlich, weshalb sie neben ihrem Programm der „Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“ auch polemisch Stellung bezogen haben. GegnerInnenschaft gegen die kapitalistische Produktionsweise verlangt nämlich Kenntnisse und nicht bloß Absichten.
verkürzte Kritik
ist ein antikritisches Modewort, das falsche Einwände gegen den Kapitalismus als guten Ansatz, der leider nicht weit genug getrieben wurde, würdigt. Gehört auf den ➡️ Müllhaufen der Geschichte.
Fragen & Einwände aufschreiben und an abcdesmarxismus@hotmail.com schicken!
Dragana Komunizam hat Politikwissenschaft an der Universität Wien studiert.