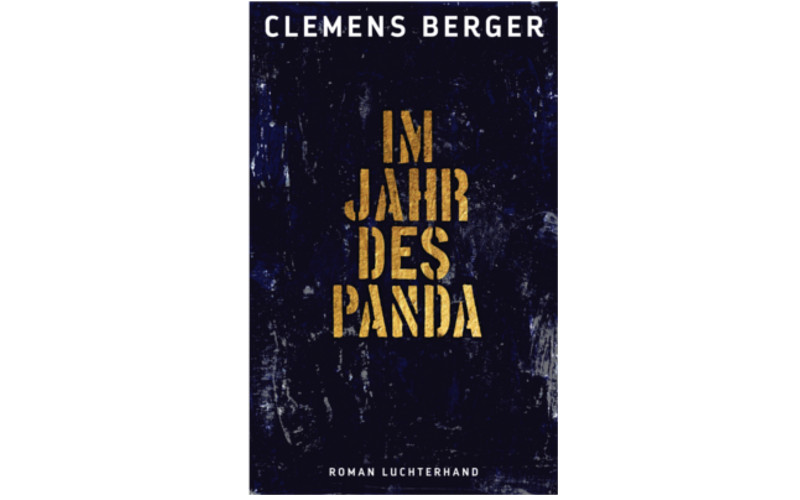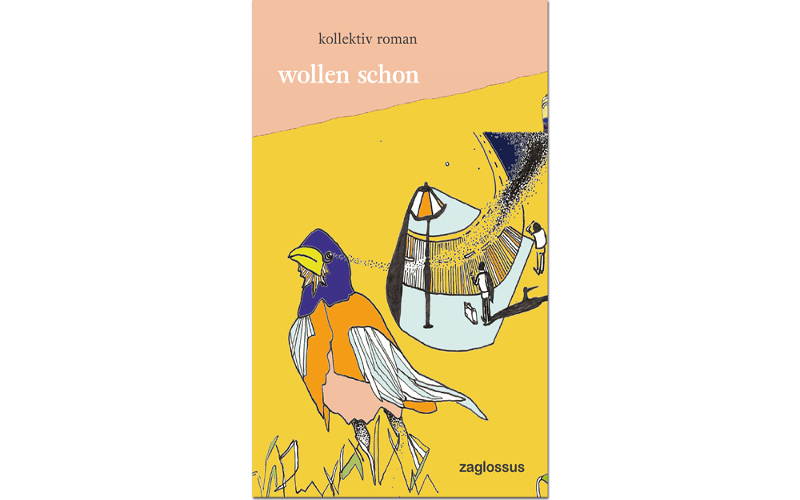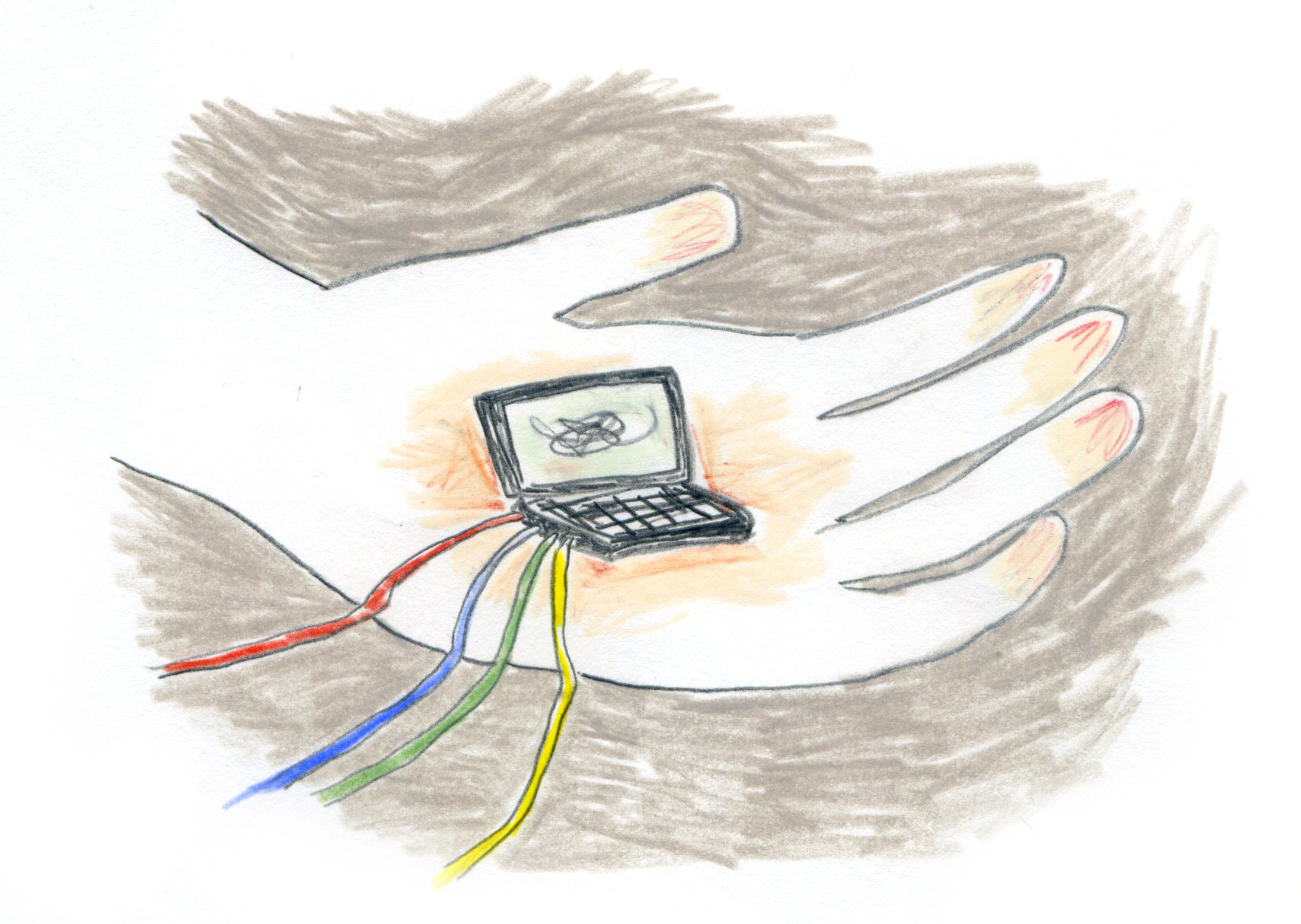Ruth Klüger über ihre Beziehung zu Österreich, Vertrauen und Eitelkeit.
Zur Linzer Premiere ihres Films kommt Ruth Klüger mit dem ICE von ihrem Zweitwohnsitz in Göttingen angereist, auf ihrem Kindle hat sie eine ganze Bibliothek gespeichert und kurz vor dem Treffen über die Situation der Frauen in Ägypten gelesen. Auf die Frage, ob sie das Interview autorisieren möchte, winkt sie ab: ,,Schicken Sie mir einfach das pdf – nicht die Printausgabe. Bücher sterben sowieso aus.’’ Dass progress-Redakteurin Vanessa Gaigg das nicht so sieht, findet sie konservativ.
progress: Am Anfang Ihres Filmes Das Weiterleben der Ruth Klüger steht das Zitat „Wiens Wunde, die ich bin, und meine Wunde, die Wien ist, sind unheilbar“ – wie fühlt sich das jetzt für Sie an, nach Österreich, nach Linz, zu kommen?
Klüger: Ich komm’ ganz gern her und rede mit Leuten wie Ihnen. Sie sind ja nicht mal mehr meine Kindergeneration, vielleicht meine Enkelgeneration. Linz kenne ich nicht so gut, abgesehen davon, dass es diese entsetzliche Euthanasieanstalt hier gab, die ich des Langen und Breiten besucht habe.
Sie meinen Hartheim?
Ja, dieses schöne Schloss, wo die ersten Gaskammern waren. Der Rest von Österreich ist mir überhaupt fremd, ich konnte den Dialekt auch nicht verstehen im Zug. Ich komm’ eigentlich aus Wien, ich komm nicht in dem Sinn aus Österreich.
Wie hat sich die Beziehung zu Wien verändert über die Jahre?
Das hat sich insofern verändert, als ich da jetzt Freunde habe. Das ist eine Gruppe von Frauen – es sind vor allem Frauen – die sich um die Zeitschrift AUF gebildet hat, die ja leider eingegangen ist. Aber wenn ich in Wien bin, gehe ich über gewisse Plätze und durch gewisse Straßen und man wird erinnert, dass man hier mit dem Judenstern herumgelaufen ist und ganz unsicher war, nicht hergehört hat. Das geht nicht weg.
Im Film sieht man auch, wie Sie Ihre alte Wohnung besichtigen.
Ja, weil mein Sohn darauf bestanden hat. Aber wir konnten nicht rein, Gott sei Dank.
Der Kontrast, der Sie vor allem interessiert, ist der zwischen Opfer und Freiheit und nicht der zwischen Opfer und Täter. Wann haben Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben das Gefühl erreicht, frei zu sein?
Zum ersten Mal in meinem Leben ... Das war, als wir weggelaufen sind, von diesem Todesmarsch nach Bergen-Belsen. Das war ein großes Gefühl von Freiheit. Man beherrscht dann eine Situation, nicht nur in der Wirklichkeit, sondern auch geistig – dass man sich über die Dinge erheben kann. So, dass man nicht gebunden ist an die Täter.
Ist es wichtig, sich nicht als Opfer fühlen zu müssen?
Naja, das Opfer wird bemitleidet und als minderwertig angesehen. Und das will man natürlich nicht sein. Aber wenn Opfer einfach bedeutet, dass einem was angetan wurde, dann kommt man nicht hinweg über diesen Begriff. Aber: Man ist noch was anders. Man ist vor allem was anderes. Ich sag ja: Ich stamm’ nicht aus Auschwitz, ich stamm’ aus Wien. Wien bedeutet mir etwas, aus Wien hab ich was gemacht. Wien ist ein Teil meiner Eigenständigkeit. Aber Auschwitz nicht. Das ist der Opferteil. Und den lehn ich ab, als mir nicht zugehörig.
Als Sie und Ihre Mutter nach Amerika emigriert sind, da gab es keine Anlaufstelle oder Möglichkeit, das Erlebte mit Hilfe zu verarbeiten.
Ja, das war eine schwere Zeit. Ich hatte das weggeschoben, was in Europa passiert ist. Und wollte einfach nur weiter, neu anfangen. Es ist alles auf mich zugekommen, Erinnerungen, Schuldgefühle, außerdem hab ich mich mit meiner Mutter nicht gut verstanden.
Ihre Mutter hat ja bis zu ihrem Tod Angst gehabt, wenn sie amerikanische PolizistInnen sah, weil sie glaubte, dass sie sie deportieren.
Sie ist paranoid geblieben bis zum Tod, aber hat ganz gut damit gelebt. Das weiß man auch oft nicht, dass die Leute, die so halb verrückt sind, ganz gut auskommen mit ihrer Verrücktheit. Meine Mutter hat New York gehasst.
Sie haben bereits als Kind Gedichte auswendig gelernt ...
Und verfasst!
... wie kam der Zugang zur Literatur so früh, wurde der familiär gefördert?
Das hat dazugehört. Ich hab angefangen mit Kinderversen. Wissen Sie, in so einem mittelständischen jüdischen Haushalt waren die Bücher einfach da.
Können Sie sich noch an Kinderbücher erinnern, die Sie gelesen haben?
Ja klar, Biene Maja und Bambi und Hatschi Bratschi – wie hieß das nur?
Luftballon?
Ja siehst du wohl – da fliegt er schon! Das war ein Nazi, der das geschrieben hat. Das hab’ ich vor einigen Jahren herausgefunden, sehr zu meinem Betrübnis. Das war so ein lustiges Buch, der konnte das. Und dann hab ich immer klassische Gedichte oder Antologien von klassischen Gedichten gelesen. Wörter zu lernen, die man nicht versteht, das hat mich überhaupt nicht gestört. So wie man ja auch Unsinnwörter als Kind ganz gern hat.
Warum glauben Sie, dass die Kindheit so eine große Bedeutung hat?
Naja, weil ich eine Freudianerin bin. Das hat Freud entdeckt, und vorher hat man es nicht so richtig gewusst. Das ist die Wurzel von allem, man kommt nicht darüber hinweg. Freud hat gedacht, bis zum Alter von sechs, aber das geht noch weiter. Ich glaub’, da hat er die Grenze zu eng gezogen. Man hat ja früher gedacht, alles was vorgeht, bevor man so ein richtiges Verständnis hat, ist unwichtig.
Sie beschreiben Ihre unterschiedlichen Wohnorte zwar oft als vertraut, so auch ihren Zweitwohnsitz in Göttingen, aber trotzdem schreiben Sie in ,,unterwegs verloren’’, dass man sich nirgendwo ganz wohlfühlen sollte. Wieso?
Schreib ich das?
Ja, ich habe es so interpretiert, dass man nie allen Menschen völlig vertrauen sollte, egal, wie wohl man sich fühlt.
Einerseits muss man vertrauen, wenn man überhaupt nicht vertraut, dann ist man verrückt. Das war das Problem meiner Mutter, sie hat nicht genug Vertrauen gehabt. Ich will das nicht überkandidln, aber wenn man einem Menschen gegenüber steht, musst du ihm glauben, außer, du hast einen Grund dazu, es nicht zu tun. Alles andere ist abwegig. Das steckt auch dahinter, wenn Kant so absolut gegen die Lüge ist. Das ist das Verbrechen schlechthin. Weil die Gesellschaft nur zusammenhält, wenn man einander vetraut. Und andererseits besteht eben die Notwendigkeit, Zweifel zu hegen und zu hinterfragen. Und das auszubalancieren ist eines der großen Kunststücke des Lebens.
Für jede Person?
Für jede Person! Aber wenn man zu einer Minderheit gehört, die verfolgt wurde, dann steckt natürlich ein Misstrauen in einem, zu Recht.
Sehen Sie Feminismus immer noch als Notwendigkeit an?
Ja sicher, das ist ganz klar. Die meisten Studierenden der Geisteswissenschaften sind Frauen und die Professoren sind Männer. Bei der Belletristik ist das haaresträubend: Die meisten Leser sind Leserinnen, die meisten Rezensenten – jedenfalls für wichtige Bücher – und Herausgeber von Zeitschriften sind natürlich Männer. Aber das weltweite Problem ist weibliche Versklavung. Damit meine ich diese Massen von Mädchen, Kindern, aber auch erwachsenen Frauen, die Sklavenarbeit verrichten müssen oder sexuell missbraucht werden. Das ist ein Problem, das in diesem Ausmaß früher nicht bestanden hat. Das geht uns was an. Und ich meine eben, dass jede Missachtung von Frauen, jeder sexistische Witz und jede Form von Missachtung schon die Wurzel und die Grundlage bildet für die massivere Ausbeutung von Frauen auf anderen Gebieten. Und darum ist es wichtig, dass man auch Sprache kontrolliert. Ich bin immer schon für political correctnes. Das bedeutet ja eigentlich nur, dass man die Leute nicht beleidigt.
In Österreich ist political correctness ganz verpönt.
Ja ich weiß, aber verpönt sein sollte die political incorrectness.
Sie haben im Film angesprochen, dass sie mit dem sozialistischen Bewusstsein aufgewachsen sind, dass Schönheit bei einer Frau keine große Rolle spielen sollte. Welche Rolle spielt das jetzt mit 81?
(lacht) Dass ich meinen Lippenstift nicht finden kann und ihn auch nie verwende. Ja, mit 81 spielt das natürlich keine Rolle mehr. Warum sollte man sich schön machen wollen mit 81?
Warum vorher?
Auch nicht besonders. Das hat bei mir nie so eine Rolle gespielt, so dass ich meistens als verschlampt galt. Oder unrichtig angezogen. Ich frag’ lieber meine Freundinnen, was man sich anziehen soll. Das hat sicher auch was mit diesem frühen sozialistischen Bewusstsein zu tun, dass von den Menschen ausging, die ich auch im Lager, besonders in Theresienstadt, gekannt hab. Das waren Sozialisten und Zionisten. Dieses Jagen nach Schönheitsidealen ist etwas Bürgerliches, das abgeschafft werden soll,weil es sich nicht lohnt.
Das heißt, Sie haben ein sozialistisches Umfeld gehabt?
Ja, wenn Sie so wollen, hab ich dort irgendwie eine Grundlage für ein politisches Denken aufgegabelt, die weitergewirkt hat. Aber das war schwer zu sagen, weil wir sind nach Amerika gekommen und der Umkreis dort war liberal-demokratisch und jüdische Emigranten waren doch alle Roosevelt-Bewunderer.
Was stört Sie eigentlich an ,,Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“?
Weil’s wieder geschehen ist. Man sagt „Nie wieder“ und dann schauen Sie sich mal all die Massaker an, die inzwischen passiert sind. Es ist absurd zu sagen, es soll nicht wieder passieren. Und das andere ist, dass das Gedenken abschrecken soll von Wiederholungen. Aber das kann auch das Gegenteil sein, nämlich dass die Erinnerung an das, was geschen ist, auch die Neonazis inspiriert. Die sagen: Diese SS-Leute waren doch fesch! Sie schauen mich entsetzt an, das ist aber schon passiert. Der Leiter der Buchenwald-Gedenkstätte hat mir mal gesagt, dass die Neonazis nach Buchenwald gekommen sind, um ihre Versammlungen dort zu haben. Und man konnte sie nicht rausschmeißen, denn man kann ja nicht die Öffentlichkeit aussperren. Das war zumindest kurze Zeit lang ein Problem.
Das heißt, man muss der Gedenkkultur kritisch gegenüberstehen?
Mir geht das Getue an den Gedenkstätten ein bisschen auf die Nerven. Ich sehe die Heroisierung der Opfer, der Helden und Märtyrer irgendwie als falsch und verlogen an. Ich habe schon Leute empört, wenn ich sowas gesagt habe. Ein KZ war ein Saustall, eine Jauche. Das ist weder heroisch noch märtyrer-artig. Und das will man nicht hören, aber so ist meine Erinnerung.
Sie finden ja auch die Glorifizierung des Widerstands oft verlogen.
Über den Widerstand ist einiges zu sagen. Dort, wo Widerständler die Oberhand hatten, zum Beispiel in Buchenwald, hatten sie oft Gelegenheit, die Listen zu verändern, die in Vernichtungslager geschickt wurden. Und da haben sie natürlich ihre eigenen Leute geschützt und lieber Juden geschickt. Außerdem ist es ihnen überall besser gegangen, außer natürlich, wenn sie erschossen oder zu Tode gequält wurden. Aber wenn man sich Filme ansieht von der Befreiung von gewissen Konzentrationslagern, einschließlich Buchenwald, natürlich waren da alle Häftlinge verhungert, aber die Juden waren wirklich am Rande des Todes. Das andere, das ideelle daran ist, dass die Veherrlichung des Widerstands dazu führt, dass das Ausmaß des Widerstands übertrieben wird.
Es ist also auch gefährlich, wenn man sich dann im Nachhinein Schuld abladen kann, indem man daran glaubt, dass es genug oder viel Widerstand gab.
Ja. Dachau war das erste Lager, das erste KZ in Deutschland, und da war eine ganze Reihe von Politischen, aber später auch eine ganze Menge Juden. Und die werden irgendwie beiseite geschoben. Bei einem Treffen des Vorstands (Anm.: der Gedenkstätte Dachau) wurde darüber gesprochen, dass man sich hüten muss vor der ,,Auschwitzisierung’’ von Dachau. Also bitte dieses Wort ,,Auschwitzisierung’’, das heißt, dass Dachau als jüdisches Lager betrachtet wird. Was sind das für Konflikte, die da aufkommen?
Von wegen: Wer waren die ärgeren Opfer oder die bewundernswerteren Opfer? Das Ganze ist ja eine Frage, wie sowas zustande kommen kann und konnte, und was das über uns als Menschen aussagt, dass es geschehen ist.
Wie fühlt sich das an, wenn Zivildiener für die Instandhaltung der ehemaligen KZs verantwortlichsind?
Ich hab jetzt nichts mehr mit ihnen zu tun. Früher hab ich mit verschiedenen gesprochen, die das wahnsinnig ernst genommen haben. Aber ich konnte es nicht recht ernst nehmen. Aber ich respektiere das, dass sich so viele junge Leute damit auseinandersetzen wollen. Wenn sie es ernst meinen und darüber nachdenken wollen, wird vielleicht doch eine bessere Welt entstehen.
Viele Leute unserer Generation haben Angst davor, dass es in absehbarer Zeit keine Möglichkeit mehr gibt, mit ZeitzeugInnen zu reden.
Ja ich weiß, das wird fortwährend gesagt. Darum bin ich auf einmal so beliebt geworden, weil niemand weiß – ich bin 81 –, ob ich noch 82 sein werde. Das ist mit uns allen so. Aber ist es wirklich derartig wichtig? Die Vergangenheit wird in das Bewusstsein der nächsten Generation eingearbeitet, und was diese Generation damit macht, ist nicht vorauszusagen. Die Überlebenden der KZs haben weiß Gott genug gesagt und geschrieben. Nicht gleich – nicht in den ersten Jahren, aber danach. Und wenn es darauf ankommt, das Zeugnis derjenigen, die es mitgemacht haben, zu bewahren: Das haben sie. Aber es ist ein Problem, über das man natürlich nicht aufhören sollte, sich den Kopf zu zerbrechen.
Das, was mich nach wie vor immer umtreibt, ist, warum gerade in Deutschland und Österreich? Das waren doch Länder, die ganz hoch gebildet waren. Als hätte man nichts gelernt in der Kindheit. Das war nicht Unwissenheit. Das ist übrigens eines der Dinge, die mich stören an diesem beliebten Roman Der Vorleser von Bernhard Schlink. Da ist das Problem, dass die Verkörperung des Nazismus durch eine Analphabetin erfolgt. Und Analphabetismus hat es praktisch nicht gegeben in Deutschland. Das heißt, die Implikation ist irgendwie, dass Unwissenheit ein Grund war. Aber das war nicht der Fall. Warum ist Antisemitismus in dieser Mordsucht ausgeartet, gerade in Deutschland? Wenn Sie das herausfinden können, philosophisch oder historisch, das wär’ was.
Es gibt ja HistorikerInnen, die behaupten, die Shoah hätte in jedem Land stattfinden können.
Ja, aber sie hat nicht. Das ist der Punkt. Sie hätte können in dem Sinne, dass es überall Antisemitismus gab und zwar oft virulenten, schäumenden Antisemitismus, aber Tatsache ist, dass er nicht ausgeartet ist in Massenmord.
In Israel gibt es viele junge Menschen, die sich die KZ-Nummern von ihren Großeltern eintätowieren lassen.
Ich hab das gehört, das ist irre. Das ist eine Mode, die ich ablehne.
Die Anschrift der Universität Wien hat ja bis vor kurzem noch Karl Lueger im Namen getragen.
Ich habe mich vor langer Zeit aufgeregt über diese fortwährende Bewunderung für den Lueger. Er hat ja noch immer dieses blöde Denkmal am Karl Lueger Platz, nicht? Zumindest eines weniger!
Im Film gibt es eine Szene, wo Sie mit einem langjährigen Freund, Herbert Lehnert, diskutieren. Der war Wehrmachts-Soldat.
Ja, und ein Nazi, sagt er selber. Wie kann man da befreundet sein? Er ist es ja schon längst nicht mehr. Der ist durch die amerikanische Re-education völlig bekehrt und kein Faschist. Das ist ein guter Demokrat, aber es steckt eben noch immer irgendwas in ihm – das diese Vergangenheit nicht vertuschen will – aber ein bisschen leichter machen will. Und darüber sprachen wir eben in der Filmszene, wie wir herumgelaufen sind am Strand. Um diese Stelle noch einmal zu rekapitulieren: Er sagt: ,,Die Nazizeit war nur eine Epoche von zwölf Jahren in einer Geschichte, die 1200 Jahre alt ist.“ Meine Antwort darauf wäre: Wenn ein 40Jähriger vor Gericht steht und sagt: Ich habe nur einen Nachmittag gebraucht, um meine Familie und die Nachbarn umzubringen, und der Rest meiner vierzig Jahre war ich unschuldig, so ist das eigentlich kein Alibi. Das hängt von der Tat ab und nicht von der Länge. Die Nazizeit ist ein gewaltiger Einschnitt in die deutsche Geschichte und es ist nicht eine Frage, wieviele Jahre sie angedauert hat. Wir haben verschiedene Perspektiven. Aber: Haben Sie nicht schon genug? Ich glaub’ ich bestell jetzt diese Grünkernknödel mit rotem Rübengemüse.
Das war wirklich meine letzte Frage. Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Vanessa Gaigg.