Neues Lehramt
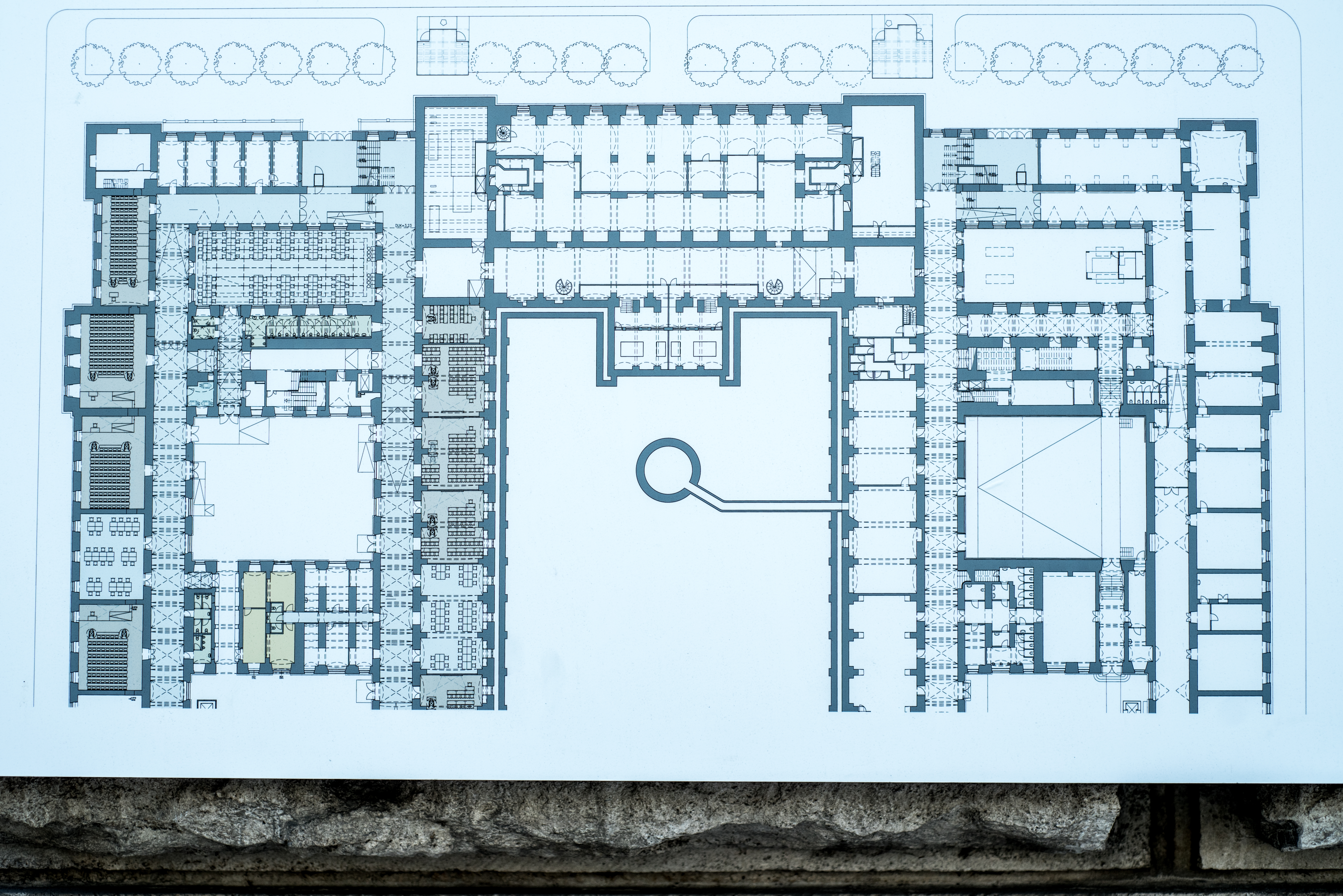
Seit nunmehr einem Semester ist das Sekundarstufenstudium in Österreich flächendeckend im Rahmen von „Pädagog_innenbildung NEU“ (PBN) reformiert. Mythen und Unsicherheiten sind nach wie vor vorhanden.
Bisher wurden Lehrer_innen je nach Schultyp an verschiedenen Institutionen ausgebildet. Wer beispielsweise an einer Neuen Mittelschule (NMS) unterrichten wollte, studierte davor an einer Pädagogischen Hochschule (PH). Ein Lehramtsstudium an einer Universität qualifizierte zu AHS- und BHSLehrer_ in. Die PBN schreibt nun für alle Sekundarstufenlehrer_innen eine gemeinsame, einheitliche Ausbildung vor. Nach Abschluss des Studiums kann in sämtlichen Schultypen der Sekundarstufe (10-18 jährige Schüler_innen) unterrichtet werden. Die Ausbildung für Volksschullehrer_innen wurde im Bachelor um zwei Semester verlängert und benötigt nunmehr zusätzlich einen mindestens einjährigen Master. Im Zuge der PBN wurde weiters die Ausbildung der Sonderpädagog_innen reformiert. Der Mythos vom Ende der Sonderpädagogik ist jedoch falsch. Sonderpädagogik kann zwar nicht mehr als „eigenständiger Studiengang“ absolviert werden. Nun aber kann das Fach „Inklusive Pädagogik“ entweder als Schwerpunkt im Primarstufenstudium (vormals Volksschulstudium) oder als quasi Zweitfach im Sekundarstufenstudium gewählt werden. Inklusion wurde mit PBN als Prinzip in sämtlichen Curricula verankert. Wertschätzung und Anerkennung von Diversität sind grundlegende Gedanken dahinter. Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention spricht von Inklusiver Bildung und meint damit „ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen“. „Ich sehe es als Vorteil, dass sich alle angehenden Pädagog_innen mit Unterricht von Schüler_innen mit verschiedenen Bedürfnissen auseinandersetzen und auf Individualisierung und Differenzierung vorbereitet werden. Alle Studierenden, die sich für eine Spezialisierung in diesem Bereich interessieren, werden nach dem Abschluss des Studiums für die Begleitung von Schüler_ innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in inklusiven Settings und an Sonderschulen – wie die früheren Sonderpädagog_innen – eingesetzt werden“, meint die Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule Oberösterreichs Katharina Soukup-Altrichter. Bereits 2003 drückte ein OECD-Bericht die Notwendigkeit von Diversitätsmanagement aus: „Die Aufgaben und Anforderungen an die Rolle des Lehrers haben sich verändert, österreichische Lehrer sind sehr wissensorientiert, aber oftmals nicht gut vorbereitet auf die Verschiedenheit ihrer Schülerinnen und Schüler und deren Bedürfnisse.“
KOOPERATION UND VERBUND. PHs und Universitäten müssen für das Sekundarstufenstudium kooperieren und gemeinsame Studienpläne anbieten. In sogenannten „Verbünden“ oder „Clusterregionen“, zu denen sich verschiedene Universitäten und PHs zusammengeschlossen haben, wird dies praktisch realisiert. Mittlerweile gibt es vier solcher Verbünde: Nord- Ost (der Zusammenschluss von PHs und Unis in Wien und Niederösterreich), Süd-Ost (Kärnten, Burgenland und Steiermark), Mitte (Oberösterreich und Salzburg) und West (Tirol und Vorarlberg). Die Verbünde haben jeweils Studienpläne für alle Lehramtsstudierenden in der jeweiligen Region ausgearbeitet. Das Ergebnis: vier verschiedene Curricula für Lehramtstudierende der Sekundarstufe.
OPTIMISMUS. „Mit PBN wird ein weiterer wichtiger Meilenstein in der österreichischen Bildungspolitik gesetzt“, heißt es dazu aus dem Bildungsministerium. „Die hochwertige Ausbildung der pädagogischen Berufe auf tertiärem Niveau und die mehrstufigen Eignungs- und Aufnahmeverfahren führen zu Qualitätssicherung und letztlich Gleichwertigkeit der pädagogischen Berufe.“ Durch das neue Lehramt sollen in Zukunft die geeignetsten Studierenden ausgewählt werden, eine einheitliche Ausbildung erhalten und nach dem Studium alle Schüler_innen einer gewissen Altersgruppe, egal in welchem Schultyp, unterrichten können. Soweit jedenfalls die Theorie. Denn die betroffenen PHs, Universitäten und Studierendenvertreter_ innen sehen die neuen Lehramtsstudien weit weniger optimistisch als das Bildungsministerium. Sie kritisieren Mängel in der Entstehung und in der Umsetzung der Reform. „Einer unserer Hauptkritikpunkte ist, dass man sich viel zu lange Zeit für die Umsetzung gelassen hat, zum Beispiel beim Erstellen der neuen Curricula, insbesondere im Verbund Nord-Ost. Und das, obwohl schon lange klar war, dass die Pädagog_innenbildung NEU kommt“, kritisiert etwa Magdalena Goldinger von der ÖH-Bundesvertreung im Gespräch mit progress. „Man hat das einfach auf die lange Bank geschoben, und dann musste alles plötzlich schnell gehen.“ Dadurch wären Curricula zu spät ausgearbeitet worden und für die betroffenen Studienanfänger_innen sei es schwierig abzuschätzen, wie ihr Studium verlaufen wird. Weiters gibt es eine Reihe inhaltlicher Kritikpunkte und Unklarheiten.
Offen ist bis jetzt die grundsätzliche Frage, wo genau angehende Lehrer_ innen studieren werden. Denn die Universitäten und Hochschulen in den einzelnen Verbünden sind teilweise weit voneinander entfernt. Wie die Kooperation der verschiedenen Standorte dabei im Detail aussehen wird, ist von Verbund zu Verbund verschieden. Bisher garantiert nur der Verbund Süd-Ost, also die Steiermark, Kärnten und das Burgenland, dass ein Lehramtsstudium an einem einzigen Standort möglich sein wird. In den anderen Verbünden müssen Lehramtsstudierende möglicherweise zwischen verschiedenen Standorten pendeln. Ein genauer Studienort wird kaum mehr zuordenbar. Mobilität und Verkehrsanbindung werden bei mehreren hundert Kilometern Standortunterschied zur wesentlichen Voraussetzung für das Lehramtsstudium. Dies ist nicht zuletzt durch die Fahrtkosten, die momentan damit verbunden wären, eine kaum überwindbare Hürde für viele Studierende. Damit drängt sich die Notwendigkeit einer praktikablen Fahrtförderung auf, wie sie beispielsweise von der ÖH mit dem österreichweiten Studierendenticket (siehe Seite 8) gefordert wird.
Ein Punkt, an dem sich die Geister zwischen PHs und Unis scheiden, ist der Anteil der Praxisstunden im neuen Curriculum. Lehramtsstudierende an Universitäten werden im neuen Curriculum während des Studiums deutlich mehr Praxisanteil haben als bisher. An den PHs reduziert sich der Anteil der Praxis im Bachelorstudium allerdings. „Im Vergleich zu den bisherigen 30 ECTS-Punkte Schüler- Kontakt im NMSStudium kann diese Neuerung schwer als Verbesserung bezeichnet werden“, kritisiert daher Dominik Weinlich von der Studierendenvertretung der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/ Krems, die nun mit der Universität Wien im Verbund Nord-Ost zusammenarbeitet. Nicht ganz so dramatisch wird diese Entwicklung von der Vizerektorin Soukup-Altrichter gesehen: „Es gibt viele Vorteile im neuen Sekundarstufenstudium. Die Kooperation zwischen PHs und Unis kann eine Akademisierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Professions- und Praxisnähe bieten. Wir werden auch weiterhin bereits im ersten Semester Erfahrungsmöglichkeiten im Praxisfeld Schule bieten.“ Dass auf die Kooperationspartner jedoch auch weiterhin Herausforderungen warten, zeichnet sich ab. Seit jeher unterrichten an PHs besonders viele „Praktiker_innen“. Vielfach sind es hier langjährige Lehrer_ innen, die Lehrveranstaltungen zu Didaktik halten. Sie können aus ihren Erfahrungen in der Schule schöpfen. Dieser Praxisbezug geht eventuell verloren, wenn auch bei Lehrenden die formellen Abschlüsse immer mehr gewertet werden. So war insbesondere der Lehrendenpool (welche ProfessorInnen welche Lehrveranstaltungen halten dürfen) ein großes Thema bei den Verhandlungen.
UMSETZUNG HAKT. Grundsätzlich ist die einheitliche Ausbildung von Lehrer_ innen eine gute Idee. In dem Punkt sind sich Studierendenvertreter_ innen durchaus mit dem Bildungsministerium einig, nur die Umsetzung wird kritisiert. „Dafür müsste es eigentlich eine Auflösung der verschiedenen Hochschulsektoren geben. Die Lehrer_innenbildung müsste in einer einzigen School of Education zusammengefasst werden“, schlägt Goldinger vor. Wenn alle Lehrer_innen denselben Studienplan durchlaufen, macht die Einteilung in Universitäten und PHs ja keinen Sinn. In so einem Gesamtkonzept müsste dann auch die Ausbildung von Elementarpädagog_innen enthalten sein, so Goldinger. Das ist allerdings Zukunftsmusik. Wie sich Studienanfänger_innen im aktuell eingeführten System zurechtfinden, ist noch schwer abzuschätzen. Die Inskriptionszahlen haben sich im Vergleich zu früheren Jahren kaum verändert. Die PBN dürfte für Studienanfänger_innen also weder besonders anziehend noch abschreckend wirken. Die Beratungsstellen der ÖH an Pädagogischen Hochschulen verzeichnen allerdings vermehrte Anfragen von Studieninteressierten, die wissen wollen, ob es tatsächlich nicht mehr möglich sei, sich nur für das NMS-Studium zu inskribieren. „Möglicherweise sind sich die Studienanfänger_innen des neuen Systems noch nicht bewusst“, sagt Goldinger. Für ein Fazit sei es dennoch viel zu früh, meint sie, die selbst an einer PH Lehramt studiert: „Wie die PBN dann tatsächlich funktioniert, sehen wir erst später an den Drop-out- Raten, also daran, wie viele derer, die sich jetzt für Lehramt inskribieren, das Studium tatsächlich abschließen.“ Studienanfänger_ innen rät sie, den jeweiligen Hochschulen und Studierendenvertretungen aktiv Feedback zu geben und darauf hinzuweisen, wenn es in einem bestimmten Bereich Probleme gibt. „Wir können noch gar nicht sagen, wie das alles genau funktionieren wird, also können wir auch keine Tipps geben. Die meisten Hochschulen sagen: Wir sind einmal gestartet, die Umsetzung ist jetzt ein laufender Prozess und dafür müssen wir versuchen, Feedback einzuholen.“ Fraglich ist die Art und Weise, wie das Schul- beziehungsweise Bildungssystem als Ganzes in dieser Reform mitbedacht wurde. Und ebenso ungelöst ist, wie die geforderte gesellschaftliche Aufwertung der Lehrer_innen passieren soll.
Magdalena Liedl studiert Zeitgeschichte an der Universität Wien.
Katharina Harrer studiert politische Bildung an der Johannes Kepler Universität in Linz.








