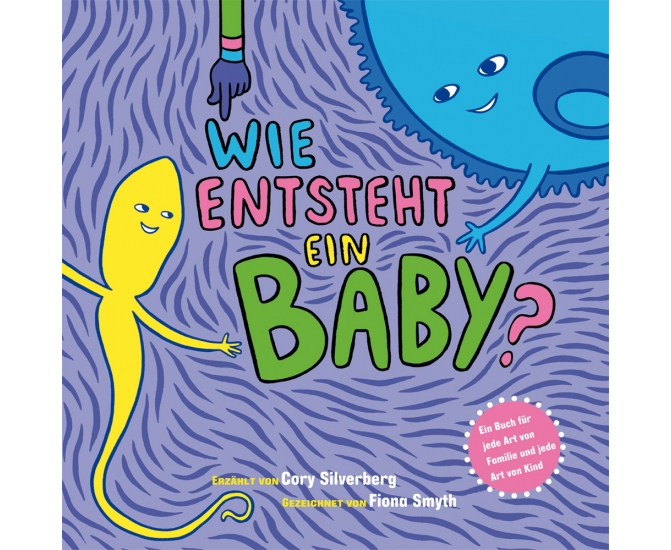Schönheit spielt schon für die Kleinsten eine große Rolle. Ein Kindergartenbesuch zeigt den richtigen Umgang mit einem sensiblen Thema.
Wer sich in diesem Jahrhundert mit einem vierjährigen Mädchen unterhält, wird kaum etwas verstehen, wenn er oder sie grundlegende Begriffe wie Tinker Bell, Hello Kitty und Prinzessin Lillifee nicht kennt. Nomingoa, Maija und Amina – alle vier Jahre alt – malen im Kindergarten und besprechen dabei wichtige Themen: „Ich schau Tinker Bell im Kino“, erzählt Nomingoa. Amina lässt sich davon nicht beeindrucken,denn sie mag lieber „die Lillifee“. Unter ihrem rosafarbenen Pulli trägt sie ein Unterhemdchen mit einem großen Bild von ihr. „Das ist meine Lieblingspuppe“, sagt sie. Im Fasching wollen sich die drei Mädchen als Prinzessinnen verkleiden. Weil Prinzessinnen schön sind.
Bin ich schön? Schönheit bedeutet in unserer Gesellschaft viel mehr als ein ansprechendes Äußeres: Wer schön ist, verlangt sich selbst etwas ab und ist diszipliniert. Wer schön sein will, leidet. Und wird auch Erfolg haben: Studien zeigen, dass schöne Menschen mehr verdienen und schneller Karrieremachen. Wer aber schön ist, liegt gar nicht so sehr im Auge des einzelnen Betrachters – oder der Betrachterin. Schönheitsideale gibt zu einem großen Teil die Gesellschaft vor, in der wir leben. Und die färbt schon die Blicke von jungen Mädchen wie Nomingoa, Maija und Amina. „Diese Werthaltungen – was ist schön, was ist nicht schön –, da haben Kinder oft wenig Chancen, das aus sich heraus zu entwickeln. Da kommt sehr viel von der Erwachsenenwelt“, sagt Daniela Cochlár, Leiterin der MA 10, der Abteilung für die Wiener Kindergärten.
Zur Frage, woher Schönheitsideale kommen, scheint es ebenso viele Theorien wie Wissenschaften zu geben. Evolutionspsychologisch betrachtet wird uns das Streben nach Schönheit angeblich schon in die Wiege gelegt: Ein Experiment zeigte, dass Babys attraktive Menschen länger ansehen als solche, die als weniger attraktiv gelten. Das soll damit zu tun haben, dass schöne Menschen körperlich robuster, also gesünder und damit fortpflanzungsfähiger sind. Auch unterschiedliche Ideale für Männer und Frauen werden damit auf zweifelhafte Weise erklärt: Während Männer zwecks Reproduktion und Fruchtbarkeit schöne Frauen suchen, ginge es den Frauen eher darum, einen ökonomischen „Erhalter“ für ihre Kinder zu finden. Der muss nicht zwangsläufig gut aussehen. „Diese Theorien erklären aber nur den Ist-Zustand. Und wenn der genau umgekehrt wäre, würden sie ihn eben andersrum erklären“, sagt Elisabeth Ponocny-Seliger, Psychologin und Lehrbeauftragte für Gender Research an der Uni Wien.

Bewusster Umgang mit Unterschieden. Die vermeintlich evolutionspsychologisch vorgegebene Rollenteilung bemerkt auch Sandra Haas. Sie leitet den Bildungskindergarten Fun&Care im 15. Wiener Gemeindebezirk, den Nomingoa, Maija und Amina besuchen. „Mädchen werden dafür gelobt, dass sie schön sind. So lernen sie, dass es ihre wichtigste Kompetenz ist, süß zu sein. Buben lobt man hingegen für ihre Fähigkeiten“, sagt sie. Der Fun&Care Kindergarten wurde 1999 eröffnet und war damals der erste geschlechtssensible Kindergarten Wiens. Zentrales Anliegen der geschlechtssensiblen Pädagogik ist es, den Kindern Raum für Entwicklung abseits von gesellschaftlich vorgegebenen Rollenbildern zu geben. Buben und Mädchen soll Chancengleichheit in allen Lebensbereichen ermöglicht werden: Mädchen können Pilotinnen werden und Buben Stewards, wenn sie das wollen. „Das Besondere an Fun&Care war, dass wir ein Gesamtkonzept gemacht haben. Wir haben es auf vier Säulen gestellt: das Raumkonzept, die Bildungsarbeit, die Elternarbeit und das Personalkonzept“, erklärt Daniela Cochlár. Sie war die erste Leiterin des Fun&Care Kindergartens. 2008 wurde das Konzept der geschlechtssensiblen Pädagogik erstmals in einem öffentlichen Kindergarten der Stadt Wien eingeführt und dann allmählich in allen Kindergärten der Stadt Wien übernommen. „Schönheitsideale spielen im Kindergarten eine sehr große Rolle“, sagt Cochlár. „Ab drei, vier Jahren oder spätestens im Vorschulalter ist das ein sehr großes Thema. Das ist auch nachvollziehbar: Wer von uns möchte denn nicht hübsch sein? Das hat ja auch viel mit Wertschätzung, Anerkennung und Akzeptanz zu tun.“
Im Fun&Care Kindergarten wirkt auf den ersten Blick alles wie in jedem anderen Kindergarten. Wer die kleinen Unterschiede erkennen will, muss genauer hinsehen – und auch hinhören: Wenn Pädagogin Katharina ihrer Gruppe etwas vorliest, sucht nicht nur der Tiger nach Futter, sondern auch die Tigerin. Wenn die Kinder Fußball spielen und Katharina im Tor steht, ist sie automatisch füralle die Torfrau, und nicht der Tormann. Wird im Kindergarten etwas kaputt, versucht Leiterin Sandra Haas es zuerst selbst zu reparieren, damit die Kinder sehen, dass auch Frauen handwerkliche Aufgabenmeistern können. In jeder Gruppe sollte es einen
Kindergartenpädagogen mit einer Assistentin oder eine Kindergartenpädagogin mit einem Assistenten als Rollenvorbilder geben. Ein weiteres wichtiges Element im geschlechtssensiblen Kindergarten ist die Raumteilung. Im Unterschied zum herkömmlichen Kindergarten findet man bei Fun&Care weder eine rosarote Puppenecke noch eine traditionelle Bauecke. Das Spielzeug soll für alle Kinder gleichermaßen bereitstehen. Dazu gehört auch die bewusste Auswahl von Spielmaterialien. Aus durchsichtigen Plastikcontainern können sich die Kinder bunte Soft-Bausteine, Puppen oder Spielfiguren holen. In jeder Gruppe steht auch ein Kosmetikkorb bereit: Mit Schminkpinseln, Haarbürsten und leeren Haarshampooflaschen, die beim Öffnen noch nach Seife duften.
Auch dieses Spielzeug ist für Buben und für Mädchen. Und tatsächlich ist es ein Bub, der als erstes zur Bürste greift. Fest entschlossen fährt David progress- Autorin Julia durch ihr langes, rot-braunes Haar: „Wenn ich fertig bin, werden deine Haare so lang und schön sein, wie die von der Rapunzel“, sagt er. Sekunden später ist Julia von vier Kindern umringt. Ihre Haare werden in Bereiche eingeteilt, sodass man sich beim Frisieren nicht allzu sehr in die Quere kommt. Ein anderer kleiner Junge beginnt ihr Gesicht mit dem Schminkpinsel zu pudern. Zwei Mädchen leeren fiktives Shampoo auf ihren Kopf – die Kinder machen Julia schön. Vielleicht wolle er selbst irgendwann so lange Haare haben, überlegt David; da verwirft er den Gedanken auch schon wieder: Bei Mädchen sind lange Haare ja schön. Aber bei einem Buben? Da geht das nicht, stellt David fest.

Verschiedene Einflüsse. Selbst wenn Eltern darauf achten, ihre Kinder fernab von Rollenklischees zu erziehen, werden sie spätestens im Kindergarten davon eingeholt. „Auch bei uns sind 90 Prozent der Mädchen rosa gekleidet. Das wollen wir den Kindern auch nicht wegnehmen – sie sollen sich aber nicht über die Farbe definieren“, sagt Kindergartenleiterin Haas. Bis zum Kindergartenalter wird fast jedes Kind sagen, dass „die Mama“ die schönste Frau sei. „Das ist wirklich lieb und da antworten fast alle gleich“, erklärt Psychologin Ponocny-Seliger. Dann sind plötzlich Prinzessin Lillifee und Barbie schön und bei Buben ist vor allem Superman cool. Plötzlich gibt es eine Reihe von Einflussfaktoren: die Eltern, die KindergartenpädagogInnen oder andere Kinder, die ein Vorbild sein können. Wenn ein Mädchen dann ein rosafarbenes Röckchen anhat, wollen es die anderen auch. Und sie fordern es zu Hause auch ein. „Die Kinder dürfen hübsch sein, Prinzessin sein, ein Röckchen anhaben; es gibt aber adäquate Kleidung für bestimmte Zwecke. Wenn man in die Sandkiste spielen geht, ist eine Gatschhose wesentlich hilfreicher als einRock“, sagt Cochlár.
In der Praxis des Kindergartens ist es nicht immer einfach, das Konzept der geschlechtssensiblen Pädagogik umzusetzen. „Natürlich wird niemand gezwungen. Wenn ein Mädchen rosa tragen will, ist das vollkommen in Ordnung. Die Farbe an sich ist ja nicht das Problem. Man muss den Kindern nur aufzeigen, dass es auch anders geht“, sagt Fun&Care- Leiterin Haas. Im Fasching versucht sie das Klischeeproblem geschickt zu umgehen: Damit es nicht nur Prinzessinnen und Cowboys gibt, werden immer wieder andere Themen ausgewählt. Nicht nur Personen im direkten Umfeld beeinflussen die Kinder – im Fernsehen oder online sehen sie täglich, was schön ist: Barbies für Mädchen, Roboter für Jungen. „Kinder im Kindergartenalter wissen unterbewusst, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sie ausbilden sollen, damit sie für ihr Geschlecht passend wahrgenommen werden“, sagt Claudia Schneider. Sie ist Leiterin des Vereins Efeu, der sich mit geschlechtssensibler Pädagogik beschäftigt. Kürzlich ist sogar eine neue Lego-Edition für Mädchen herausgekommen: Sie ist rosa, enthält fünf „Freundinnen“ als Spielfiguren, die ihre Zeit im Schönheitssalon, im Kaffeehaus und auf dem Reithof verbringen; bauen kann man damit kaum mehr etwas. „Begriffe wie ‚schön‘ oder ‚stark‘ sind sogenannte ‚Gender Codes‘, Eigenschaften, durch die eine von den zwei in unserer Gesellschaft verfügbaren Kategorien, nämlich männlich oder weiblich, ausgedrückt werden. Wir können diese Begriffe schnell einordnen, weil wir in diesem dualen Zweigeschlechtersystem denken“, erklärt Schneider. Freiräume, in denen Kinder vieles ausprobieren können, hält sie für besonders wichtig. Sie erzählt von einem Kindergarten, wo ein männlicher Pädagoge mit den Buben der Gruppe Schönheitssalon spielte. „Das sind Erfahrungen, die Kinder oft so nicht machen können. Dafür einen geschützten Rahmen anzubieten, kann sehr produktiv sein.“
Zurück im Kindergarten wird ein Bub von den Mädchen zum Mutter-Vater-Kind-Spielen in die obere Etage eines einstöckigen Spielhauses beordert. Er erhält Anweisungen, wie er das Puppenbaby richtig pflegen muss. Seit der eigenen Kindergartenzeit hat sich ja doch nicht alles geändert; nur wird heute viel bewusster mit den Kindern und den Rollen, in die sie gedrängt werden, umgegangen. Das tut den künftigen Astrophysikerinnen und Hausmännern gut.