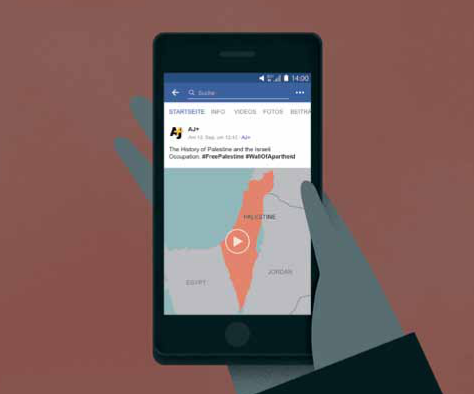Reden wir Tacheles: Claude Lanzmann

Claude Lanzmann war auf Einladung des Filmclub Tacheles zu Besuch in Wien. Erzählt hat er vieles. Wir haben beim Filmclub nachgefragt, wie es dazu kam.
Seit dem Sommersemester 2017 gibt es den Filmclub Tacheles an der Universität Wien. Bei einer Veranstaltungsreihe dieses Semester zeigte man Lanzmanns Israel-Trilogie. Höhepunkt war ein Vortrag von Claude Lanzmann selbst im vollbesetzten Audimax.
Lanzmann – ein polarisierender Charakter, einerseits bekannt durch seine Filme, andererseits durch seine schriftstellerischen Tätigkeiten, vor allem als Herausgeber von Les Temps Modernes, zusammen mit Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Wie kam es nun dazu, dass Lanzmann einen Vortrag im Wiener Audimax hielt? „Die Mutter eines Filmclub- Mitglieds hat den Vorschlag gebracht, was zunächst belächelt wurde. Ein Telefonat und eine E-Mail später hatten wir dann seine Einwilligung, was uns sehr verblüfft hat. Von diesem Zeitpunkt an war es für uns von höchster Wichtigkeit, dem Regisseur selbst Raum zu geben, sich zu seinen Filmen zu äußern“, erklärt ein Mitglied des Filmclubs.
Der Filmclub Tacheles ist eine Initiative von antifaschistischen Student_innen verschiedener geistesund kulturwissenschaftlicher Disziplinen, die Filme zu den Themen Judentum, Israel und Antisemitismus zeigen wollen. Primäre Intention zur Gründung war der Wunsch, Lanzmanns Hauptwerk vorzuführen. „Die meisten Studis wissen um die Filme, aber finden nie die passende Gelegenheit, sich diese anzuschauen“, meint eine Aktivistin des Filmclubs. Gezeigt wurde die Israel-Trilogie: Diese umfasst Pourquoi Israël, in dem es um die ersten Jahre des Staates Israel geht; Shoah, Lanzmanns wohl bekanntestes, 9½-stündiges Meisterwerk; und Tsahal, der um das israelische Heer zentriert ist. Insgesamt sind das 18 Stunden und 41 Minuten, die dieses Semester an vier Nachmittagen an der Universität Wien über die Leinwand liefen, wobei Shoah in zwei Etappen zu je zirka fünf Stunden gezeigt wurde.
Lanzmanns Filme sind voller Interviews und vermitteln authentische Eindrücke von Zeitzeug_innen in den 1970ern. Es fühlt sich zynisch an, in diesem Kontext den Begriff authentisch zu verwenden – Lanzmanns Werk ist zweifelsohne echt, reale Abbilder des Unvorstellbaren beziehungsweise Unzeigbaren. Shoah gilt bis heute als die erfolgreichste, umfassendste und auch erfassendste filmische Auseinandersetzung mit dem Genozid an den Jüdinnen und Juden im zwanzigsten Jahrhundert. Es wäre nicht möglich, seine Filme an dieser Stelle ausreichend zu beschreiben – um zu verstehen, muss man sehen. „Was fundamental ist, lässt sich nicht zerteilen. Kein Warum, aber auch keine Antwort darauf, warum das Warum zurückgewiesen wird – aus Angst, dieser Obszönität zu verfallen“, so Lanzmann im Vorwort zum 2011 erschienenen Buch zu Shoah.
An einem Freitagabend im März füllte sich also das Audimax der Hauptuniversität mit Studierenden und Interessierten jeden Alters. Spannung lag in der Luft, als der 91-jährige Lanzmann den Saal betrat, gestützt auf einen Gehstock, begleitet von einer grandiosen Dolmetscherin. Lanzmann ist Franzose, und trotz seiner Deutschkenntnisse bevorzugt er seine Muttersprache – bewundernswert ist die Dolmetscherin, da Lanzmann keine Rücksicht nimmt. Man merkt, er hat schon oft diese Episoden aus seinem Leben erzählt, der Vortrag ist also ein Zuhören und Warten, ein Hin und Her zwischen jeweils 15 Minuten Französisch und Deutsch. Lanzmann erzählt von seinen Erfahrungen mit dem israelischen Militär, rund um den Dreh von Tsahal, von seinem neuen Film Vier Schwestern, der noch immer vom Material von Shoah zehrt. Auch über den Entstehungsprozess rund um seinen Film und einzelne Episoden mit seinen InterviewpartnerInnen wird gesprochen. Er verweist oft auf seine 2010 erschienene Autobiografie Der Patagonische Hase, in welcher er ebenso episodisch wie bei der Lecture im Audimax aus seinem Leben erzählt. Wer also mehr über die Entstehungsgeschichte seiner Werke erfahren möchte, ist mit seiner Autobiografie gut beraten. Darin führt er auch aus, dass er DolmetscherInnen gewohnt sei, die einen Lauf von einer halben Stunde Länge mit Notizen übersetzen können, was seine fordernde Erzählweise im Audimax erklärt. Lanzmann als Popstar unter den ErzählerInnen: Am Ende des Vortrags gab es Standing Ovations, gefolgt von Signier-Session, Selfies und langer Schlange am Merch-Tisch.
Ebenso dankbar wie der Filmclub Tacheles für die Zusage Lanzmanns waren wahrscheinlich auch alle Anwesenden über die Möglichkeit, Lanzmann einmal live zu erleben. Und auch der Filmclub Tacheles ist motiviert für mehr. Im Juni veranstaltete man ein Balagan am Campus mit Filmscreening und Party. Außerdem beginnen gerade Kooperationen mit Gruppen an anderen österreichischen und deutschen Universitäten.
Den Vortrag kann man sich unter diesem Link ansehen.
Der Filmclub Tacheles: https://www.facebook.com/ filmclubtacheles
Franziska Schwarz studiert viele Dinge an der Universität Wien, unter anderem Publizistik