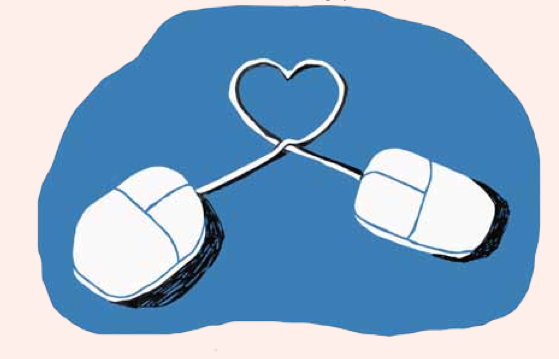Online-Dating ist eine Konsequenz aus unserer Wirtschaftsform
Der Kurzfilmregisseur Gregor Schmidinger beschäftigt sich nicht nur viel mit Sexualität, er geht auch sehr offen und kritisch mit dem Thema um. Das progress hat mit dem 28 jährigen unter anderem über seine Erfahrungen mit Online-Dating, gesellschaftliche Beziehungsideale und sein kommendes Filmprojekt gesprochen.

P { margin-bottom: 0.21cm; }
Der Kurzfilmregisseur Gregor Schmidinger beschäftigt sich nicht nur viel mit Sexualität, er geht auch sehr offen und kritisch mit dem Thema um. Das progress hat mit dem 28 jährigen unter anderem über seine Erfahrungen mit Online-Dating, gesellschaftliche Beziehungsideale und sein kommendes Filmprojekt gesprochen.
progress: Du hast zu Beginn dieses Jahres einen Selbstversuch gestartet, bei dem du, unter anderem, auf den Konsum von Pornographie oder Online-Datingplattformen verzichtest. Du dokumentierst deine Erfahrungen seither auch auf einem Blog. Wie ist es dazu gekommen?
Gregor Schmidinger: Ich habe gemerkt, dass Pornographie Auswirkungen auf mein Sexualleben gehabt hat. Zuerst war mir gar nicht klar, dass Pornographie daran Mitschuld war. Pornos sind im Internet ja quasi unbegrenzt verfügbar. Als ich in die Pubertät gekommen bin, wurde das Internet gerade zum Massenmedium. Dadurch habe ich relativ schnell die Pornographie entdeckt. Vor allem wenn man schwul ist und in einem 1.800 Seelendorf lebt, ist das die einzige Möglichkeit die eigene Sexualität zu erforschen. Irgendwann wird es dann aber zur Gewohnheit und dadurch wird natürlich die eigene Wahrnehmung verändert. Und so ist dann das Projekt entstanden. Ich hab mich auch gleich dazu entschieden, dass über einen Blog öffentlich zu machen. Seither bekomme ich relativ viele Rückmeldungen. Das ist auch ein sehr breites Phänomen, über dass sich wenige reden trauen, weil es etwas sehr intimes und mit Scham behaftet ist.
progress: Wie ist es dir seither mit deinem Selbstversuch gegangen?
Schmidinger: Zu Beginn war ich super motiviert. Die ersten paar Tage sind recht gut gegangen, dann hatte ich einmal einen Durchhänger. Nach zwei bis drei Wochen ist es dann aber relativ einfach gegangen. Mir ist es auch zwei dreimal passiert, dass ich wieder abgerutscht bin, da muss man sich dann halt wieder herausholen. Das Bedürfnis des täglichen Pornoschauens ist aber mittlerweile komplett weg. Das Projekt wird auch sicher länger als ein Jahr dauern. Schön langsam komme ich in einen emotionalen Bereich hinein, den ich sehr spannend finde. Gerade beschäftige ich mich mit den Funktionen von sexuellen Phantasien. Pornographie ist am Ende ja nichts anderes, als eine visualisierte Version einer sexuellen Phantasie.
progress: Hast du eine konkrete Vorstellung davon, wohin das Projekt gehen soll?
Schmidinger: Es ist eine Reise, ein Prozess, ein entdecken was passieren wird. Aber eigentlich geht es mir um eine selbstbestimmte und selbstbewusste Sexualität. Weg vom Fremdbestimmten, also Bilder die einem über die Medien, Filmen und so weiter sagen, wie etwas zu sein hat. Je mehr ich mich damit beschäftige und darüber lese, desto mehr merke ich erst wie schambehaftet Sexualität in unserer Gesellschaft eigentlich wirklich ist. Dabei stelle ich mir die Frage ob das wirklich so sein muss und was anders wäre wenn es nicht so wäre
progress: Welche Erfahrungen hast du mit Dating-Plattformen im Internet gemacht?
Schmidinger: Angefangen habe ich damit als ich ungefähr 16 war. Ich glaube braveboy.de (die es heute nicht mehr gibt, Anmk.) war das erste, was ich ausprobiert habe. Ich hatte immer wieder Phasen in denen ich gar nicht auf diesen Plattformen unterwegs war, ansonsten war ich aber eigentlich relativ regelmäßig auf Seiten wie Gayromeo oder zum Schluss auch Grindr – das sind auch die klassischen Plattformen, für schwule Männer zumindest. Mittlerweile habe ich damit aber komplett aufgehört. Auf Online-Dating, in dem Sinne wie es gemeint war, habe ich mich aber nie wirklich eingelassen. Sehr selten habe ich mich mit Leuten getroffen. Die Treffen waren meistens enttäuschend. Man hat ein gewisses Bild und einen Beschreibungstext von der Person im Kopf. Und alle wissen, dass sie die besseren Bilder nehmen und die interessanteren Sachen schreiben sollten. Das führt zu vielen blinden Flecken in Bezug auf die andere Person, die man dann mit seinen eigenen Wünschen ausfüllt - dessen ist man sich vielleicht nicht automatisch bewusst. So entstehen schnell Vorstellungen und Hoffnungen darüber, wie jemand sein wird. Wenn man die Person dann trifft, entsteht ein Spalt zwischen der eignen Erwartung und der Realität. Das Gegenüber hat dann kaum eine Chance diese Erwartungen zu erfüllen. Das war bei mir bei fast allen Treffen der Fall. Zwei oder drei positive Erfahrungen habe ich aber schon auch gemacht.
progress: Dating-Plattformen werden ja ganz unterschiedlich genutzt, von der Beziehungssuche, Zeitvertreib oder Chatten bis hin zur Suche nach Sexdates. Wie hast du die Plattformen verwendet?
Schmidinger: Eine Beziehung habe ich aber nie wirklich gesucht, gehofft vielleicht. Für mich das online-daten mit unter auch etwas von einem interaktiven Porno. Wenn man etwa entsprechend Bilder austauscht oder in eine gewisse Richtung schreibt. Meinen Freund habe ich zwar ursprünglich auf Grindr zum ersten Mal gesehen, ich muss aber gestehen, dass sich das Interesse damals nicht über die Oberflächlichkeit hinaus entwickelt und schnell verlaufen hat. Zufällig haben wir uns dann einmal persönlich getroffen und dann war mein Interesse plötzlich voll da. Das ist ein gutes Beispiel, wäre es nur über Grindr gegangen, wäre aus uns wahrscheinlich nie etwas geworden. Es fehlen auf diesen Plattformen auch einfach viele wichtige Informationen, das haptische, die Gestik, wie jemand spricht, der Tonfall.
progress: Kritisiert wird an den Dating-Plattformen ja mitunter auch, dass ein starker Ranking- und Effizienzgedanke der damit einhergeht. Wie siehst du das?
Schmidinger: Ja, man geht ja auch sehr systematisch vor. Zuerst schreibt man einmal alle Leute an und dann sortiert man nach und nach aus. Dabei lässt man sich natürlich nie wirklich auf jemanden ein und sortiert nach oberflächlichen Kriterien aus. Alles andere würde wahrscheinlich auch zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich kenne jemanden der, wenn er von jemanden angeschrieben wird, der kleiner ist als 180 cm ist, schreibt er nicht zurück. Es funktioniert halt sehr Schemenhaft, es ist ein bisschen so wie einen Katalog durchblättern. Das fühlt sich sehr kapitalistisch an, weil es so Maßgeschneidert ist und alles andere, das was es eigentlich ausmacht, die feineren Informationen, die fehlen halt komplett.
progress: Glaubst du hat Online-Dating generell einen Einfluss darauf wie wir nach Beziehungen suchen und sie leben?
Schmidinger: Also wenn, dann glaube ich, dass es nur zu einer Extremisierung führt. Ich glaube, dass Online-Dating nur die Konsequenz aus unserer Wirtschaftsform aber auch aus unserem kulturellen Verständnis von Beziehungen ist. Beziehungen sind in unserer Gesellschaft austauschbar. Das wird ja auch serielle Monogamie genannt – wir sind zwar monogam aber immer nur hintereinander. Problematischer finde ich noch, dass wir einen suchen der uns alles geben kann und zwar für Immer. Diese Perversion des eigentlich ursprünglichen romantischen Gedankens: wir idealisieren nicht mehr den Alltag und einen, Gott sei Dank, nicht perfekten Menschen, sondern suchen stattdessen das Ideale in einer nicht perfekten Welt. Das führt natürlich unweigerlich zu konstanter Enttäuschung. Online-Dating bietet sicher viele Möglichkeiten. Es kann einen aber auch lähmen, weil es immer jemanden gibt, dessen Profiltext noch ausgeprägter ist oder der ein noch hübscheres Profilbild hat.
progress: Anderseits, und das hast du ja bereits angeschnitten, kann es doch auch eine gute Möglichkeit für etwa LGBTQ-Jugendliche bieten.
Schmidinger: Sicher auf alle Fälle. Ich finde auch nicht, dass Online-Dating per-se schlecht ist, es ist halt ein Werkzeug, und es kommt stark darauf an wie man es nützt. Trotzdem glaube ich, dass Online-Dating dazu führt dass man überhöhte Erwartungen und falsche Vorstellungen bekommt. Wenn man es richtig nutzt, hat es sicher auch positive Seiten, gerade wenn man aus einem kleinen Ort kommt und niemanden kennt. Aber es gibt halt auch diese anderen Aspekte daran.
progress: Deine bisherigen Kurzfilm-Projekte haben sich unter anderem mit Themen rund um Sexualität und Beziehung beschäftigt. Du arbeitest gerade an deinem nächsten Filmprojekt. Worum wird es gehen?
Schmidinger: Das Thema ist Illusion, Phantasie, Gegenrealität. Es geht eigentlich ein bisschen um Desillusionierung und die dadurch entstehende Reifung. Im Grunde ist es ein bisschen so eine “coming of age“-Geschichte. Die Handlung dreht sich um die erste Liebe, um zwei Charaktere: der eine hat eine eher verzehrte Wahrnehmung auf Sexualität, sehr stark geprägt durch Pornographie, der andere hat eine stark verzehrte Wahrnehmung von Liebe, geprägt romantische Komödien und Lieder und so weiter. Beide treffen aufeinander und erleben eine Desillusionierung durch ihre Beziehung. Da kommt dann die Watschn der Realität, was oft natürlich nicht angenehm ist. Ich versuche ein wenig zurück zu dem ursprünglichen Gedanken der Romantik zu kommen. Monogamie probiert etwas zu konservieren, was nicht konservierbar ist.
progress: Ist Sexualität für dich eines der Kernthemen, wenn es um dein Filmschaffen geht?
Schmidinger: Eigentlich nicht aber es sind die Themen die mich zurzeit beschäftigen. Die Themen für meine Filme sind die Themen, die mich in meiner derzeitigen Lebensphase beschäftigen. Diese werden sich auch über die Jahre mit mir verändern.
progress: Wann wird der Film zu sehen sein?
Schmidinger: Ich bin gerade am Schreiben, die Produktion wird frühestens nächsten Sommer beginnen. Wenn alles gut geht ist 2015 realistisch.
Zur Person: Der 28 Jährige Gregor Schmidinger konnte bisher unter anderem mit den Kurzfilmprojekten „The Boy Next Door“, „Der Grenzgänger“ und Homophobia auf sich aufmerksam machen. Derzeit studiert er Drehbuch an der University of California Los Angeles (UCLA).
Das Interview führete Georg Sattelberger. Er Studiert Internationale Entwicklung an der Universität Wien.
Hier gehts zum Artikel: Romantik zwischen Suchfiltern