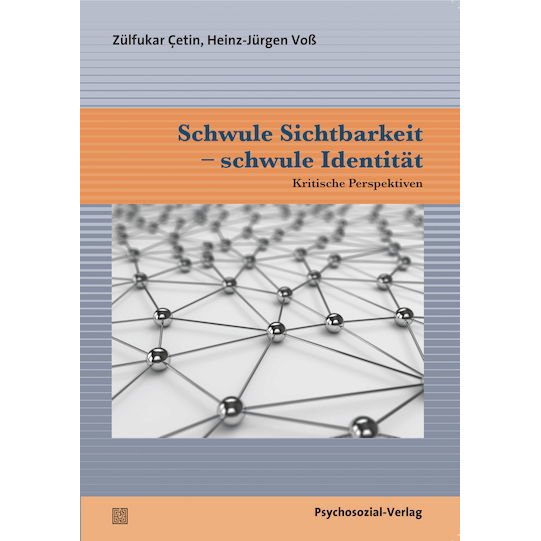Zulema Quispe und Julieta Ojeda sind Aktivistinnen des feministischen und anarchistischen Kollektivs Mujeres Creando in La Paz, Bolivien. Im Interview sprechen sie über ihre Arbeit und den Kampf um das Recht auf Abtreibung.
Seit 2005 wird Bolivien unter Präsident Evo Morales sozialistisch regiert. Neben Agrarreformen und der Verbesserung der Situation von Kokabauern und -bäuerinnen stehen vor allem die Rechte der indigenen Bevölkerung im Mittelpunkt der politischen Debatte. Trotz einzelner Gesetzesänderungen zur Stärkung der Rechte von Frauen sehen die Feministinnen von Mujeres Creando darin ein Problem, dass Abtreibung in Bolivien nach wie vor ein strafrechtliches Delikt ist.
progress: Wie hat das Projekt Mujeres Creando begonnen?
Julieta: Mujeres Creando wurde vor ungefähr 21 Jahren von María, Julieta und Mónica gegründet - unter anderem auf Grund der Erfahrungen, die sie in traditionellen linken Gruppen gemacht hatten, wo Frauen in der politischen Agenda einen zweitrangigen Platz einnehmen, weil das politische und revolutionäre Subjekt das Proletariat ist. Das politische Subjekt „Frau“, Indigenas oder Jugendliche haben dort keine eigene Stimme.
Deshalb beschlossen sie, eine eigene, heterogene Bewegung zu starten: eine feministisch-anarchistische und autonome Bewegung, unabhängig von politischen Parteien und NGOs und ohne sich der jeweiligen Regierung unterzuordnen. Wir wollten nicht Erfahrungen wiederholen, wie sie an anderen Orten oder auf internationaler Ebene gemacht wurden, wo viele Feministinnen elitäre Gruppen bilden, oder solche, denen nur eine bestimmte soziale Schicht, eine indigene oder kulturelle Gruppe oder Frauen einer bestimmten Altersgruppe angehören. Das spiegelt sich im gesamten Prozess von Mujeres Creando wider: Hier beteiligen sich Frauen aus indigenen Sektoren, Frauen aus Verbänden und Gewerkschaften, Sexarbeiterinnen, lesbische Gruppen, Haushaltsarbeiterinnen und Frauen, die Schuldnerinnen von Mikrokrediten sind.
Zu welchen Themen arbeitet ihr?
Julieta: Es gibt sehr konkrete Thematiken, die zum Beispiel mit Abtreibung, feministischer Selbstverteidigung oder Gewalt zu tun haben. Ein Arbeitsbereich ist etwa die Beratung zum Thema Abtreibung. Wir sind der Meinung, dass Information Frauen Sicherheit gibt, weil sie erlaubt, Entscheidungen zu treffen, die sicherer sind für den eigenen Körper und die eigene physische Integrität. Wir organisieren auch Selbstverteidigungskurse . Ein eigenes Büro beschäftigt sich mit Anzeigen in Zusammenhang mit männlicher Gewalt. Betroffene Frauen werden rechtlich beraten und bekommen Unterstützung , zum Beispiel auch bei Scheidungen. Das nennen wir konkrete Politik.
In der Einleitung eurer Broschüre zum Thema Abtreibung heißt es, „Pachamama, du weißt, dass Abtreibung Jahrtausende alt ist”. Könnt ihr etwas über die Geschichte der Abtreibung in Bolivien erzählen?
Julieta: Eine Compañera, Carina Aranda, hat viel zu Abtreibung in der vorkolumbianischen Zeit gearbeitet. Sie schreibt in der Broschüre, dass Abtreibung eine Praxis ist, die es in verschiedenen Kulturen der Welt gibt. In Bolivien wurde sie sowohl vor der Kolonialisierung sowie danach angewandt. Sie wirft auch auf, dass in den indigenen Kulturen und in ländlichen Gesellschaften Abtreibung praktiziert wird. Das erscheint uns besonders wichtig, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der der Diskurs vorherrscht, dass gewisse Praktiken, wie Homosexualität, Abtreibung oder sogar Prostitution und Sexismus, erst mit der Kolonialisierung zu uns gekommen seien. Es gibt eine ganze Reihe von Mythen und Vorstellungen, die keine, unter Anführungszeichen, wissenschaftliche Basis haben.
Carina Aranda führt außerdem das Thema Infantizid ein und behandelt es ohne Moralismen und Vorurteile. Feministinnen sollten sich mit Infantizid auseinandersetzen, weil dadurch aufgezeigt wird, dass Muttersein nichts Angeborenes oder Natürliches in uns Frauen ist. Es ist nicht so, dass wir, das neue Wesen, den Embryo, lieben, kaum haben wir ihn empfangen. Auf gewisse Weise wird dadurch das ganze Thema des Mutterinstinktes entmythisiert.
Unter welchen Bedingungen und mit welchen Methoden wird in Bolivien heute abgetrieben?
Zulema: Das ist von der finanziellen Situation abhängig. Der Großteil der Frauen, die keine finanziellen Mittel haben, führt unsichere Abtreibungen durch. Wenn du eine sichere Abtreibung haben willst, musst du um die 3.000 Bolivianos zahlen. Wenn du kein Geld hast, kannst du sogar um 160 Bolivianos mit Tabletten abtreiben, was aber wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Im Falle eines chirurgischen Eingriffs in einem der Spitäler, die nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, glaube ich, machen sie dir den Eingriff auch um 600 oder 400 Bolivianos. Sie bieten dort auch Tabletten an.
Julieta: Natürlich, ist das von deinen finanziellen Mitteln abhängig. Wir verlangen die Straffreistellung, weil sie einen demokratischen Zugang zu Gesundheit und bessere Bedingungen für alle Frauen bedeuten würde.
In Zusammenhang mit dem Kampf um die Straffreistellung von Abtreibung fordert ihr, dass der Staat einen kostenlosen Zugang ermöglicht?
Julieta: Es gibt mehrere Optionen. Abtreibung könnte legalisiert werden oder sie könnte straffrei gestellt werden. Wenn wir von Straffreistellung sprechen, sprechen wir auch davon, dass sie ein Thema des öffentlichen Gesundheitswesens sein muss. Der Staat soll sehr wohl Verantwortung übernehmen, aber nicht notwendigerweise durch eine Legalisierung der Abtreibung und indem er die Bedingungen festschreibt, unter denen Frauen abtreiben. Die Frauenbewegung selbst sollte das erarbeiten.
Ihr setzt euch also für die Straffreistellung und nicht für die Legalisierung ein, weil ihr nicht wollt, dass sich der Staat zu viel in die Angelegenheiten von Frauen einmischt?
Julieta: Ja. Für uns geht es nicht nur darum, Rechte zu erkämpfen. Das ist ein wichtiger Teil, aber von einer feministischen Perspektive aus wollen wir klarmachen, dass wir das Recht haben, als Frauen selbst über unsere Körper zu entscheiden, egal ob es um Mutterschaft oder Abtreibung geht. Es geht darum, sich dieses Recht, das uns in der Geschichte weggenommen wurde, wieder anzueignen.
Wie ist die rechtliche Situation im Moment? Gibt es Fälle, in denen abgetrieben werden darf?
Zulema: Das Strafgesetzbuch stellt Abtreibung unter Strafe, aber sie ist straffrei bei Vergewaltigung, wenn eine Fehlbildung des Fötus besteht, bei Inzest, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist und im Falle von Entführung mit Vergewaltigung, auf die keine Eheschließung folgt. In allen anderen Fällen stehen darauf zwei Jahre Gefängnis.
Was ist die Position der Regierung und Evo Morales gegenüber Abtreibung?
Zulema: Dieses Jahr gab es eine interessante Debatte zum Thema. Eine Abgeordnete thematisierte die Straffreistellung von Abtreibung, einige andere Abgeordnete schlossen sich ihr an. Aber der Präsident meinte sinngemäß, er könne keine Meinung zu dem Thema abgeben, weil er nicht Bescheid wisse, gleichzeitig denke er, abzutreiben bedeute, jemanden zu töten.
Julieta: Das Thema Abtreibung wird oft nur sehr oberflächlich behandelt. Häufig dient es dazu, andere Debatten unter den Teppich zu kehren. In diesem Fall erscheint es mir so, als hätten sie ausprobieren wollen, was passiert, wenn man Abtreibung thematisiert. Aber es ist nach hinten losgegangen, weil es eine sehr starke Reaktion seitens der katholischen Kirche und seitens konservativer Sektoren gab, inklusive einiger Sektoren, die der Regierung nahestehen. Es gab aber eine viel positivere Reaktion seitens der Gesellschaft; zumindest die Bevölkerung von La Paz hat meines Erachtens auf offenere Weise reagiert. So wurde auch Raum für Diskussion und Mobilisierung geschaffen.
Die Regierung nutzt den identitären indigenen Diskurs stark aus. Was haltet ihr von diesem Diskurs?
Zulema: In erster Linie ist die Regierung meiner Meinung nach einem Obskurantismus des „Ursprünglichen“ verfallen: Alles Ursprüngliche ist gut, vor der Kolonialisierung gab es keine Abtreibung und keinen Sexismus – vor der Kolonialisierung war das hier angeblich ein Paradies. Die Regierung versucht diesen Zustand wieder herzustellen. Es kommt mir nicht so vor, als würde sie diesen Diskurs ausnutzen. Vielmehr hat sie ihn selbst immer geführt. Jene Frauen, wie die Bartolina Sisas (Anm. d. Red.: Zusammenschluss bolivianischer Bäuerinnen, benannt nach der Freiheitskämpferin), die gegen Abtreibung sind, wissen sehr wohl, dass es sich dabei um eine Praxis handelt, die es immer schon gegeben hat. Trotzdem sind alle diesem Diskurs verfallen, dass früher nicht abgetrieben wurde.
Julieta: Das Thema der Verteidigung des Lebens, also die Vorstellung, dass alles Leben ist, dass alles von der Pachamama (Anm. d. Red.: zentrale Gottheit in der mittleren Andenregion) kommt, das ist eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise dessen, was Leben und die Verteidigung der Natur oder der Umwelt ist. Ich glaube, das sind Fundamentalismen, die vor allem indigenistische Theoretiker_innen mit der Zeit begründet haben. Es gibt jedoch Untersuchungen, die aufzeigen, dass zum Beispiel die Aimara-Frauen, wenn sie abtreiben, keine Schuld fühlen, weil ihre Beziehung zur katholischen Kirche und zu Gott eine andere ist. Sie können viel offener und viel eher ohne Vorurteile über Abtreibung sprechen. Sie betrachten sie als Teil des Kreislaufs des Lebens. Das Thema Schuld wurde ihnen nicht so eingeimpft, wie anderen Frauen.
Mehr Informationen zur Arbeit und den Veröffentlichungen von Mujeres Creando sind auf http://www.mujerescreando.org/ zu finden.
Das Interview führten Carmen Aliaga und Isabel Rodríguez.