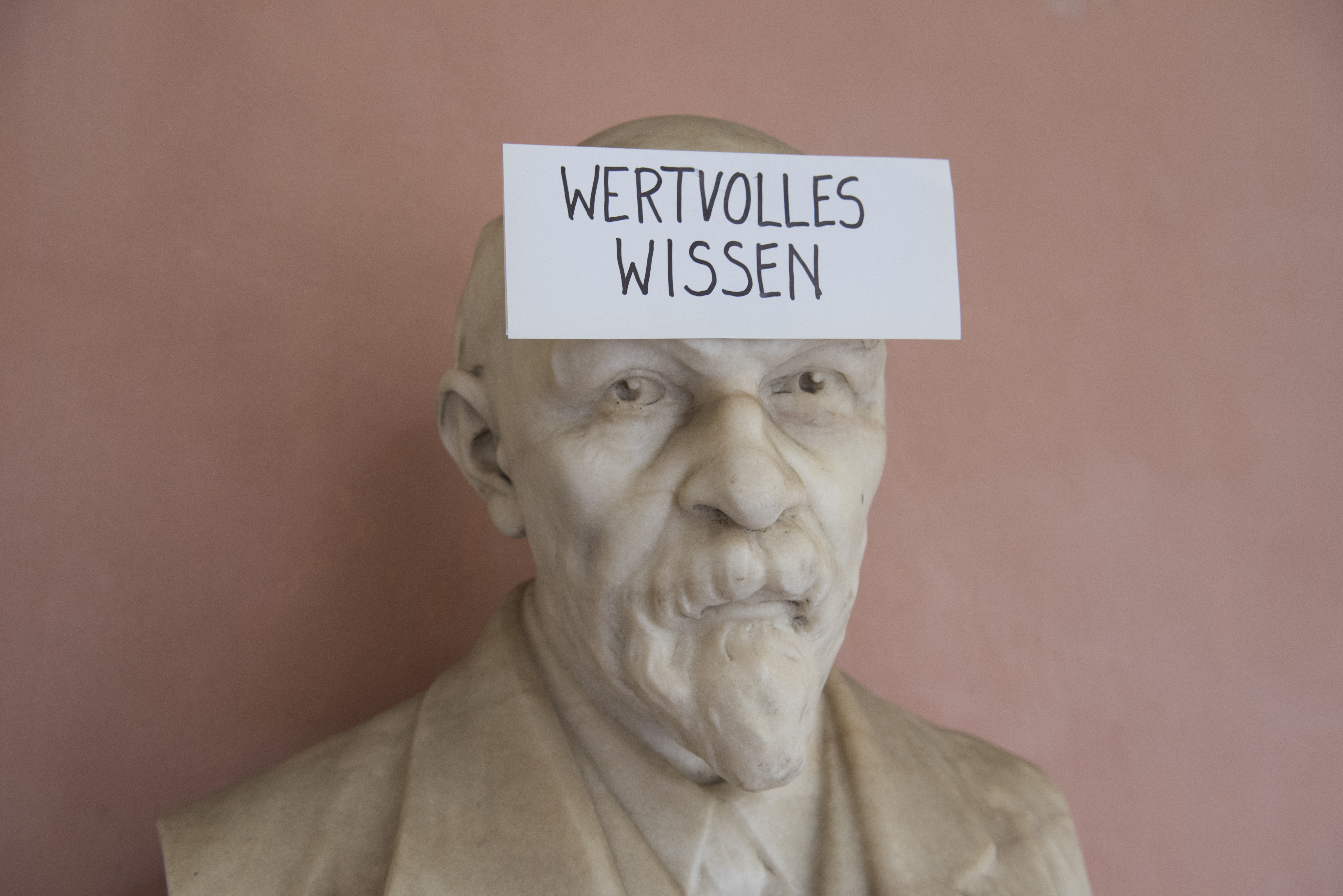Labels, die regeln sollen, wer in feministische Schutzräume darf, gibt es viele, gerade in Uni-Kontexten. Doch wer ist eigentlich wirklich gemeint? Eine Kritik.
Im Rahmen der Frauenbewegungen wurden bestehende Räume wie Universitäten für Frauen geöffnet – und neue Räume geschaffen. Dazu gehören feministische Bibliotheken oder frauengeführte Kneipen. Manche Räume sollen Schutzräume sein, also die Möglichkeit bieten, ohne Anfeindungen, Häme und Konkurrenzgefühl neue Fähigkeiten zu lernen, sich fortzubilden und auszutauschen. Deshalb haben Männer dort keinen Zutritt. Die Räume selbst können fixe Lokalitäten sein, wie etwa der „Uni Frauen Ort“, das „UFO“ in der Wiener Berggasse, das seit mehr als 30 Jahren besteht. Andere Räume existieren als temporäre Aneignung bestehender Orte, etwa im Rahmen von Workshops und Seminaren wie der wissenschaftlichen Schreibwerkstätte für Frauen*, die jedes Semester an der Uni Wien angeboten wird. Auch bei anderen Veranstaltungen wie Konferenzen, Diskussionen und Vorträgen kann gelten: „nur für Frauen“ oder „FLIT* only“. Doch was bedeutet das?
Orte für wen? „Frauen“, „Frauen*“ und „FrauenLesben“ haben als Labels eine lange Tradition. Die Schreibweise mit Sternchen und die Bezeichnung „FrauenLesben“ entwickelten sich aus der Kritik am eindimensionalen Frauenbegriff. Beide Labels zeugen von der Ablehnung der Idee, dass es „die Frau an sich“ gäbe. Es wird außerdem damit betont, dass die so eingeordneten Personen kein verbindendes Element, keine „wirkliche Weiblichkeit“ teilen, es also keine Frauen jenseits gesellschaftlicher Einteilung gibt. Der Begriff FrauenLesben fungiert als Sichtbarmachung von Lesben und ihren spezifischen Belangen. Auch die Idee vom Lesbischsein als mögliche Geschlechtsidentität schwingt in der Bezeichnung mit.

Wer sich in Hochschulräumen oder dem aktivistischen Milieu bewegt, der_die mag auch schon über den Begriff FLIT (manchmal auch FLIT* geschrieben) gestolpert sein. Eine schnelle Google-Suche nach den vier Buchstaben führt zu einem Insektizid, das in den 20ern gegen Moskitos entwickelt wurde sowie zur „flow control digit“, einem Begriff aus der Routerund Netzwerktechnik. Allerdings soll das Label FLIT* nicht die Paketvermittlung in einem Netzwerk beschreiben oder gar die Umwelt mit DDT vollpumpen, sondern die Diversität der in einem Raum willkommenen Menschen sichtbar machen. Der Begriff FLIT steht für Frauen_Lesben_Inter*_Trans*. „Trans*“ meint alle, die sich nicht oder nicht ausschließlich dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig fühlen. Trans*Personen und Wissenschaftler_innen benutzen verschiedene Begriffe wie z.B. Transgender, Transsexuelle, Transidenten, die je nach Person verschieden definiert und abgegrenzt werden. Der Überbegriff Trans* wird dabei nicht von allen Trans*Personen gutgeheißen. Manche nutzen Trans*Frau/Trans*Mann als Selbstbezeichnung, andere verwenden trans* als Adjektiv und manche möchten nur als Frauen oder Männer bezeichnet werden. Der Überbegriff Inter* steht für Menschen, deren Körper nicht in gesellschaftlich aufgestellten Normen von dem, was Männer- bzw. Frauenkörper beinhalten dürfen/müssen, passen. Dies kann aufgrund ihrer Chromosomen, Genitalien, Gonaden, Hormonlevel oder Kombinationen von diesen Faktoren sein. Neben "inter*" werden häuftig auch Begriffe wie intersexuell oder intergeschlechtlich verwendet.
Willkommen? Darüber, wer (nicht) in Schutzräumen willkommen ist, wird diskutiert und gestritten, seit es diese Räume gibt, obgleich es naheliegend scheint, dass Frauen(*)-Räume allen Frauen(*) offenstehen. Immerhin herrscht in feministischen Kreisen weitestgehend Einigkeit darüber, dass Geschlecht ein soziales Konstrukt ist und Frausein nicht über Genitalien oder bestimmte Hormonspiegel definiert wird. Bei der Frage nach Trans*Frauen in Frauen(*)-Räumen berufen sich jedoch einzelne Raumverwalter_innen auf die Anatomie oder bemühen andere – meist ebenso trans*und inter*feindliche – Argumentationen. Die Anwesenheit von Trans*Männern wird und wurde seltener oder weniger intensiv diskutiert, weil sie wegen dem bei der Geburt zugewiesenen weiblichen Geschlecht geduldet werden. Inter*Personen und nichtbinäre Personen, also jene, die sich nicht eindeutig als Mann oder Frau identifizieren hingegen werden meist – wie auch in den LGBT-Szenen – schlicht übersehen. Angesichts der Frage, wer in „ihren“ Räumen und Gruppen willkommen ist, haben sich bereits viele feministische Gruppen und Szenen zerstritten und gespalten.
Alle ausser Männer? Vor dem Hintergrund dieser Debatten und unterschiedlichen Positionen ist es fahrlässig, wenn Gruppen nicht klar dazu Stellung beziehen, wen sie in ihren Frauen(*)und FLIT-Räumen willkommen heißen und wen nicht. Viele Räume sind offen für alle Personen, die keine Cis-Männer sind. Die Vorsilbe „cis“ ist das Gegenstück zu trans* und inter*. Damit sind jene Menschen bezeichnet, bei denen Geschlechtsidentität und bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht übereinstimmen. Manche Räume wie beispielsweise das Wiener Frauenzentrum richten sich ausschließlich an Cis-Frauen und Cis-Lesben.
Zudem gibt es Orte, die manche Personengruppen aus dem Trans*und Inter*-Spektrum akzeptieren, andere jedoch nicht. So sind in einigen Räumen neben Cis-FrauenLesben nur als Frauen oder weiblich identifizierte Trans*und Inter*Personen willkommen, Trans*Männer aber nicht. Andere Räume richten ihr Angebot hingegen nur an Trans*und Inter*Personen, die bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet wurden. Fragt mensch verschiedene Mitglieder der Organisation, was etwa mit dem Stern hinter Frauen* auf dem Einladungsplakat gemeint ist oder wen FLIT genau einschließt, folgt erfahrungsgemäß in vielen Fällen Schweigen. Das Team hat offenkundig selbst nicht darüber gesprochen, was und wer mit dem schicken Label Frauen(*)/FLIT gemeint ist.
Mitgemeint? Wenn bei einer Veranstaltung nicht angegeben wird, wer genau willkommen ist, ergibt sich für einige Besucher_innen oft eine unsichere Situation. Nämlich für jene, die vom hegemonialen Bild der Cis-FrauenLesben abweichen. Wer nicht als FrauLesbe gelesen wird, sucht Frauen(*)bzw. FLITRäume mit einem Kloß im Hals auf. Eine Trans*Frau kann sich etwa bei einem Event, das zur Einladungspolitik keine Informationen bereitstellt, nicht sicher sein, ob sie „mitgemeint“ ist und wie die Veranstalter_innen zu Trans*Personen stehen. Sie kann nicht abschätzen, ob sie an der Tür aufgehalten und abgewiesen wird. Oder ob ihr während der Veranstaltung vielleicht abschätzige Blicke oder körperliche Übergriffe drohen, wenn sie von Teilnehmer_innen für einen Cis-Mann gehalten wird, der sich unrechtmäßig Zutritt zu einem Frauen-Raum verschafft hat. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Räume, Gruppen und Events eindeutig offenlegen, wen sie wirklich ansprechen wollen.
Egal ob die Einladungspolitik Menschen jenseits von Cis-Lesben und Cis-Frauen ansprechen soll oder nicht: Wenn nicht gleich offengelegt wird, wer gemeint ist, geschieht das auf dem Rücken der oft mehrfach diskriminierten Nicht-Cis-Personen, die sich in eine ungewisse Position begeben müssen – oder gleich zu Hause bleiben. Selbst wenn sie „mitgemeint“ sind: Die anderen Besucher_innen haben die Einladungspolitik oft nicht gelesen und ihre eigenen Ideen davon im Kopf, wer (nicht) im Raum willkommen ist. Passive Aggressivität und übergriffiges Verhalten („Was machst du denn hier, das ist‘n Frauenraum!“) können auch in inklusiven Räumen die Folge sein, wenn nicht kommuniziert wird, wer dort sein darf.

Eigene Formulierungen. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, wäre es, Einladungen zu spezifizieren, statt sich eines vorgefertigten Labels wie FLIT zu bedienen. „Alle außer Cis-Männer“ ist viel eindeutiger als FLIT, weil nicht offen bleibt, ob auch männlich identifizierte Trans*und Inter*Personen gemeint sind, und es transportiert gleichzeitig, dass reflektiert wurde. Dadurch wird für weitere potentielle Teilnehmer_innen transparent, dass nicht nur Cis-Frauen gemeint sind. Auch „offen für alle, die sich weiblich identifizieren“ oder „alle negativ von Sexismus betroffenen Personen“ sind Möglichkeiten, eine spezifische Einschränkung der Teilnehmer_innen vorzunehmen.
Die Einladungspolitik selbstständig zu formulieren ist eine Möglichkeit für die Organisator_innen, sich darüber klar zu werden, wie die Ansprüche an Raum und Veranstaltung zusammenpassen. Ein Workshop zu sexistischer Diskriminierung etwa könnte sich nicht nur auf die Perspektive von cis-heterosexuellen Frauen beziehen, sondern die Erfahrungen von Menschen anderer Identitäten einschließen. Außerhalb des Geschlechts- und Begehrensaspekts gibt es noch andere Ausschlüsse, wenn es etwa immer weiße Personen ohne Behinderungen sind, die den Standard setzen und so die Perspektiven von People of Color und Menschen mit Behinderungen, die in den meisten Räumen in der Unterzahl sind, übergangen werden.
Die Türpolitik. Auch wenn ein Raum für verschiedene Menschengruppen geöffnet ist, fehlt häufig ein reflektierter Umgang mit der Diversität der Teilnehmenden. Vielen Veranstalter_innen ist nicht bewusst, dass es unmöglich ist, vom Aussehen einer Person auf deren Geschlechtsidentität zu schließen. Auf diese Weise erfahren betroffene Nicht-Cis-Personen, dass sie in diesem vermeintlichen Schutzraum nicht mitgedacht, sondern bestenfalls geduldet sind. Diese Art der Diskriminierung führt den Wunsch nach einem Raum für Austausch auf Augenhöhe ad absurdum. Zur Frage, wie das Problem des Doppelstandards umgangen werden kann, hat zum Beispiel Laura* auf ihrem Blog „HeteroSexismus hacken“ Anregungen gesammelt. Der vermutlich praktikabelste Ansatz wäre es, die Einladungspolitik am Eingang gut sichtbar zu machen und beim Einlass alle Menschen unabhängig von deren Äußerlichkeiten auf die Einladungspolitik hinzuweisen. Es gilt auch auszuprobieren, was funktioniert und was nicht – Hauptsache das eigene Verhalten wird reflektiert und Verantwortung dafür übernommen, statt sich hinter Labels zu verstecken.
Non Chérie studiert in Wien Japanologie und Gender Studies und macht so Queerkram.
*Sternchen in diesem Text weisen nicht auf Anmerkungen am Ende hin! Sie sind, wie öfter im progress, ein Zeichen für gendergerechte Sprache, die Menschen jenseits der Mann-Frau-Binarität einschließen möchte.