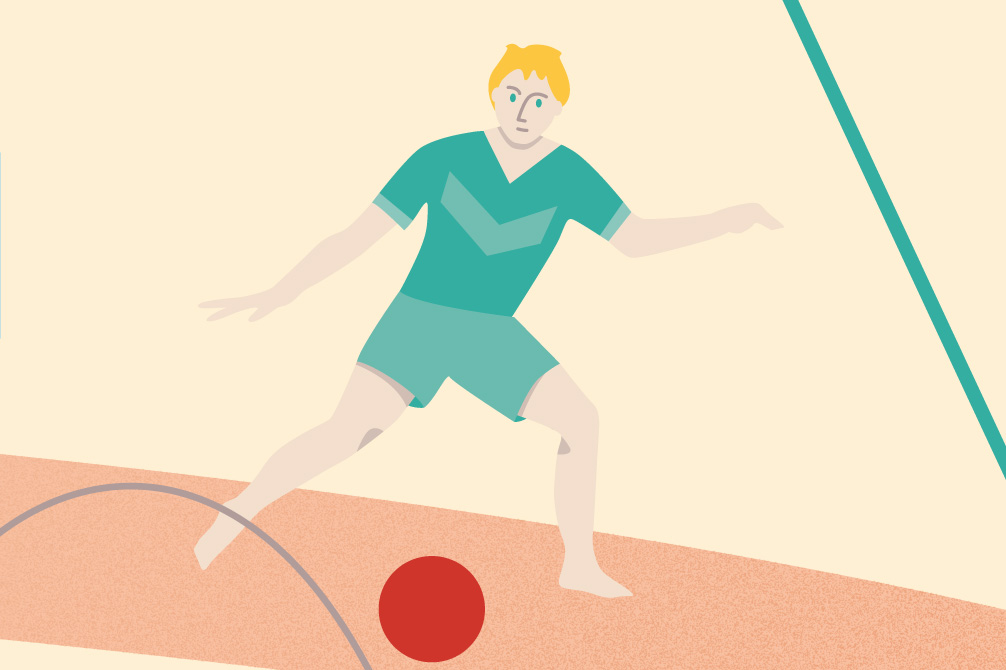„Alternative gab es keine“
Der syrische Fußballtrainer Osama Abdul Mohsen wurde durch den Tritt einer ungarischen Kamerafrau berühmt. In Spanien hat er eine neue Heimat gefunden.

Der syrische Fußballtrainer Osama Abdul Mohsen floh mit seinem Sohn Zaid nach Europa. In Ungarn gelangte er durch den Tritt einer Kamerafrau ins mediale Rampenlicht. In Spanien, wo er eine neue Heimat gefunden hat, trüben Gerüchte um seine angebliche islamistische Vergangenheit den Neubeginn, wie er Jan Marot sagt.
progress: Wie geht es Ihnen nach den ersten Monaten nach der Flucht aus Syrien über die Türkei und die Balkanroute?
Osama Abdul Mohsen: Es geht mir wieder gut. Ich bin sehr, sehr froh, hier in Spanien zu sein. Die Kleinstadt Getafe ist eine ruhige Stadt mit freundlichen Menschen. Ich lebe hier in einer sehr hilfsbereiten, fremdenfreundlichen Nachbarschaft. Man hat uns mit offenen Armen empfangen. Ich bin hier sehr glücklich mit meinen beiden Söhnen. Man grüßt uns auf den Straßen, lächelt uns zu. Und man ist um unser Wohl besorgt, aber auch sehr interessiert an unserem Leben in Syrien und unseren Erfahrungen auf der Flucht.
Wie geht es Ihren Kindern in Spanien, dem jungen Zaid und dem volljährigen Mohammed?
Auch ihnen geht es wieder sehr gut. Sie haben längst mit der Schule begonnen und auch FreundInnen gefunden. Wenngleich vor allem Zaid, dem Siebenjährigen, seine Mutter sehr fehlt. Ich habe just nach meiner Ankunft hier einen Intensivsprachkurs begonnen und übe auch täglich mit meinen Kindern. Spanisch ist enorm wichtig. Nicht nur für das Leben hier und unsere Integration, sondern auch für meine Arbeit als Fußballtrainer.
Welches ist Ihr Lieblingsfußballteam in Spanien?
Real Madrid, wie könnte es anders sein (lacht). Bereits in Syrien war ich Fan. Und mein Sohn Zaid auch. Es war eine wunderbare Erfahrung, nach unserer Ankunft, das Team und Cristiano Ronaldo zu treffen und ein paar Pässe mit ihnen zu spielen. Damit ging für Zaid ein Traum in Erfüllung. Und er fasste auch neuen Mut, nach all der Mühsal und den schweren Monaten der Flucht.
Was waren die schwersten Stationen auf Ihrer Flucht?
Viele Stationen waren schwer, sei es in Griechenland, etwa auf der Insel Kos, direkt nach der Überfahrt. Aber auch in Mazedonien oder Serbien. Man erlebt Phasen permanenter Angst, teils Todesängste, und die quälende Ungewissheit nagt an einem. Was einen vorantreibt ist die Hoffnung, die ja bekanntlich zuletzt stirbt – die Hoffnung auf ein besseres Leben, in erster Linie für meine Kinder. Es war sehr, sehr hart. Doch ich muss sagen, Ungarn war mit Abstand der allerschlimmste Teil der Flucht. Ein permanenter Alptraum. Ein Land, das jegliche Menschlichkeit verloren zu haben schien. Aber das ist zum Glück jetzt alles überstanden. Hier in Spanien will ich bleiben. Hier bin ich nach langer Zeit wieder zufrieden und vor allem auch ruhiger geworden.
Wie haben Sie Österreich in Erinnerung?
In Österreich hat man uns sehr, sehr freundlich empfangen. Die PolizistInnen waren ausgesprochen hilfsbereit, die Soldaten des Bundesheeres auch. Viele Menschen waren offen und herzlich. Sie fragten, was uns fehlt, und gaben uns, was wir brauchten. Essen, Kleidung und auch Geld hat man uns gegeben. Mein jüngerer Sohn Zaid war ja zuvor in Ungarn bereits erkrankt. Er hatte sich stark verkühlt und fieberte. Dort hat man ihn nicht behandelt. Keine Chance. In allen Krankenhäusern hat man uns abgewiesen. In Österreich war ich mit ihm in drei Spitälern und überall hat man uns sofort geholfen. Und Zaid ist rasch gesund geworden, zum Glück. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den ÄrztInnen und allen Menschen, die uns in Österreich geholfen haben, von Herzen bedanken.
Gab es auch so etwas wie „gute Tage“ auf der Flucht?
Natürlich ist nicht jede Minute hoffnungslos. Solidarität zeigte man uns vielerorts. Und Flüchtlinge untereinander teilen und helfen, wie sie nur können. Auch in Griechenland, auf Kos, in Mazedonien und Serbien war man oft sehr nett und hilfsbereit. Die Menschen, die dort leben, tun, was sie können. Sie leben Menschlichkeit. Anders als in Ungarn. Aber die Lebensstandards sind nun einmal ganz andere als in Österreich und Deutschland. Dementsprechend half man uns dort weit mehr als in den Balkanstaaten oder dem von der Krise geprägten Griechenland. Vor allem seitens Privatpersonen, aber auch seitens der Sicherheitskräfte und des Roten Kreuzes. Weil die Menschen mehr haben. Doch auch diejenigen, die wenig haben, teilten oftmals das Wenige mit uns. Und wir waren viele Flüchtlinge, hunderte, oft tausende, die sich von Station zu Station bewegten.
Haben Sie noch Kontakt zu FreundInnen in ihrer Heimatstadt Deir ez-Zor?
Leider kaum. Das ist fast unmöglich. Maximal einmal im Monat schaffe ich es, mich mit meinen zwei Brüdern in Syrien auszutauschen. Die Wartezeit dazwischen ist geprägt von Ungewissheit und Angst. Denn man weiß nie, ob es das letzte Mal war, mit ihnen gesprochen zu haben. Aber zum Glück ist meine Frau in Sicherheit. Sie lebt noch in der Türkei. Ich versuche alles Menschenmögliche, damit sie auch zu mir nach Spanien kommen kann. Ich hoffe, das dauert nicht mehr lange. Ende November werde ich sie endlich besuchen können. Mit Zaid, meinem kleinen Sohn. Die Türkei-Visa und unsere Pässe haben wir nun bekommen, am 23. 11. fliegen wir. Ich habe meine Frau fast ein halbes Jahr nicht mehr in den Armen gehalten. Zaid vermisst seine Mutter sehr.
Haben Sie auch in den Flüchtlingslagern in der Türkei an der syrischen Grenze gelebt?
Nein, das wollten wir von Anfang an vermeiden. Die Zustände in den Lagern sind sehr schlecht. Also haben wir, einmal in der Türkei angekommen, für mich, meine Frau und meine Kinder ein kleines Haus gemietet. Das war sehr, sehr teuer. Und ich musste für zehn Euro Lohn am Tag schuften, damit wir Nahrung und ein Dach über dem Kopf hatten. Nach zwei Jahren hatten wir es satt, unter derartigen Bedingungen ein Überleben zu fristen. Meine Familie beschloss, dass ich mich auf den Weg nach Europa machen soll, mit meinem jüngsten Sohn. Das war keine leichte Entscheidung. Aber Alternative gab es keine.
Hat sich die Kamerafrau, die Sie attackiert hatte, bei Ihnen persönlich entschuldigt?
Das ist eine sehr bösartige Person. Sie hat nicht nur mich getreten, als ich meinen Sohn tragend vor der Polizei davonlief. Auch ein junges Mädchen hat sie getreten. Das sind Taten, die unentschuldbar sind. In Ungarn gehen aber viele Menschen davon aus, dass wir Flüchtlinge die Bösen sind und man ihnen sehr deutlich zeigen müsse, dass sie hier eben nicht willkommen sind. Unmenschlich ist das. Ich bin aber in Kontakt mit AnwältInnen und werde sie anzeigen, auf dass sie hoffentlich ins Gefängnis kommt.
Was sind Ihre Pläne für die nahe Zukunft in Spanien?
Ich bin noch bei der Trainerschule in Getafe. Ganz gleich bei welchem Team man mich braucht, ich werde dort arbeiten. Wie es nun aussieht, wird es ein Jugendteam werden, Villaverde Boetticher in Madrid, wo ich neben meiner Trainertätigkeit auch für die kommerziellen Beziehungen zu arabischen Staaten gebraucht werde. Das sei einmal für ein Jahr, wie man mir sagte. Dann werden wir weitersehen. Solange ich nicht nach Syrien zurückkehren kann, wird Spanien meine Wahlheimat bleiben.
Wie stehen Sie zu den internationalen Militärinterventionen?
Viele Nachrichten, die aus Syrien gemeldet werden, sind Lügen. Das Assad-Regime verbreitet selbst sehr viele Lügen. Ja, Assad hat Russland um Hilfe gebeten. Aber gegen wen? Und für welchen Zweck? Selbstzweck natürlich, um seine Position abzusichern. Die Zivilbevölkerung interessiert ihn wenig. Das Leben im Bürgerkrieg ist schlichtweg katastrophal. Das war es schon vor fast drei Jahren, als ich aus Syrien 2012 in die Türkei geflohen bin. Folglich habe ich auch vom Islamischen Staat, der dort mit Splittergruppen aktiv ist, noch nichts mitbekommen. Und ich hatte auch keinen Kontakt zum IS, der nun in weiten Teilen meiner Heimat wüten soll.
Nähe zum IS ist etwas, das man Ihnen auch wegen des Posts eines schwarzen Banners mit dem Schriftzug „Es gibt keinen Gott außer Gott“ auf Ihrem Facebook-Profil vorgeworfen hat. Und auch wenn man Ihren Namen googelt, scheint „Terrorist“ auf.
Das sind Lügen und bösartige, haltlose Gerüchte. Ich habe an Anti-Assad- Protesten für einen demokratischen Wandel in Syrien teilgenommen. Und man weiß nur zu gut, wie mit KritikerInnen von Präsident Bashir al-Assad verfahren wird. Die Gerüchte wurzeln vor allem in den Kommentaren eines Regime-freundlichen Journalisten und in rechtsextremen Online- Foren. Ich verabscheue Gewalt und habe absolut gar nichts mit radikalislamistischen Gruppen wie al-Nusra im Bürgerkrieg zu tun, das versichere ich Ihnen. Das Facebook-Foto hat man falsch interpretiert, auch wenn ich es mittlerweile entfernt habe. Der Spruch ist allen MuslimInnen wichtig. Nicht nur den Radikalen, die ihn für ihre Zwecke missbrauchen. Und nebenbei: Derselbe Spruch ziert auch die saudiarabische Flagge.
Glauben Sie, je nach Syrien zurückkehren zu können?
So Gott will ja, irgendwann. Doch der Krieg hat alles zerstört. Es ist sehr gefährlich und auch auf lange Sicht sehe ich keinen Frieden für mein Land am Horizont. Das Leben dort ist unmöglich geworden. Wenn der Krieg enden soll, „inshallah“, würde ich freilich gerne wieder als Trainer dort arbeiten. Aber derzeit kann ich meiner Familie von Spanien aus mehr helfen, als von vor Ort. Und auch meinem Land. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen? Das Morden aller Seiten muss aufhören. Der IS mordet, Assad mordet. Die RebellInnen morden. Europa muss uns helfen. Den Flüchtlingen, aber auch vor Ort. Die Regierungen, auch die spanische sind gefordert. Und die Verantwortlichen wissen selbst zu gut, dass sie mehr für Syrien und die syrische Bevölkerung machen können.
Jan Marot studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in Wien und Zürich und arbeitet als freischaffender Journalist in Granada, Spanien.